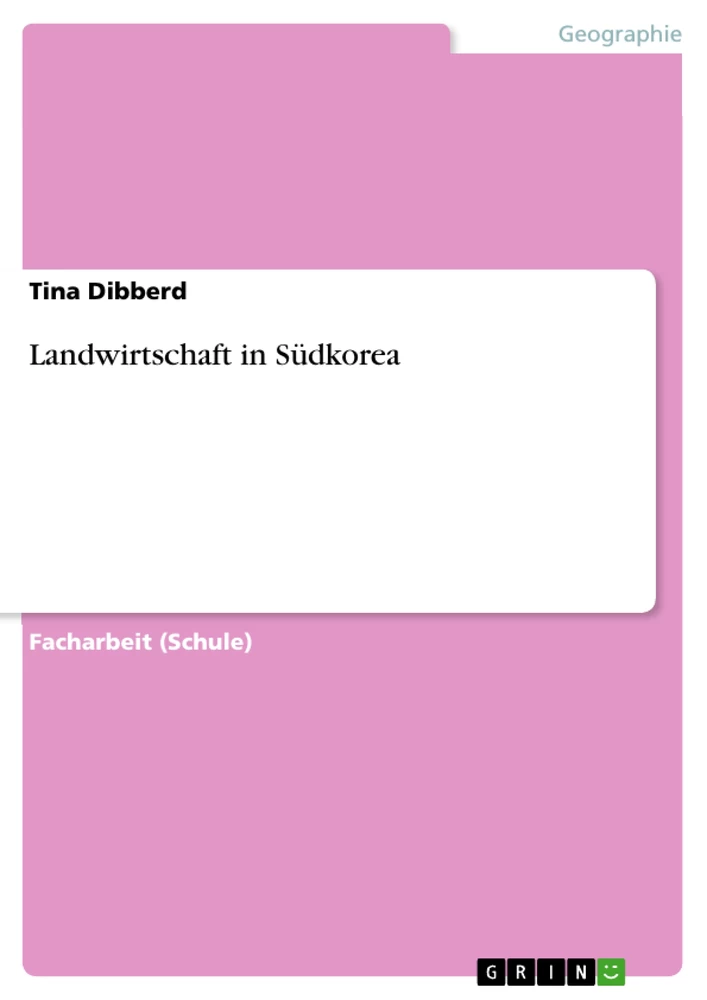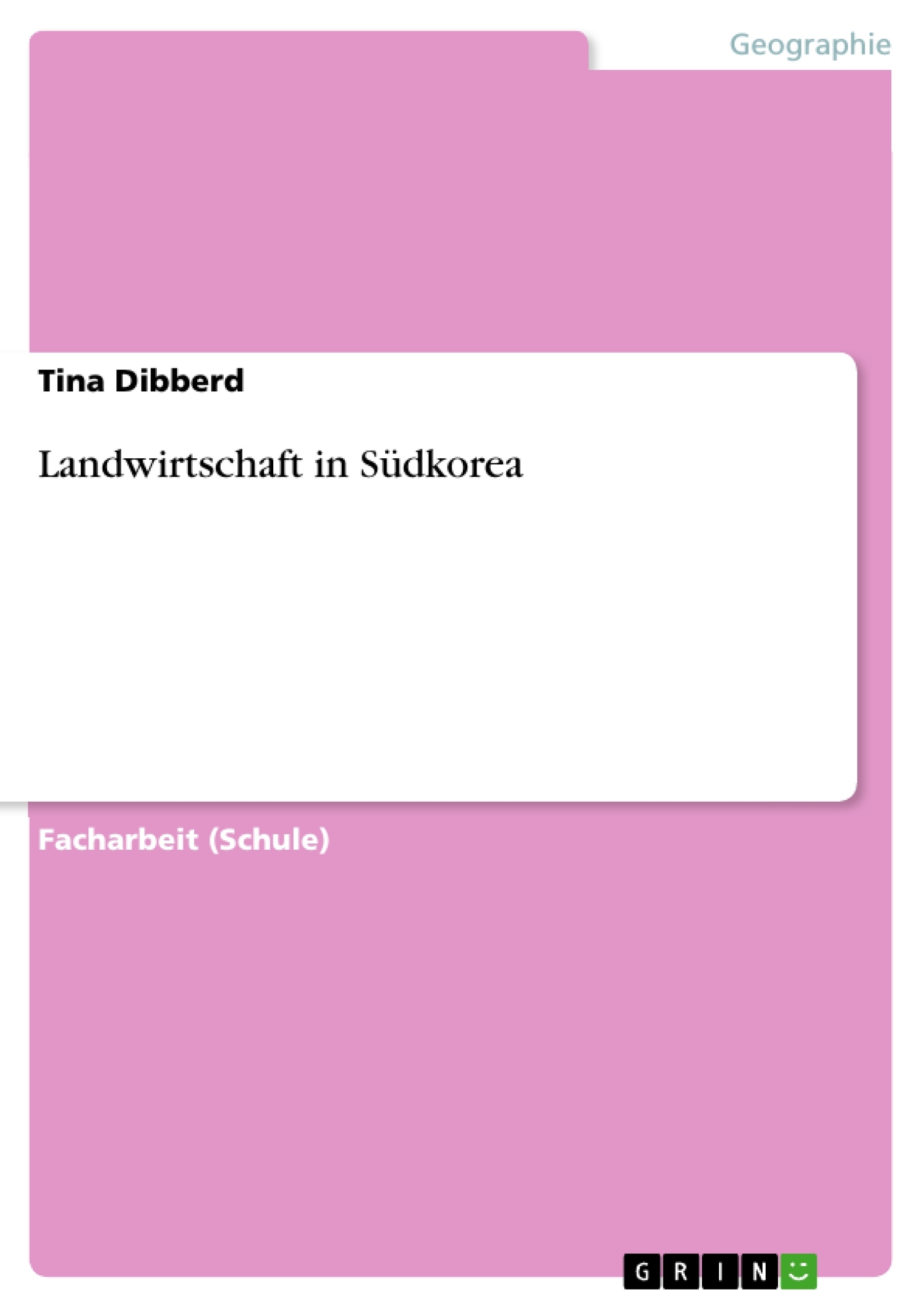Eine Reise durch die Geschichte der südkoreanischen Landwirtschaft offenbart ein faszinierendes Zusammenspiel von Geographie, Politik und wirtschaftlichem Wandel. Von den klimatischen Herausforderungen und der traditionellen Bedeutung des Reisanbaus bis hin zu den tiefgreifenden Auswirkungen der Kolonialzeit und des Koreakriegs entfaltet sich ein komplexes Bild. Die Landreform, die amerikanische Wirtschaftshilfe und die Grüne Revolution prägten entscheidend die Entwicklung, während die Industrialisierung und die Saemaul Undong-Bewegung das ländliche Leben transformierten. Dieses Buch beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, mit denen die koreanische Landwirtschaft konfrontiert war, von der Sicherstellung der Lebensmittelversorgung bis zur Bewältigung des Spannungsfelds zwischen internationalen Handelsabkommen und dem Schutz der heimischen Bauern. Es analysiert die politischen Weichenstellungen, die Subventionierung der Landwirtschaft und die Rolle von Genossenschaften, und zeigt, wie sich die Essgewohnheiten der Bevölkerung und die Anbaustrukturen im Laufe der Zeit veränderten. Die Uruguay-Runde und die darauffolgende Liberalisierung des Agrarmarktes stellten die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen, während gleichzeitig die Abwanderung vom Land und die Überalterung der landwirtschaftlichen Bevölkerung die strukturellen Probleme verstärkten. Ein umfassender Blick auf die Agrarpolitik, die Mechanisierung und die Bedeutung von Nebenerwerbslandwirtschaft vermittelt ein tiefes Verständnis für die Transformation der südkoreanischen Landwirtschaft bis in die 1990er Jahre und darüber hinaus. Es werden die Fragen nach Wettbewerbsfähigkeit, Umweltschutz und dem Erhalt der traditionellen Kultur aufgeworfen, während die Analyse der bestimmenden Faktoren in der Landwirtschaft von natürlichen zu ökonomischen Einflüssen einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gibt. Tauchen Sie ein in die Welt der koreanischen Bauern, ihrer Traditionen und der Kräfte, die ihr Leben und ihre Arbeit geprägt haben, um die Bedeutung der Landwirtschaft für die koreanische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Entdecken Sie die subtilen Wechselwirkungen zwischen Agrarwirtschaft, Handelspolitik und dem Streben nach nationaler Sicherheit in einer sich rasant verändernden Welt.
Gliederung
I Klima und Regionen
II Geschichtliche Voraussetzungen
III Landreform
IV Die Landwirtschaft zu Beginn der Industrialisierung
V Saemaul Undong (Neues Dorf-Bewegung)
VI Die Entwicklung bis 1990
VII Die Ergebnisse der Uruguay-Runde
VIII Die Entwicklung ab 1990
IX Fazit
X Anhang
I Klima und Regionen
- Etwa am 24. Juni setzt die erste Regenzeit ein, die zwei Wochen dauert
- Maritim-tropische Luftmassen werden von der Polarfront im August wieder zurückgedrängt; die zweite Regenzeit (im Norden ab dem 16., im Süden ab dem 20. August) dauert etwa 25 Tage
- Nach einem kurzen sonnigen Herbst dominiert ab November das sibirische Kältehoch den Winter über ⇒ fisiehe Abb. 1
- Landwirtschaftliche Nutzfläche 1/5 der Fläche Südkoreas
- Bergfläche 58,9% der Landfläche mit einem landwirtschaftlichen Nutzungsgrad von etwa 10%
- Die Obergrenze des Anbaus im Bergland liegt bei (angestrebten) 15°, in den 70er Jahren wird ab 20° Hangneigung aufgeforstet (ehemalige Brandrodungsflächen)
- Hügelland 18,4% mit einer dem Landesdurchschnitt entsprechenden Nutzungsfläche (rund 20%)
- Schwemmlandebene 20,7% mit überdurchschnittlichem Nutzungsgrad (besonders hoher Anteil an Reis)
- Der Nassfeldanteil liegt 1970 im Durchschnitt bei 56%; im Hügelland und niedrigen Bergland bei > 50%, im höheren Bergland (innerhalb der engen Täler) bei <30%
- Der Anteil der Bewässerungsfläche an der Nassfeldfläche ist von 1961 54,6% auf 1990 73,4% gestiegen
- Bis auf Kyonggi und Kangwon sind Doppelernten möglich (Wintergerste und Winterweizen). Im Süden des Landes beträgt die Doppelnutzung über 50% Abschottung des Naktong-gang-Beckens durch die Sobaek-Kette (+ Fön von Norden ins Becken) und an der Süd- und Südostküste streift der (warme) TsushimaStrom Korea
- In Cholla, Kyungsang und Cungnam liegen 90% der Naßfelder Südkoreas
- Cholla ist stark von der Landwirtschaft abhängig
- Im Umland der großen Metropolen ist Gemüseanbau verbreitet
- Im Bergland, besonders Kangwon werden ein Großteil der Kartoffeln des Landes angebaut
- Haupt-Reisanbau-Regionen in Südwest-Korea an den Mittel- und Unterläufen der Flüsse „Han, Kum, Mangjong, Tonjin, Yongsan, und Naktong“ (Suh (2000) S.164)
- Gerste wegen geringerer Nachfrage seit 70ern nur noch v.a. in den Küstengebieten der Cholla-Provinzen
- Mais wurde reduziert wegen Billigimporten aus USA, wird vor allem in den intermontanen Gebieten der Kangwon-Provinz angebaut Abb. 165
- Kartoffel: Bergland von Kangwon und Cheju (hat milde Winter). Auf Cheju substituiert die Süßkartoffel den Reis, der Boden der Vulkaninsel lässt Nassreisanbau kaum zu
- GEMÜSE: Bis in die 60er Jahre hauptsächlich Kohl und Rettich (für Kimchi), außer Gartenkulturen für die größeren Städte nur Produktion für lokalen Verbrauch. Ab den 70ern mit Ausbau der Transportmöglichkeiten vielfältiger und nicht mehr auf Umfeld der Städte beschränkt
- Kohl und Rettich (mögen niedrige Temperaturen): Frühling in den Küstengebieten Südwestkoreas, Sommer im Bergland (Kangwon), bis zur demilitarisierten Zone nach Norden im Oktober àlandesweite saisonale Versorgung. Selbes Schema für Gurken und Tomaten. Gewächshaus-Anbau ist kapitalintensiv und findet um die größeren Städte statt - allerdings sporadische Ausweitung zu Räumen mit jeweils besseren natürlichen Bedingungen (wie z.B. die Kimhae-Ebene)
- OBST: Apfel(nördlich zentral in Nord-Kyongsan) und Mandarine (Cheju) dominieren, aber viele Arten von Früchten werden produziert
- TIERPRODUKTION: Kühe gab es früher überall außer auf dem Kaema-Plateau (Nordkorea), allerdings mehr im Süden, weil dort durch den Reisanbau größerer Bedarf an „Zugbullen“ war , heute sind >50% aller aufgezogenen Kühe auf SüdCholla, Süd- und Nord-Kyongsang konzentriert. ª 45% aller Milchkühe sind um Seoul zentriert (in direkter Nähe zum Konsumenten)
- Seidenraupenzucht ist lange ein wichtiger Nebenjob für Frauen gewesen, nach der Unabhängigkeit war Korea der drittgrößte Rohseideproduzent. Relativ schlagartiges Ende in den 70ern durch Arbeitskräftemangel und zu starke Konkurrenz zum Beispiel aus China
Lw. Regionen sind diagonal von Südwest nach Nordost ausgerichtet ( à Naß-, Misch- und Trockenfeldbau), was vom klimatischen und topographischen Muster des Landes stammt
- Nassfeldgebiete (bei >60% naß): zwar hohe Produktivität, aber auch kleinere Flächen
- Trockenfeldbau (bei >60% trocken): Anbau variiert stark mit den klimatischen Verhältnissen. Trend zur Tierzucht, Spezialkulturen
- Landwirtschaftlich gemischte Region: Bergregionen und Ostküste, statt Gerste u.a. jetzt vermehrt kommerzielle Arten wie Gemüse, Früchte und Spezialkulturen
- Kommerzielle landwirtschaftliche Mischregion: hat sich seit den 60ern mit der Wucherung der Hauptstadt um Seoul gebildet
- Hochkommerzialisierte, kapitalintensive Landwirtschaft
- Beinhaltet Gartenkulturen Milchwirtschaft, Tierzucht, Reiskultivierung
- Andere:
- Hochplaeau-Landwirtschaft: (Kaema) mit kaum mehr als Kartoffeln und Hafer
- Insel-Landwirtschaft: warmes Klima, bergiges Terrain, hohe Bevölkerungsdichte, LW beschränkt auf einen Mix aus kleinflächiger Kultivierung von Reis mit Trockenfeldbau und Tierzucht ⇒ siehe dazu Abbildung 5
II Geschichtliche Voraussetzungen
Vier Rahmenbedingungen in der Geschichte für die Landwirtschaft:
1. Kleinräumiger, vorwiegend gebirgiger Naturraum mit heißen, feuchttropischen Sommern und sehr kalten Wintern
2. Hohe Abgabenpflicht (fi kein Anreiz zur Ausweitung der Produktion, teilweise sind 50% der Ernte abzuführen)
3. Ausgeprägte örtliche Begrenzung des Aktionsraumes der Bauern mit geringer Mobilität
4. Hohes Maß an innerer Autonomie (z.B. Bewässerung auf Dorfebene geregelt)
- Dorfgemeinschaft geprägt durch hohes Maß an Gemeinschaft und Gerechtigkeit, das Leben innerhalb des Dorfes bestand aus Selbstversorgung, Handwerk, Tribut
- Landbesitz wurde mit den Japanern in der Kolonialzeit eingeführt, vorher gehörte alles Land bis auf Ausnahmen dem König.
- Mit dem Einmarsch der Japaner ging die Macht des Feudalismus in Bezug auf Landbesitz verloren ⇒ die feudale Hierarchie in den Dörfern verschwand
- Während der Kolonialzeit Produktivitätssteigerungen durch ausgebaute Bewässerung und Einführung von Düngermittel für Reis
- Mit der japanischen Besetzung wurde die vormals noch mittelalterliche Landwirtschaft in eine koloniale, die ausgebeutet werden konnte, umgewandelt: Versorgungsbasis für Japan bei Lebensmitteln, Rohbaumwolle und kommerziellen Obsten
- Resultat war eine einseitige Ausrichtung auf Reis für Japan, die landwirtschaftliche Struktur entsprach den Bedürfnissen Japans
- In den 30er Jahren wurden Æ 40% der koreanischen Reisproduktion nach Japan exportiert
- Über 80% der Bauern waren kleine Landpächter
III Landreform
- In Nordkorea gab es bereits 1946 eine Landreform, allerdings ohne Entschädigungen
- Nur 40% der landwirtschaftlichen Nutzfläche wurden neu verteilt, 50% wurden von den Großgrundbesitzern vor 1950 in Erwartung der Landreform verkauft
- Nach der Landreform war Landbesitz nur für die Eigennutzung erlaubt, die Höchstgrenze lag bei 3 Jungbo (0,992 ha) und Pacht war verboten (trotzdem gab es bald wieder Pachtflächen)
- Die Entschädigung betrug 5x30% der Jahresernte (für die Bauern über 5 Jahre zu leisten, allerdings gab es in vielen Fällen, z.B. bedingt durch den Koreakrieg, Aufschub). Die ehemaligen Grundbesitzer bekamen allerdings nicht den Marktwert, sondern nur die niedrigen staatlichen Ankaufpreise ausbezahlt, so daß die 150% nicht erreicht wurden
- Landreform wurde 1949 beschlossen, 1950 begonnen, im Krieg unterbrochen und 1957 abgeschlossen
- Ehemalige Gutsbesitzer wurden nach dem II. Weltkrieg oft zu den späteren Industriellen, da sie über Kapital verfügten(hatten teilweise mit den Japanern zusammengearbeitet)
Zwar wurde mit der Landreform die Pacht abgeschafft, aber es gab dadurch keine wirkliche wirtschaftliche Verbesserung für die Bauern ⇒ siehe Abb. 6
IV Amerikanische Hilfen für Südkorea
- In der Kolonialzeit und auch danach konnte der Bedarf an Getreide in Südkorea nicht gedeckt werden. Heimkehrer nach dem II. WK, der Koreakrieg und Flüchtlinge aus dem Norden Koreas verschärften die Situation. Zwar hatten die USA bereits vor 1954 mit Getreide ausgeholfen, doch erst 1954 mit dem „Mutual Security Act“ und ab 1955 mit dem PL 480 (Public Law 480) konnte die Lage verbessert werden
- PL 480: Vertragliche Verpflichtung zur Abnahme, Export vom PL 480 - Getreide verboten
- PL 480 drückte die eigene Produktion und ließ genügend Spielraum für Korruption
- USA setzt 1948 Wahlen durch ⇒ Teilung Koreas beschleunigt, USA-loyale Regierung mit Kontinuitäten aus der Kolonialzeit in Polizei und Verwaltung (Leute, die bereits mit den Japanern zusammengearbeitet hatten, erhielten wieder Posten)
- Besonders in den 40ern und 50ern war die amerikanische Wirtschaftshilfe Instrument der US-Außenpolitik
- Wirtschaftspolitische Elemente der Regierung waren u.a. Zwangsankauf landwirtschaftlicher Produkte und Doppelpreissysteme, erhebliche Importe landwirtschaftlicher Produkte
- 1945 - 1973 sind 5,9% der US-Auslandshilfen nach Korea geflossen
- Von der US- und UNO-Hilfe flossen von 1956 bis 1966 nur 5% in die Landwirtschaft (Taiwan ~1/5)
- 1961 wurden schätzungsweise 95% des südkoreanischen Militärhaushaltes von den USA getragen
- 1957 kamen ~50% der Staatseinnahmen aus dem „Counterpart found“ der USA
- 1,7 Milliarden US $ bestanden aus landwirtschaftlichen Überschüssen der USA, für die vertraglicher Abnahmezwang bestand (das sind 31% der US-Hilfe, in Taiwan liegt der Anteil allerdings nur bei ¼ der Hilfen). Die Verkaufserlöse kamen der Staatskasse zugute
- Die US-Hilfen milderten die Lebensmittelknappheit für die Bevölkerung. Allerdings hatten sie auch negative Folgen: es gab keine Mitsprachemöglichkeit der Koreaner bei der Zusammensetzung; durch negativen Einfluß auf die Preisentwicklung wurde die Abwanderung in die Städte beschleunigt; Rückgang eigener Produktion und mittelbar dadurch Zerstörung des traditionellen Handwerks im ländlichen Gebiet (z.B. Baumwolle); die Selbstversorgung mit Lebensmitteln konnte nicht gesichert werden.
- Seit 1948 gab es staatlichen Zwangsankauf von landwirtschaftlichen Produkten
Entwicklung in den 50ern und 60ern:
- Zwar ging die Inflation zurück (geringe Lebensmittelpreise), aber auf Kosten der Landwirtschaft
- Nahrungsmittelhilfe behinderte die dauerhafte Sicherung der eigenen Lebensmittelversorgung
- Landflucht durch ungleiche Einkommensverteilung
- Kontrolle des Außenhandels durch die USA S. 153
- Auch bei guten Ernten wurde importiert (mit einem Exportverbot durch die USA)
- Zwangsankauf: Bauern versuchten teilweise erfolgreich, ihren Reis selbst zu vermarkten und den Ankäufen zu entgehen
- Importe ⇒ Preisdruck nach unten; Markteingriffe des Staates (Zwangsankauf) ⇒ Preisdruck nach unten
- Niedrigpreise ⇒ Niedriglöhne in der Industrie ⇒ Kapitalakkumulation für die Industrialisierung (+ Schuldendienst der verschuldeten Bauern)
- Das PL 480 - Programm ermöglichte es der Rhee-Regierung, die Landwirtschaft zu vernachlässigen. Park, Chung Hee (1961) stellt den Wendepunkt in Richtung Landwirtschaft dar, bedingt durch die Situation im Kalten Krieg wurde ein größeres Augenmerk auf Selbstversorgung (v.a. Reis) gelegt ⇒ Nationale Sicherheit, essentiell für fortgesetztes industrielles Wachstum
50er: Billige Lebensmittel ⇒ niedrige Löhne ⇒ Begünstigung der gewerblichen Arbeitgeber
Ende der 60er wird PL 480 eingestellt, stattdessen gibt es günstige amerikanische Kredite für (amerikanische) Agrarimporte
V Die Landwirtschaft zu Beginn der Industrialisierung
- Korea vor den 60ern landwirtschaftliche Gesellschaft „von kommunaler Natur“; tief gefärbt durch konfuzianische Werte. Homogene Gemeinschaft von Bauern ⇒ durch den mit der Industrialisierung einhergehenden Wertewandel in der Gesellschaft Dorfgemeinschaft eher heterogene, profitorientierte Gruppe (Suh(2000), S.153)
- Agrarpolitik ab Ende 60er:
- Ausweitung von Ackerland und Wasserversorgung
- Angebot von Spitzenertragssorten
- erhöhte Produktion von Produktionsmitteln wie z.B. Spritzmitteln, um Landwirtschaft zu mechanisieren und zu diversifizieren
- Hochpreis-Politik für Reis
- Erhöhtes Kreditangebot durch den Staat ...
- Die Hochpreispolitik für Reis, die die Landwirtschaft maßgeblich unterstützt, begann 1968
- Durch die Mechanisierung der größeren Betriebe fällt allerdings eine Nebenerwerbsquelle für die ärmeren Bauern weg
- 1970 sind nur 5% der landwirtschaftlichen Betriebe marktorientierte Betriebe (gemessen an den Verkaufserlösen), Subsistenz- und Semisubsistenzbetriebe machen mit 73% den größten Anteil aus, der Anteil der Submarginalbetriebe beträgt 20% (nach landwirtschaftlichen Einkommensgruppen)
- Ende der 70er werden nur 44% der landwirtschaftlichen Produktion vermarktet
- Politik ausgerichtet zuerst nur auf ein adäquates Angebot für die Stadtbevölkerung und dann ab ~1970 auf die Förderung der landwirtschaftlichen Produktion (z.B. im Gegensatz zu vorher gab es nur Getreideimporte, wenn Nachfrage > Angebot)
- 70er: Düngerpreise wurden niedriggehalten, Reispreise gestützt siehe Abb. 7
- Am Ende der 60er wurde die Kluft zwischen Land- und Stadteinkommen als Bedrohung für die Entwicklungsstrategie Südkoreas angesehen
- Die exzessive Migration bedroht die politische Stabilität im Land
- Die Landwirtschaft wurde vom Staat unterstützt, um der wachsenden Abhängigkeit von Importen zu begegnen
- Seit Mitte der 60er sind die Löhne in der Landwirtschaft gestiegen ⇒ Nachteil für größere Betriebe, die auf Landarbeiter angewiesen waren
- Eigene Düngerproduktion wurde in den 60ern aufgenommen (nur Nordkorea hatte hierfür Fabriken nach dem II. WK), in den 70ern Selbstversorgung erreicht.
- Genossenschaften-Netzwerk (heute etwa 1,5 Tsd.) wurde als der Arm der Regierung auf dem Land aufgebaut
- Trotz Viehhaltung und Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produkte ist das Einkommen stark abhängig vom Reis
- Im ersten Fünfjahresplan 1962-66 Erlass der Wucherschulden bei Bauern und Fischern
- Trotz Auslaufen der PL 480 in den 60ern ging Selbstversorgungsgrad zurück
- Dritter Fünfjahresplan 1972-76 Investitionen eher in Verschönerung der Dörfer als in Produktionsmittel geflossen
- Anteil für die Landwirtschaft an staatlichen Investitionen:
1962-66 10,2%,
1967-71 7,1%,
1972-76 9%,
1977-81 15,1%
60er: Importe ⇒ Dumpingpreise in der Landwirtschaft ⇒ niedrige Lebenshaltungskosten für die Exportwirtschaft
- Es gab lange keine genügende Abstimmung zwischen inländischer Produktion und Importmengen ⇒ Importschwankungen, Preisschwankungen und Preisverfall
- Importe: 1) lösen starke Preisschwankungen aus, 2) Gewinne für die Regierung beim Weiterverkauf, 3) Markt für die koreanischen Bauern wird „kaputtgemacht“
V.1 Die Grüne Revolution
- Forschung nach verbesserten Reissorten ab 1965 in Zusammenarbeit mit dem IRRI auf den Philippinen (International Rice Research Institute)
- 1971 Einführung von Tongil (= Vereinigung) aus einer 3xKreuzung von Japonica und Indica-Reissorten. Im Laufe der 70er weitere Hybridreissorten wie z.B. Yushin, die den unvorteilhaften Geschmack der ersten Züchtung ausglich. Mit den neuen Reissorten konnte Mitte der 70er die Selbstversorgung in Reis erreicht werden und 1977 brauchte kein Reis-Gerste-Gemisch mehr vermarktet werden
- Mit Tongil sind die Reiserträge gestiegen: 72-77 waren die Erträge 20 bis 30% höher als bei traditionellen Reissorten
- Tongil reagiert auf hohe Düngermengen, besonders hohe Erträge bei guter Witterung, besonders anfällig für schlechte Witterung, hoher Spritzmitteleinsatz nötig
- Klein- und Pachtbauern wurden bei der Beratung und Einführung vernachlässigt
- Bereits 1977 wurden 54% der Reisfelder mit neuen Sorten bebaut
- 1980 gab es 40% Ertragseinbußen bei Tongil ⇒ 1981 ging die vom Staat hochgepuschte Anbaufläche von 70% auf 41% zurück
- Düngermitteleinsatz mit der „Grünen Revolution“ stark gestiegen: N/ha (Stickstoff) von 1972 210 kg auf 1980 auf 300 kg angewachsen
- Durch die hohen Mengen an Chemie (z.B. DDT) kam es allerdings auch zu Todesfällen bei Bauern und Verbrauchern
V.2 Saemaul Undong (Neues Dorf-Bewegung)
- Mobilisierung der ländlichen Bevölkerung, Steigerung der Innovationsbereitschaft - Schulung der örtlichen Dorfleiter
- 6400 hauptberufliche Berater
- psychologischer Druck, z.B. an allen Betrieben, die Tongil anbauen, waren gelbe Fähnchen angebracht
- besserer Zugang größerer Betriebe zu Beratung und v.a. Krediten (sollten den kleineren Betrieben als Beispiel dienen)
- Finanzierung der Saemaul-Undong stammt zu 79,4% aus der Landbevölkerung, zu 9,4% aus Krediten und zu 11,3% aus der Staatskasse
- Die Saemaul-Fabriken hatten zwar einen Beschäftigungseffekt, eine wirkliche Dezentralisierung der außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplätze und Einkommenserhöhungen in der ländlichen Bevölkerung blieben aus. Bis Mitte der 80er Jahre waren mehr als die Hälfte der Fabriken wieder geschlossen. Die Fabriken liegen besonders im Umkreis großer Städte und zeichnen sich oft durch geringe Größe und Kapitalausstattung aus
- Mit Saemaul Undong starker Schub für landwirtschaftliche Einkünfte, Gebäudemodernisierung u. a.. Gleichzeitig beginnt der traditionelle Charakter der Dörfer zu verschwinden
- Westliche Häuser mit Ziegeldächern und Drainagesystem, effiziente Versorgungsstraßen, rearrangierte Landstücke, modernes Vertriebssystem
VI Die Entwicklung bis 1990
- Industrialisierung hat sich auf große Städte konzentriert. Starke
Einkommensdisparitäten zwischen Stadt und Land ⇒ Migration in die großen Städte
- Zwischen 1965 und 1990 liegt die Wachstumsrate des landwirtschaftlichen Einkommens bei 13,6%, die des nicht-landwirtschaftlichen Einkommens bei 17,6%
- Die ländliche Gemeinde, die traditionell das Zentrum der Aktivitäten der Menschen war, wurde von der Industrialisierung ausgenommen
- Sinkende ländliche Population
- Diversifizierung der ländlichen Einnahmequellen
- Umorganisation und Verfall der traditionellen Dorfgemeinschaften
- Landwirtschaft im Familienverband, basierend auf familiären Arbeitskräften, wird durch Mechanisierung abgelöst
- Errichtung von „rural industrial parks „ für mehr Arbeitsplätze auf dem Land
- Beruf des Bauern unpopulär bei den potentiellen Hoferben
- Ziele in der Agrarpolitik:
- Wettbewerbsfähigkeit stärken
- Stabile Versorgung mir den wichtigsten Lebensmitteln
- Angemessenes Einkommen, da die Städte keine 6 Mio Menschen aufnehmen können
- Sowie langfristig Umweltschutz und evtl. zukünftige Lebensmittelversorgung ganz Koreas
- Durch die Selbstversorgung der ländlichen Haushalte bestand lange bzw. besteht noch eine sehr vielseitige Anbaustruktur in den Betrieben (Ende der 70er wurden nur 44% der landwirtschaftlichen Produktion vermarktet)
- Die koreanischen Essgewohnheiten verändern sich: so wurde der Kalorienbedarf 1970 nach zu ¾, 1990 nur noch zu 60% durch Getreide gedeckt fisiehe Abb. 8
- Die Industrialisierung wird begleitet von
- Gestiegenem Einkommen, breiterem Spektrum an konsumierten Lebensmitteln
- Wachstum im Konsum bei Weizen, Gemüse, Früchten, Fleisch und Molkereiprodukten
- Importe nehmen an Bedeutung zu
- Reis hat seinen wichtigen Stellenwert in Produktion und Konsum behalten
- Selbstversorgungsgrad 1961 91,4%, danach stark fallend fisiehe Abb. 9 Marktorientierung:
- Chinakohl und Rettich (für Kimchi) werden traditionell im Herbst geerntet. Neue Standorte lassen auch Ernten im Frühjahr (im Süden Koreas) und Sommer (in den Bergregionen) zu
- Gemüse wie z.B. Gurken, Tomaten und Salat werden ~ ab 1970 in Gewächshäusern aus Vinylfolie angebaut, so daß im Süden Koreas auch im Winter angebaut werden kann (im Norden nur in beheizten Gewächshäusern) - Gemüseanbau im Süden hat in den 70er Jahren besonders starke Ausdehnung an den Autobahnen (Marktorientierung in Richtung Seoul)
- An der Südküste kann noch vor dem Reisumsetzen Frühgemüse unter Vinylfolie angebaut werden ⇒ mit der Autobahn Seoul - Pusan wird die westlich von Pusan gelegene, verkehrsmäßig gut erschlossene Kimhae-Ebene in den 70ern das bedeutendste Gemüseanbaugebiet Koreas (Versorgung Seouls im Frühjahr, Pusan im Herbst). Teilweise wird kein Reis mehr angebaut, weil auch im Sommer Gemüse lukrativer ist
- Der lukrative Tabak- und Ginsenganbau steht unter staatlichem Monopol
- Umland um Seoul und größere Städte sowie auch Autobahnanbindung stellen ab den 70er Jahren Aktivräume dar (verstärkte Markorientierung der Landwirtschaft sowie Nebenerwerbsmöglichkeiten). Hinzu kommt Fischerei und Algenzucht als Nebenerwerbsmöglichkeit. Die Polarisierung zu peripheren Gebieten kann nur schwer überwunden werden
- Anbau von Weizen (abgesehen von Futtergetreide) wurde praktisch eingestellt, während Import und Konsum stiegen
- Rindfleischproduktion im größeren Stil wurde zu Beginn rein industriell betrieben. Die intensive Flächennutzung ließ die weniger ertragreiche Tierproduktion in großem Maße vorher nicht zu. Mittlerweile ist eine Ausdehnung in den höheren Lagen von Cheju-do und in Kangwon-do zu beobachten. Viehproduktion in großen Unternehmen konzentriert: vertikal integriert mit Futtergetreideimporteuren innerhalb der „chaebol“
- Die preisliche Unterstützung für landwirtschaftliche Produkte belastet einerseits die ärmeren Schichten der Stadtbevölkerung, bevorzugt andererseits größere Betriebe (da der vermarktete Anteil der Ernte bei kleineren Betrieben besonders klein war) - Die Differenz zwischen An- und Verkaufspreisen (Doppelpreispolitik), Transport- und Lagerungskosten sowie die Subventionierung für Dünger wurde bis 1983 aus Darlehen des Grain Management Found finanziert, die die Geldmenge und damit die Inflation hochtrieben. Daher ab 1984 Finanzierung direkt aus dem Staatsbudget - Gezielter Reiskauf der Sorte Tongil (bis 1988), wurde aber größtenteils fallengelassen wegen seiner Anfälligkeit für Schädlinge und dem Widerstand der Konsumenten
- Die Intervention in den Reismarkt führte zu wachsenden Kosten und unverkaufbaren Reisbergen ⇒ wie in Japan teure und ineffiziente Form der Unterstützung der Landwirtschaft
- Ankaufspolitik des Staates diente in den 50er Jahren der Versorgung von Polizisten, Soldaten und Beamten, in den 60ern der Regulierung des Marktes und erst in den 70ern der Subventionierung der Landwirtschaft
- Dass die Subventionierung der Landwirtschaft in den 80ern noch lange nicht den heutigen Grad erreicht hatte, zeigen z.B. die Düngerpreise von 1981, die 68% über dem Weltmarktpreis lagen (staatliches Handelsmonopol)
- 1966 waren 16% Pachtland, 1990 bereits 43%
- 1985 hatten 63% der landwirtschaftlichen Haushalte Pachtland
- 1986 wurde das Gesetz der Realität angepasst, indem Pacht erlaubt wurde. Der Landbesitz war aber offiziell immer noch nur landwirtschaftlichen Haushalten erlaubt
- Industrialisierung auf dem Land wurde mit den Saemaul-Fabriken von staatlicher Seite versucht, hatte aber wenig Einfluß auf Erwerbsmöglichkeiten und Einkommen, nur die Hälfte der Fabriken überlebte bis in die 80er Jahre (v.a. um Seoul und Pusan). Ein neues Programm 1984 war erfolgreicher, weil es besser geplant war und komparative Vorteile genutzt werden konnten (Niedriglohn)
- Um in der Industrie zu arbeiten, muß das Dorf trotzdem meist verlassen werden.
- Aus den USA kommt der Hauptteil der Getreideimporte und die Hälfte der Tierprodukte (80er Jahre)
- Die landwirtschaftlichen Exporte sind unbedeutend: betrugen sie 1965 noch 25% an den Gesamtexporten, sind es 1983 nur noch 4,2% (größtenteils Fischprodukte)
- Mechanisierung: in den 60ern Dreschmaschinen und Wasserpumpen, in den 70ern kleine landwirtschaftliche Geräte, z.B. Pflüge für die Nassreisfelder, um die Zugtiere zu ersetzen, in den 80ern Pflanzmaschinen (für Reis), Erntemaschinen, Trecker.
- 1983 konnten 94% der Betriebe < 1 ha ihre laufenden Haushaltskosten nicht mehr durch Einkommen aus der Landwirtschaft decken
- 1981 waren die Produktionskosten für Reis am niedrigsten in 1-2 ha - Betrieben
- Trotz hoher Abwanderung gibt es nur einen schwachen Trend zu größeren
Betrieben, da oft Teile der Familie abwandern und lediglich der Haushalt kleiner wird
- Arbeitskräfte im produktivsten Alter wandern ab, Arbeitslohn steigt, gepaart mit Arbeitskräftemangel und Überalterung
- Durch hohe Bodenpreise und Arbeitslöhne werden größere Betriebe behindert, die kleineren Betriebe, in denen Arbeitskraft proportional zur Fläche genügend vorhanden ist, pachten (z.B. von ehemaligen Dorfbewohnern, Verwandten)
- Durch Arbeitskräftemangel und die Öffnung des inländischen Marktes wurde Koreas Fähigkeit, auf dem Gebiet der Landwirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben, geschwächt
- Durch Schulden oder weil der Sohn den Hof nicht übernehmen will, werden viele Höfe verlassen und die auf dem Land vorhandene Infrastruktur wird durch fehlende Kaufkraft geschwächt
- Um die Knappheit an heiratswilligen Frauen zu mildern, wurden Ende der 80er koreanischstämmige Frauen aus China angeworben (wurde nach einigen missglückten Heiraten wieder aufgegeben
VII Die Ergebnisse der Uruguay-Runde
Von 1 854 landwirtschaftlichen Gütern waren 1 569 vor dem Ende der Uruguay-Runde 1993 bereits liberalisiert (Rest 285 mit Importbeschränkungen)
- Uruguay-Runde nach mehreren Jahren der Verhandlungen im Dezember 1993 beendet
- Reduzierung der Zölle um 24% bis 2004 (dank dem Status als Entwicklungsland, sonst wären es 36% gewesen)
- Reis, für den eine Importquote bestehen bleibt, soll 2004 weiterverhandelt werden - Die mengenmäßigen Importbeschränkungen durch Quoten oder Lizenzen, die 1993 für 220 landwirtschaftliche Produkte bestanden haben, werden nach und nach aufgehoben
- Importe sind spätestens ab 2004 nicht mehr verstaatlicht (außer Reis)
- Umsetzung der Ergebnisse der Uruguay-Runde 1994: Korea hat Status als „developing country“: entspricht 5 Jahren Übergangszeit für mengenmäßige Importrestriktionen (außer Reis)
- Landwirtschaftliche Subventionen müssen von 1995 bis 2005 um 13% gekürzt werden
- Importe sind in die Jahreszeiten gelegt, in denen nicht produziert wird
- Die mit den Importen gemachten staatlichen Gewinne sollen in Fonds für ländliche Projekte fließen (1997 Einnahmen von 420 Mio US $)
- Reis: die Mindestimportmenge (5%) wird nur durch besonders niedrige Qualität erfüllt ⇒ keine wirkliche Konkurrenz für die inländische Landwirtschaft weil zur Tierfütterung verwendet
VIII Die Entwicklung ab 1990
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Source: MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry. 1998
Farm and urban households income
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Source : MAF, Statistical Yearbook of Agriculture and Forestry(1998) and MAI(1998) - aus: - www.maf.go.kr
- Agrarpolitik in der Zwickmühle zwischen a) sich internationalen Vorgaben fügen mit Rücksicht auf die Industrieexporte, b) Verbesserung der ländlichen Verhältnisse, Sicherheit und Selbstversorgung bei Lebensmitteln
- Die Landwirtschaft verursacht ansteigende Kosten für Staat und Konsumenten, weil die strukturelle Anpassung an die neuen Umstände nicht im nötigen Maß erfolgten ⇒ in den 90ern hat Korea eines der höchsten Levels an Protektion in der Welt
- Mit der Uruguay-Runde im Rahmen von GATT musste das Augenmerk auf die Probleme der Landwirtschaft gelegt werden: hohe Kosten - geringe Betriebsgröße - Die Agrarpolitik Anfang der 90er Jahre hat in Erwartung der GATT-Verhandlungen eine wachsende Betriebsgröße, Mechanisierung und Kommerzialisierung zum Ziel. 1994 wird eine Steuer für ländliche Entwicklung eingeführt. Richtungswechsel der Agrarpolitik weg von der bürokratischen Marktintervention hin zu durchschaubaren und in der Bevölkerung akzeptierten Unterstützungsprogrammen - Die Uruguay-Runde hat begrenzten Effekt, ist aber Katalysator für Systemreformen - Am 9. Dezember 1993 entschuldigt sich Präsident Kim Young Sam, das Versprechen gebrochen zu haben, keine Reisimporte zuzulassen
- ~ 80% der e der 90er Subjekt von Preis- und Einkommenspolitik
- Im Durchschnitt liegt der Preis landwirtschaftlicher Produkte 3x so hoch wie der Weltmarktpreis
- Ohne Protektion wären die Konsumentenpreise für Lebensmittel um 67% niedriger
- Die 1-2 ha-Betriebe stellen trotz Abwanderung immer noch die Regel dar, obwohl bei dieser Größe das maschinelle Equipment nicht voll ausgenutzt werden kann, da (besonders das an Autobahnen und in Stadtnähe gelegenen) Land Spekulationsobjekt geworden ist und daher zu teuer für Landwirte
- Anfang der 90er ließen sich etwa die Hälfte der Betriebe das pflügen und/oder Reis pflanzen machen 1992 wurden landwirtschaftliche Förderungszonen (etwa 50% der landwirtschaftlichen Nutzfläche) eingerichtet, in denen die 3-ha-Grenze aufgehoben und kooperativer (genossenschaftlicher) Landbesitz erlaubt wurde. Daneben wurde Kapital für Infrastruktur, Mechanisierung und Flurbereinigung zu Verfügung gestellt
- Erbe vorhanden? 1980 43%, 1990 16%.
- Bei einer Umfrage in den 90er Jahren sagten ¾ der befragten Bauern, daß die Kinder den Betrieb nicht übernehmen werden. (In Kyongbuk lag der Anteil sogar bei 80%, weil das dort angebaute Obst in Wettbewerb mit Importen gerät. In Kyonggi mit seiner diversifizierten Landwirtschaft lag diese Prognose nur bei 65%)
- Die Wettbewerbsposition der koreanischen Landwirtschaft wird gestärkt durch
1) Abschottung gegen billigere Importe neben Zöllen durch Importquoten und Importlizenzen und 2) verringerte Produktionskosten, indem z.B. der Dünger subventioniert wird
Unterstützung betrifft:
1. Produktionsmittel (landwirtschaftliche Kredite, Dünger, Pestizide etc.)
2. Bodenverbesserung, Weiterverarbeitung, Vermarktung)
3. Forschung und Bildung
4. Einkommenskompensierung durch Schuldenerleichterung, bei Kosten für Bildung, Katastrophenhilfen
- Staatsausgaben lagen 1997 für die Landwirtschaft bei 11% (BSP 5%). Doppelt so hohe Förderung der Landwirtschaft wie im Durchschnitt der OECD-Staaten
- 20-30% der Reisproduktion werden im Jahr aufgekauft
- Bis 1995 soll durch den Grain Management Account mittlerweile 11 Mia US$ Defizit entstanden sein (zu 88% durch Reis)
- Der Gersteankauf beträgt 70-80% der Produktion. Trotz fallenden Anbaumengen starke Protektion (früher wurde Reis mit Gerste gemischt, um den Reis zu verbilligen)
- Weizen wurde 1990 liberalisiert (kein Handelsmonopol des Staates bei Importen mehr), bereits 1984 wurde das Doppelpreissystem für Weizen aufgegeben. Durch die Importrestriktionen für Futtergerste kommt Futterweizen ein hoher Stellenwert zu
- Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt 1997 bei 1,3 ha. Allerdings dürfte die tatsächliche Zahl etwas höher liegen: - durch die alte Höchstgrenze von 3 ha z.B. Verteilung des Landes auf mehrere Familienmitglieder, - Landbesitzer lassen die Felder bewirtschaften statt selbst das Land zu bestellen, - informelle Kauf- und Pacht-Abmachungen tauchen in der Statistik nicht auf, - informelle Vereinigungen
- 1996 wurde die 3 ha-Grenze vollkommen aufgehoben
- 60% der Betriebe liegen unter 1 ha, nur 5% über 3 ha
- Nebenerwerbslandwirtschaft hat im Laufe der Zeit stark zugenommen: Waren es 1960 noch 90% Vollzeitbetriebe, so sank die Zahl 1995 auf 40%
- Boden und Arbeit sind zwar knapp, aber der Dünger- und Chemieeinsatz sind hoch, ⇒ Umweltschäden
- Eine Entwicklung mit der Tendenz in Richtung kleine Nebenerwerbsbetriebe vs. Größere kommerzielle Betriebe beginnt zaghaft
- 1998 nach der „IWF-Krise“ Ausgaben des Staates für Landwirtschaft um 2,2% gesenkt gegenüber 1997, um 8,4% niedriger als ursprünglich geplant - 1998 arbeitslos gewordene Stadtbewohner sind teilweise in ihre Dörfer zurückgekehrt, da nur minimales soziales Netz vorhanden
- Mit der Abwertung des Won sind Importe teurer geworden ⇒ Sicherheit für die Lebensmittelversorgung des Landes ist weiter in das Blickfeld gerückt - Die Hungerkatastrophe in Nordkorea in den 90ern hat das Bedürfnis nach Selbstversorgung, z.B. bei Reis, verstärkt
- Mechanisierung und Industrialisierung wirken der Knappheit an Arbeitskräften entgegen; seit 1990 gibt es einen Push in der Mechanisierung mit aktiver Rolle der Regierung
- Reisverpflanzer 1 von 8 Haushalte 1990, 1/5 Haushalte 1995 Arbeitfl, Boden¤ (stagnierende Investitionen), Kapital› (siehe Abb. 17)
- Seit Ende der 80er Jahre hat die Regierung angeboten, die für die Bauern problematischen privaten Schulden in staatliche umzuwandeln. Trotzdem sind die Schulden pro landwirtschaftlichem Haushalt weiter gestiegen. Zwischen 1985 und 1997 hat sich das Einkommen vervierfacht, die Schulden sind aber mittlerweile 6,5 mal so hoch.
Zusammengefasst:
- Spektakuläre Geschwindigkeit der industriellen Entwicklung und dadurch starke intersektorelle Arbeitskräftewanderung
- Wachsende Protektion und Unterstützung der Landwirtschaft
- Die typischen Mechanismen für die Unterstützung der Landwirtschaft in westlichen Industrieländern sind auch in Korea aufgetaucht (staatliche Transferzahlungen, Schutz vor Billigimporten etc.)
- Trotz der Unterstützung durch Regierung und Öffentlichkeit hat die Landwirtschaft keine Anziehungskraft für die junge Generation
- Der kleinflächige Reisanbau dominiert weiterhin die landwirtschaftliche Struktur und schränkt den Prozeß in Richtung Diversifizierung und Mechanisierung ein. Der Staat greift weiterhin in den Reismarkt ein
- Da Reis bei Produktion und Konsum weiterhin dominiert und alternative Einkommensquellen für Bauern begrenzt sind, war die Aussicht auf eine Freigabe des Reismarktes teilweise traumatisch für Korea. Widerstand gegen die USA u.a. in der Uruguay-Runde war unmöglich im Hinsicht auf die koreanische Industrie und die Sicherheitsbedürfnisse Südkoreas (gute Beziehungen zu den USA)
Beispieldörfer (alle drei peripher gelegen, Zahlen aus den 70er Jahren):
1. Kusugul (in Chung(chon)nam-do)stellt ein typisches Dorf der Alluvialebene dar. Fast 90 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden mit Nassreis bebaut, der zu fast ¾ vermarktet wird. Wintergerste und -weizen wird im Wechsel mit Gemüse, Hülsen- und Ölfrüchten (im Sommer) angebaut
2. Cungnim-ri (oberes Naktong-gang-Becken in Kyongsangbuk-do)ist ein typisches Dorf des Hügellandes. 45% der Anbaufläche werden für Nassreis genutzt und auch hier werden etwa 70% vermarktet. Wintergetreideanbau findet sowohl auf Naß- als auch auf Trockenflächen statt. Durch die zentrumsferne Lage gibt es keine Spezialisierung auf Gemüse, stattdessen Anbau von wildem Sesam, spanischem Pfeffer (getrocknet) und Maulbeerbüsche für die Seidenraupenzucht (mittlerweile nicht mehr wettbewerbsfähig)
3. Twikkol (Gebirgstal mit Streusiedlung in der Taebaek-Ebene in Kangwon-do) ist ein Dorf im höheren Bergland. Twikkol ist geprägt durch Selbstversorgung mit Mais, Kartoffeln und Hülsenfrüchten. Nur 1,4% der Nutzfläche ist mit Reis bebaut. Durch den vorteilhaften Erntetermin im Sommer (in dem es in anderen Landesteilen für Gemüse zu heiß ist) kann Gemüse (Weißkohl und Rettich) nach Seoul vermarktet werden, hierfür werden 1975 20% der Anbaufläche genutzt. Dadurch ist die Landwirtschaft entgegen der klimatisch schlechten Bedingungen noch relativ erfolgreich, trotz Aufforstung der Brandrodungsgebiete mit einer Hangneigung > 20° 1973. Einige Betriebe haben in den70er Jahren noch Tabakanbau und Seidenraupenzucht.
IX Fazit
- Der Entwicklungsstand der Regionen ist abhängig von den physisch- geographischen Bedingungen (agrare Tragfähigkeit) und der Verkehrserschließung bzw. der relativen Nähe zu größeren Städten.
- Betriebsgröße und Bildungsstand bestimmen zusätzlich die Innovationsfähigkeit und damit die Entwicklungschancen der Betriebe
Signifikanz der Landwirtschaft ist viel größer als ihr Teil an der Ökonomie gesehen im Lichte von: #Lebensmittelversorgung für ganz Korea #Erhaltung der Umwelt #Erhaltung der traditionellen Kultur
Entwicklung der bestimmenden Faktoren in der Landwirtschaft von natürlichen Faktoren und homogenen Räumen zu ö konomischen Faktoren und funktionellen Räumen (die sich ausdehnenden Gebiete um Seoul - hat in den 70ern angefangen und breitet sich immer weiter aus)
X Anhang
Anteil am landwirtschaftlichen Betriebsertrag:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dege (1980), Korea Statistical Yearbook (1998) für 1997
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Aus Dege (1982), Dege (1992) und Korea Statistical Yearbook (1998)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
Dege, Eckart (1982): Entwicklungsdisparitäten der Agrarregionen Südkoreas, Kiel. Dege, Eckart (1992): Korea. Eine landeskundliche Einführung, Kiel
Francks, Penelope (1999): Agriculture and Economic Development in East Asia, London und New York.
Kim, Hae-Soon (1990): Ländliche Entwicklung in Korea (Bielefelder Studien zur Entwicklungssoziologie; Bd. 47), Saarbrücken u.a.
Kim, In Hwan (1979): The Green Revolution in Korea - Development and Dissemination of New Rice Varieties, irgendwo in Korea publiziert.
Moreddu, Catherine (OECD Hrsg.)(1999): National Policies and Agricultural Trade - Review of Agricultural Policies in Korea, Paris.
Suh, Chan-Ki (2000): Rural Communities and Agriculture. In: The Organizing Committee of the 29th International Geographical Congress, South Korea (Hrsg.): Korea: The Land and People, Seoul.
Vincent, David P. und Lee, Honggue (1997): Benefits and Costs of Agriculture Liberalisation in Korea, Seoul.
Verzeichnis der Artikel
Choi, Jung-Sup und Sumner, Daniel A.: Opening Markets while Maintaining Protection: Tariff Rate Quotas in Korea and Japan. In: Agricultural and Recource Economics Review (Ithaca, NY), Vol. 29 No. 1 (April 2000), S. 91 - 102.
Chung, Heesun und Veeck, Gregory: Pessimism and pragmatism: agricultural trade liberalisation from the perspective of South Korean farmers. In: asia pacific viewpoint(Oxford, UK & Malden, MA(USA)), Vol. 40 No. 3 (December 1999),S. 271 - 284.
Engelhard, Karl und Park, Young-Han: Südkorea; Wasser, Lebensnerv für die wirtschaftliche Entwicklung. In: GR 42 Heft 11 (1990).
Jeon, Yoong-Deok und Kim, Young-Yong: Land Reform, Income Redistribution, and Agricultural Production in Korea. In: Economic Development and Cultural Change (Chicago), Vol. 48 No. 2 (January 2000), S. 253 - 268.
Kang, Suki: Structural Transformation of Agricultural System in Korea. In: Korea Observer (Seoul), Vol. XXIV No. 1 (Spring 1993), S. 91 - 110.
Min, Mal-Soon: The Rice-centric Korean Community on the Road to Industrialisation. In: Korea Observer (Seoul), Vol. XXIV No. 2 (Summer 1993), S. 193 - 206.
Verzeichnis der Statistiken
Korean Overseas Information Service (Hrsg.)(1990): A Handbook of Korea, Seoul.
Republik of Korea (ROK); National Bureau of Statistics and Economic Planning Board (Ed.)(1998): Korea Statistical Yearbook 1998, Seoul.
Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (1995): Länderbericht Korea, Republik, Stuttgart.
Internetseiten
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Das Dokument behandelt die Entwicklung der Landwirtschaft in Südkorea, beginnend mit den klimatischen und regionalen Gegebenheiten, über die historische Entwicklung, die Landreform, die Zeit der amerikanischen Hilfen, die Industrialisierung, die Saemaul Undong (Neues Dorf-Bewegung), die Auswirkungen der Uruguay-Runde bis hin zur Entwicklung nach 1990. Es analysiert die Agrarpolitik, die Rolle des Reisanbaus, die Veränderungen in den Essgewohnheiten, die Mechanisierung der Landwirtschaft und die Herausforderungen durch Importe und internationale Handelsabkommen.
Welche Rolle spielt das Klima in der südkoreanischen Landwirtschaft?
Das Klima Südkoreas, gekennzeichnet durch Regenzeiten, kalte Winter und maritime Einflüsse, beeinflusst stark die landwirtschaftliche Nutzung. Unterschiedliche Regionen weisen unterschiedliche Nutzungsgrade auf, wobei die Schwemmlandebenen besonders für den Reisanbau geeignet sind. Doppelernten sind in einigen Regionen möglich, und bestimmte Klimabedingungen fördern den Anbau spezifischer Kulturen wie Gemüse in Küstengebieten oder Kartoffeln im Bergland.
Was war die Bedeutung der Landreform in Südkorea?
Die Landreform zielte darauf ab, den Landbesitz gerechter zu verteilen und die feudale Hierarchie zu beseitigen. Allerdings brachte sie nicht sofortige wirtschaftliche Verbesserungen für alle Bauern. Ehemalige Gutsbesitzer wurden oft zu Industriellen, und es gab weiterhin Herausforderungen wie Pachtverhältnisse.
Welchen Einfluss hatten die amerikanischen Hilfen auf die südkoreanische Landwirtschaft?
Die amerikanischen Hilfen, insbesondere durch das PL 480 Programm, milderten die Lebensmittelknappheit, hatten aber auch negative Folgen. Sie führten zu einer Vernachlässigung der eigenen Produktion, beschleunigten die Abwanderung in die Städte und zerstörten traditionelles Handwerk im ländlichen Raum.
Was war die Saemaul Undong (Neues Dorf-Bewegung)?
Die Saemaul Undong war eine Bewegung zur Mobilisierung der ländlichen Bevölkerung, zur Steigerung der Innovationsbereitschaft und zur Modernisierung der Dörfer. Sie führte zu Verbesserungen in der Infrastruktur und den landwirtschaftlichen Einkünften, aber auch zum Verlust des traditionellen Charakters der Dörfer.
Wie hat die Industrialisierung die Landwirtschaft in Südkorea beeinflusst?
Die Industrialisierung führte zu einer Abwanderung der Landbevölkerung, Einkommensdisparitäten zwischen Stadt und Land, einer Diversifizierung der ländlichen Einnahmequellen und einer Mechanisierung der Landwirtschaft. Die traditionellen Dorfgemeinschaften verfielen, und der Beruf des Bauern wurde unpopulär.
Was waren die Auswirkungen der Uruguay-Runde auf die südkoreanische Landwirtschaft?
Die Uruguay-Runde führte zu einer Reduzierung der Zölle und zur Aufhebung mengenmäßiger Importbeschränkungen für viele landwirtschaftliche Produkte. Der Reisanbau wurde weiterhin durch Importquoten geschützt, aber die Liberalisierung des Handels stellte eine Herausforderung für die südkoreanische Landwirtschaft dar.
Welche Herausforderungen und Veränderungen gab es in der südkoreanischen Landwirtschaft nach 1990?
Nach 1990 sah sich die südkoreanische Landwirtschaft mit steigenden Kosten, geringen Betriebsgrößen und der Notwendigkeit einer strukturellen Anpassung an die neuen Umstände konfrontiert. Die Agrarpolitik zielte auf eine wachsende Betriebsgröße, Mechanisierung und Kommerzialisierung ab, aber der kleinflächige Reisanbau dominierte weiterhin die landwirtschaftliche Struktur.
Wie hat sich der Selbstversorgungsgrad in Südkorea entwickelt?
Der Selbstversorgungsgrad sank von 91,4% im Jahr 1961 stark ab, was auf die zunehmende Bedeutung von Importen zurückzuführen ist.
Welche Rolle spielt Reis in der koreanischen Landwirtschaft und Ernährung?
Reis hat trotz Veränderungen in den Essgewohnheiten seinen wichtigen Stellenwert in Produktion und Konsum behalten. Er ist weiterhin ein wichtiger Faktor für die Einkommen der Landwirte und die Lebensmittelversorgung des Landes.
- Citar trabajo
- Tina Dibberd (Autor), 2001, Landwirtschaft in Südkorea, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100564