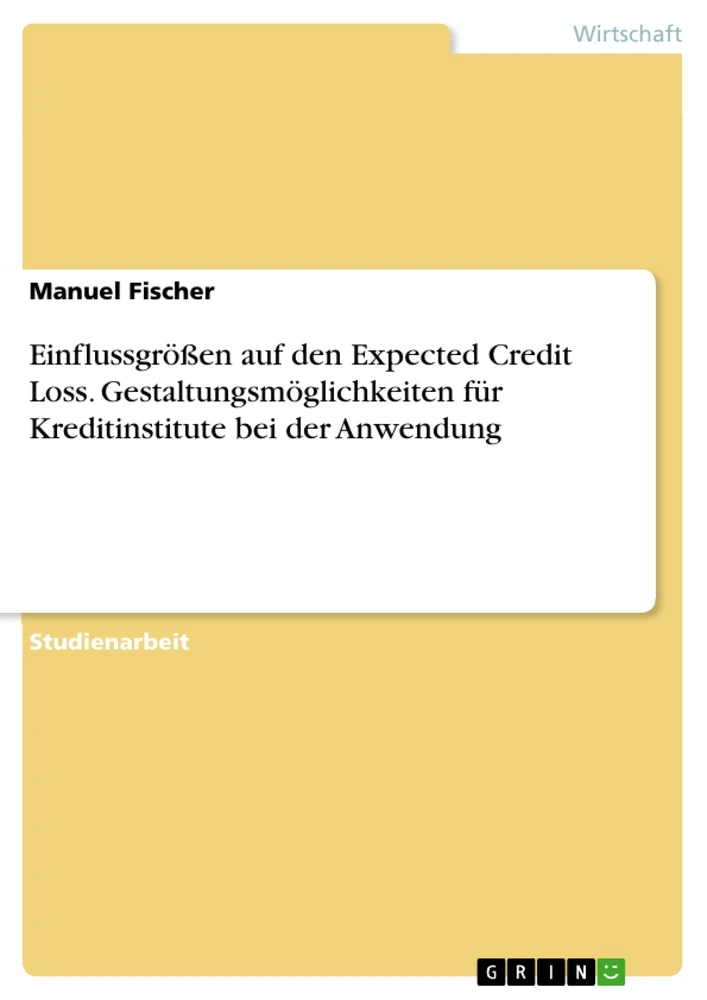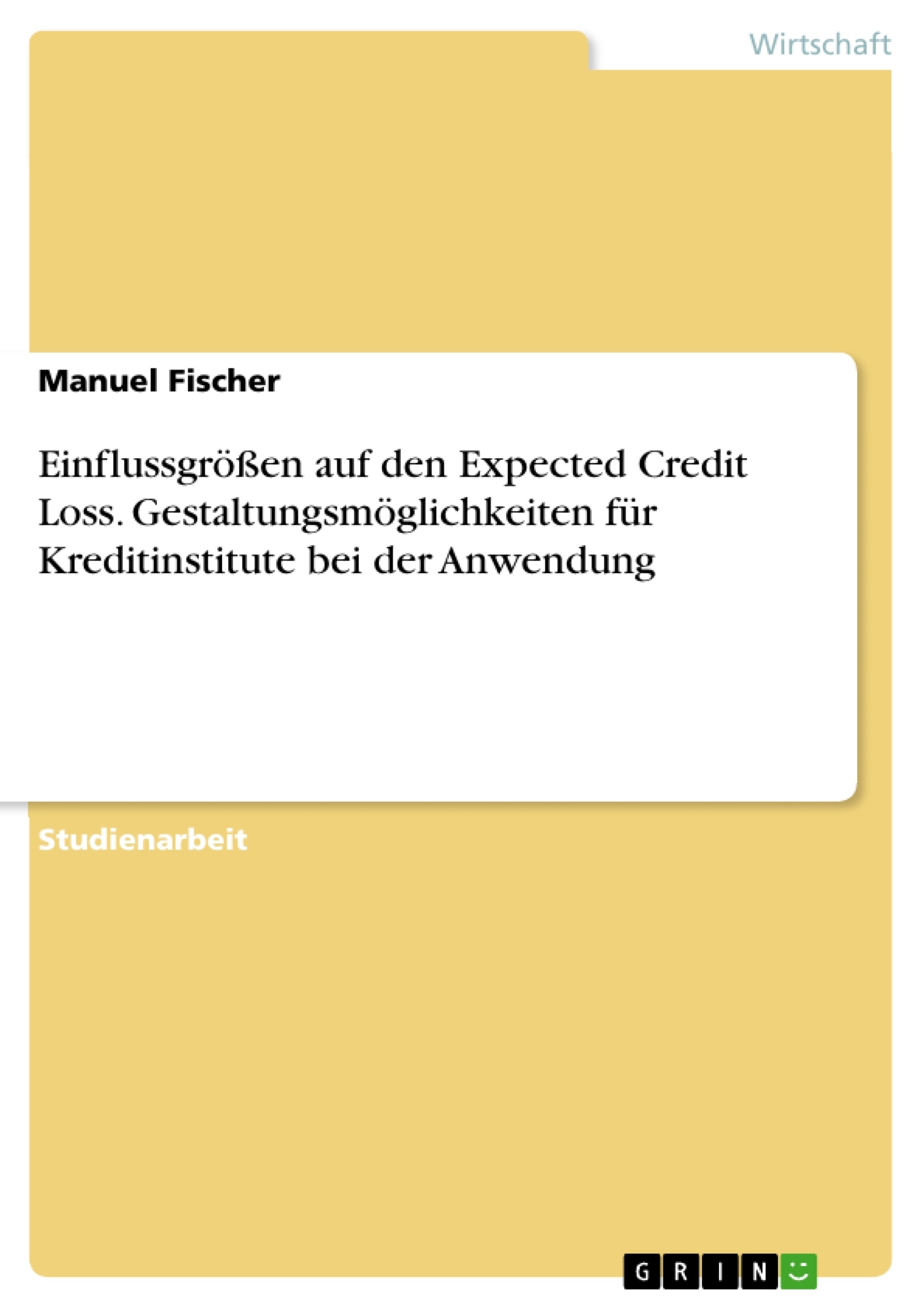Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit den Einflussgrößen des ECL-Modells. Das Themengebiet des Wertminderungsmodells des IFRS 9 genießt Aktualität, da die Erstanwendung erst ab 2018 verpflichtend erfolgte. Somit können praxisnahe Auswertungen der Einflussgrößen erst seit kurzem getätigt werden. Ziel dieser Seminararbeit ist die Darstellung der Gestaltungsmöglichkeiten für Kreditinstitute bei der Anwendung des ECL-Modells und die Bewertung möglicher Auswirkungen, die sich daraus ergeben.
Zu Beginn der Seminararbeit erfolgt ein Überblick über die Entstehungshistorie sowie die Anwendungsbereiche des IFRS 9. Zudem werden der Aufbau und die Berechnungsweise des ECL-Modells erläutert, um den Grundstein für die Untersuchungen zu legen. Im dritten Kapitel werden die einzelnen Einflussfaktoren des ECL-Modells aufgezeigt und hinsichtlich möglicher Gestaltungs- und Bewertungsspielräume analysiert. Anschließend werden die Auswirkungen der Gestaltungsmöglichkeiten für Kreditinstitute bei der Bewertung des ECL dargestellt. So werden die Folgen eines gering bzw. hoch geschätzten ECL aufgezeigt und die daraus resultierenden Vor- und Nach-teile aus unterschiedlichen Perspektiven erarbeitet. Abschließend wird ein begründetes Fazit gezogen, welches die Ergebnisse dieser Seminararbeit zusammenfasst und einen Ausblick auf mögliche Forschungsansätze für die Zukunft bietet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen des IFRS 9
- 2.1 Entstehung des Standards
- 2.2 Anwendungsbereich
- 2.3 Expected-Credit-Loss-Modell
- 3 Einflussgrößen auf den Expected Credit Loss
- 3.1 Probability of default
- 3.2 Loss given default
- 3.3 Exposure at default
- 4 Bewertung
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Einflussgrößen des Expected Credit Loss (ECL)-Modells im IFRS 9. Ziel ist die Darstellung der Gestaltungsspielräume für Kreditinstitute bei der Anwendung des ECL-Modells und die Bewertung der daraus resultierenden Auswirkungen. Die Arbeit untersucht die praktische Relevanz des Modells, da seine verpflichtende Anwendung erst seit 2018 besteht.
- Entstehung und Anwendungsbereich des IFRS 9
- Aufbau und Berechnungsweise des ECL-Modells
- Einzelne Einflussfaktoren des ECL-Modells und deren Gestaltungsspielräume
- Auswirkungen der Gestaltungsmöglichkeiten auf die ECL-Bewertung
- Bewertung möglicher Vor- und Nachteile verschiedener ECL-Schätzungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den Hintergrund der Seminararbeit vor dem Kontext der Finanzmarktkrise und der damit verbundenen Kritik am vorherigen Incurred-Loss-Modell. Sie beschreibt die Notwendigkeit des IFRS 9 und seines ECL-Modells und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Gestaltungsmöglichkeiten für Kreditinstitute und der Analyse der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Bewertung von Finanzinstrumenten.
2 Theoretische Grundlagen des IFRS 9: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Entstehung des IFRS 9 als Reaktion auf die Kritik am IAS 39 und dessen Incurred-Loss-Modell. Es beschreibt detailliert den Anwendungsbereich des IFRS 9 und erklärt den Aufbau und die Berechnungsweise des ECL-Modells. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich zwischen dem alten und neuen Modell, unterstreicht die zukunftsorientierte Ausrichtung des ECL-Modells und hebt die Bedeutung der Berücksichtigung von vergangenen Ereignissen, aktuellen Zuständen und Prognosen hervor.
3 Einflussgrößen auf den Expected Credit Loss: Dieses Kapitel analysiert die einzelnen Einflussfaktoren des ECL-Modells: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) und Exposure at Default (EAD). Für jeden Faktor werden die jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten und Bewertungsspielräume detailliert untersucht. Der Text beleuchtet, wie die Schätzung dieser Faktoren die Höhe des ECL beeinflusst und welche Konsequenzen sich daraus für Kreditinstitute ergeben können. Die Interdependenzen zwischen den einzelnen Einflussgrößen werden hervorgehoben, um ein ganzheitliches Bild der ECL-Berechnung zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Expected Credit Loss (ECL), IFRS 9, Incurred-Loss-Modell, Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD), Finanzmarktkrise, Kreditrisiko, Risikovorsorge, Bewertung von Finanzinstrumenten, Kreditinstitute, Gestaltungsspielräume.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: "Einflussgrößen des Expected Credit Loss (ECL)-Modells im IFRS 9"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Einflussgrößen des Expected Credit Loss (ECL)-Modells im IFRS 9. Sie untersucht die Gestaltungsspielräume für Kreditinstitute bei der Anwendung des ECL-Modells und bewertet die daraus resultierenden Auswirkungen. Die Arbeit konzentriert sich auf die praktische Relevanz des Modells, da dessen verpflichtende Anwendung erst seit 2018 besteht.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Entstehung und Anwendungsbereich des IFRS 9, Aufbau und Berechnungsweise des ECL-Modells, die einzelnen Einflussfaktoren des ECL-Modells (Probability of Default, Loss Given Default, Exposure at Default) und deren Gestaltungsspielräume, Auswirkungen der Gestaltungsmöglichkeiten auf die ECL-Bewertung sowie eine Bewertung möglicher Vor- und Nachteile verschiedener ECL-Schätzungen.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Seminararbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretische Grundlagen des IFRS 9, Einflussgrößen auf den Expected Credit Loss, Bewertung und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des ECL-Modells im IFRS 9.
Was sind die wichtigsten Einflussgrößen des ECL-Modells?
Die drei wichtigsten Einflussgrößen des ECL-Modells sind: Probability of Default (PD, Ausfallwahrscheinlichkeit), Loss Given Default (LGD, Verlust im Falle eines Ausfalls) und Exposure at Default (EAD, Ausfallbetrag).
Wie wird das ECL-Modell im IFRS 9 berechnet?
Die Seminararbeit beschreibt detailliert den Aufbau und die Berechnungsweise des ECL-Modells. Sie betont den Vergleich zwischen dem alten Incurred-Loss-Modell (IAS 39) und dem neuen ECL-Modell, wobei die zukunftsorientierte Ausrichtung des ECL-Modells und die Berücksichtigung von vergangenen Ereignissen, aktuellen Zuständen und Prognosen hervorgehoben werden.
Welche Gestaltungsspielräume haben Kreditinstitute bei der Anwendung des ECL-Modells?
Die Seminararbeit untersucht detailliert die Gestaltungsspielräume für Kreditinstitute bei der Schätzung der einzelnen Einflussfaktoren (PD, LGD, EAD) und analysiert die Auswirkungen dieser Gestaltungsmöglichkeiten auf die ECL-Bewertung.
Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene ECL-Schätzungen?
Die Arbeit bewertet mögliche Vor- und Nachteile verschiedener ECL-Schätzungen, um ein umfassendes Verständnis der Auswirkungen der Gestaltungsspielräume auf die Bewertung von Finanzinstrumenten zu vermitteln.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für das Verständnis der Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Expected Credit Loss (ECL), IFRS 9, Incurred-Loss-Modell, Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD), Finanzmarktkrise, Kreditrisiko, Risikovorsorge, Bewertung von Finanzinstrumenten, Kreditinstitute, Gestaltungsspielräume.
Welchen Hintergrund hat die Entwicklung des IFRS 9 und seines ECL-Modells?
Die Entstehung des IFRS 9 wird im Kontext der Finanzmarktkrise und der damit verbundenen Kritik am vorherigen Incurred-Loss-Modell (IAS 39) erläutert. Die Notwendigkeit des IFRS 9 und seines ECL-Modells wird detailliert beschrieben.
Wo finde ich weitere Informationen zum IFRS 9?
Die Seminararbeit dient als umfassende Einführung in die Thematik. Für weiterführende Informationen wird auf die entsprechende Fachliteratur und die offiziellen Dokumente des IFRS verwiesen (in der Seminararbeit selbst nicht explizit aufgeführt, aber implizit durch die Tiefe der Ausarbeitung nahegelegt).
- Quote paper
- Manuel Fischer (Author), 2021, Einflussgrößen auf den Expected Credit Loss. Gestaltungsmöglichkeiten für Kreditinstitute bei der Anwendung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005549