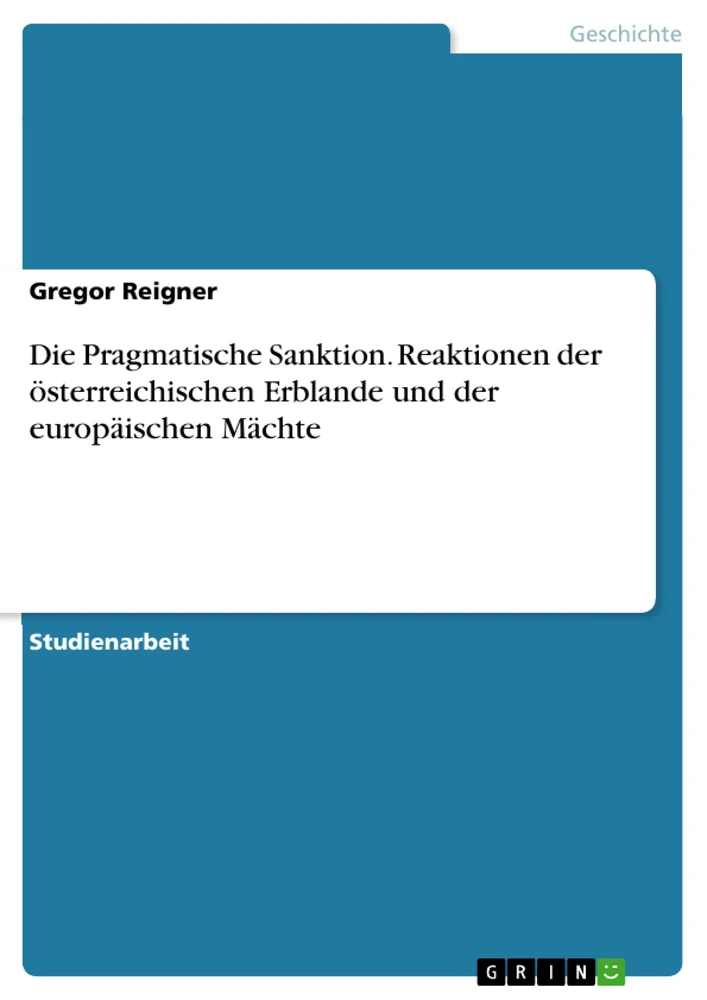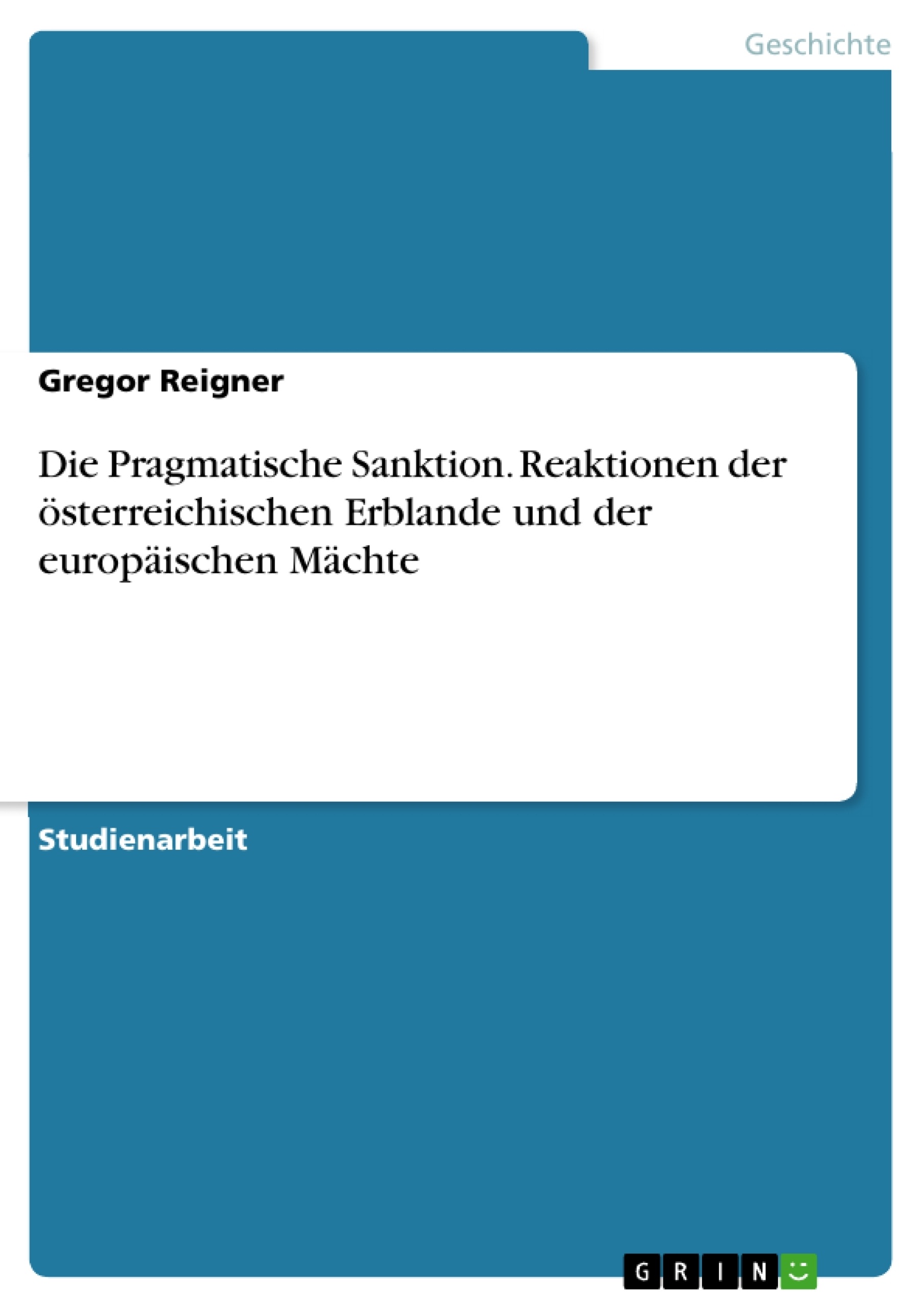Diese Arbeit befasst sich mit der sogenannten Pragmatischen Sanktion, mit der die Erbfolge Maria Theresias in der österreichischen Monarchie international gesichert werden sollte. Es werden sowohl die Reaktionen der österreichischen Erblande als auch jene der europäischen Mächte auf die Pragmatische Sanktion untersucht. Dies soll zeigen, ob die Pragmatische Sanktion als ein außenpolitischer Erfolg bezeichnet werden kann oder nicht.
Die Pragmatische Sanktion stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Politik und Tradition der Habsburgermonarchie dar, war doch zum ersten Mal eine weibliche Erbfolge möglich. Diese Regelung hatte weitreichende Konsequenzen, da Kaiser Karl VI., der letzte männliche Habsburger am 20. Oktober 1740 starb – dies hätte, normalerweise, das Ende des Geschlechts der Habsburger und ihrer Dynastie bedeutet. Doch die Pragmatische Sanktion sollte verhinderte das Aussterben der Dynastie der Habsburger – doch lediglich dann, wenn diese auch von den anderen Mächten Europas akzeptiert würde. Deshalb soll die zentrale Frage dieser Arbeit sein: Hat die Pragmatische Sanktion ihr Ziel erreicht? Wurde sie von den Erblanden und anderen europäischen Mächten akzeptiert und war sie damit erfolgreich? Hat sie „funktioniert“? War sie außergewöhnlich?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Chronologie
- Hintergründe
- Rechtliche Grundlagen
- Reaktion der Erblande und der europäischen Mächte
- Tirol
- Ungarn
- Kroatien
- Heiliges römisches Reich
- Sachsen
- Preußen und Frankreich
- Russland
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Pragmatischen Sanktion, einem bedeutenden Verfassungsdokument der Habsburgermonarchie, das die weibliche Erbfolge ermöglichte. Die Arbeit untersucht die Hintergründe und rechtlichen Grundlagen der Sanktion sowie die Reaktion der europäischen Mächte auf diese.
- Die Bedeutung der Pragmatischen Sanktion als Wendepunkt in der Habsburgerpolitik
- Die rechtlichen Grundlagen und ihre Bedeutung für die Erbfolge
- Die Reaktion der Erblande und der europäischen Mächte auf die Pragmatische Sanktion
- Die Rolle der Pragmatischen Sanktion im österreichischen Erbfolgekrieg
- Die Auswirkungen der Pragmatischen Sanktion auf die österreichische Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Pragmatischen Sanktion ein und beleuchtet deren Bedeutung als Wendepunkt in der Habsburgermonarchie. Sie stellt die zentrale Frage der Arbeit: Hat die Pragmatische Sanktion ihr Ziel erreicht?
Chronologie
Das Kapitel bietet eine chronologische Übersicht über die wichtigsten Daten im Zusammenhang mit der Pragmatischen Sanktion, um die historischen Zusammenhänge zu verdeutlichen.
Hintergründe
Das Kapitel erläutert die Hintergründe der Pragmatischen Sanktion, insbesondere den spanischen Erbfolgekrieg und den Vertrag Pactum mutuae sucessionis von 1703. Es zeigt die Bedeutung der Pragmatischen Sanktion als Mittel zur Sicherung des österreichischen Erbes.
Rechtliche Grundlagen
Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen der Pragmatischen Sanktion, einschließlich des Vertrags Pactum mutuae sucessionis von 1703, und beleuchtet deren Bedeutung für die Erbfolge in der Habsburgermonarchie.
Reaktion der Erblande und der europäischen Mächte
Dieses Kapitel untersucht die Reaktion der Erblande und der europäischen Mächte auf die Pragmatische Sanktion, wobei es auf die unterschiedlichen Positionen und Reaktionen der einzelnen Staaten eingeht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Pragmatische Sanktion, Habsburgermonarchie, weibliche Erbfolge, spanischer Erbfolgekrieg, Pactum mutuae sucessionis, österreichischer Erbfolgekrieg, europäische Mächte.
- Citar trabajo
- Gregor Reigner (Autor), 2012, Die Pragmatische Sanktion. Reaktionen der österreichischen Erblande und der europäischen Mächte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005527