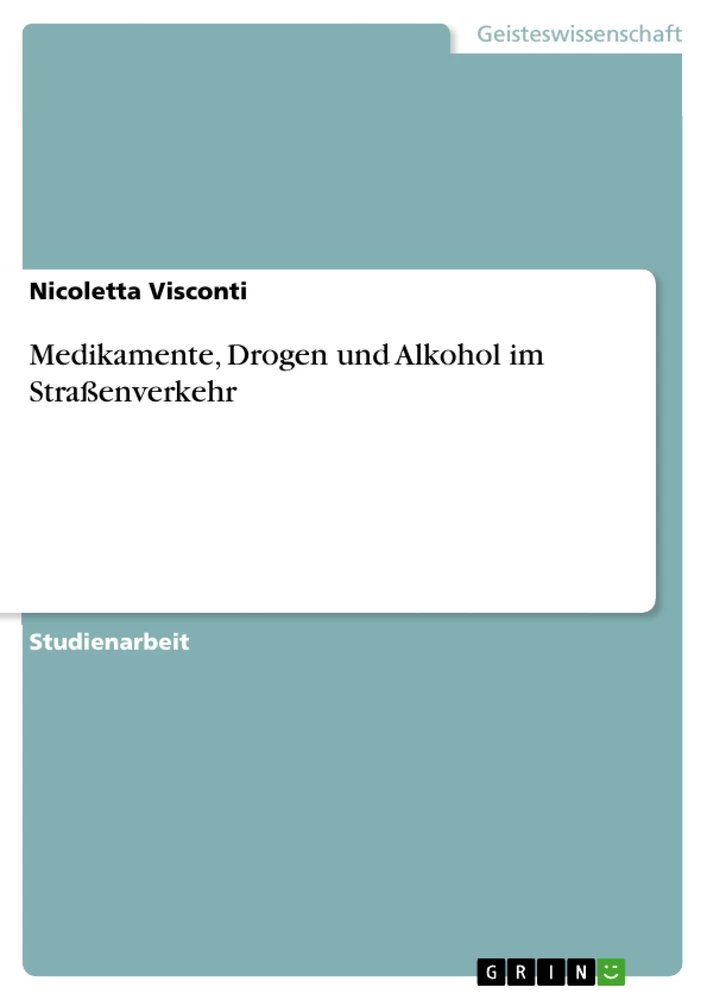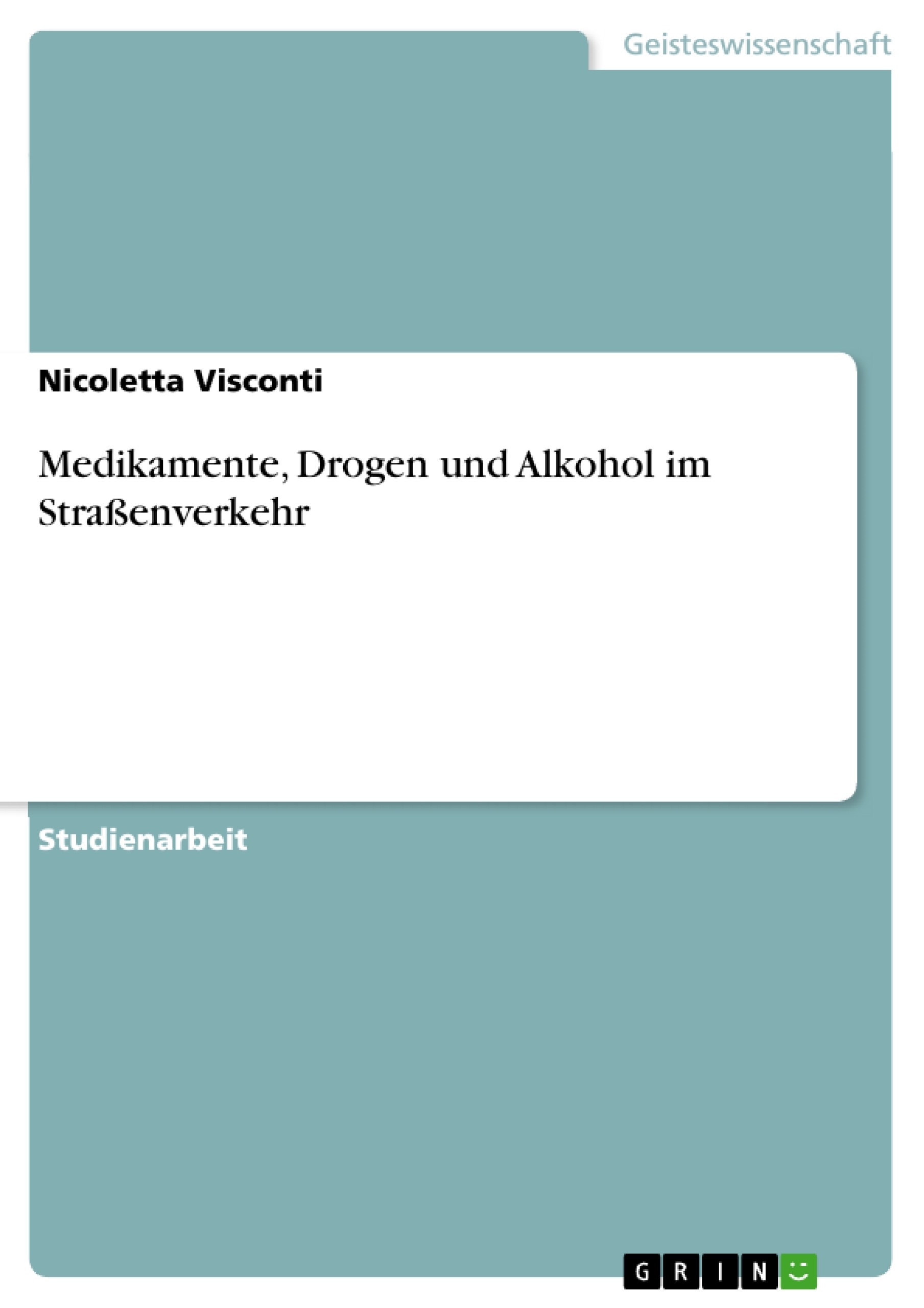Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Steuer, die Lichter der Stadt verschwimmen vor Ihren Augen, und ein plötzlicher Schwindel überkommt Sie – sind Sie noch Herr Ihrer Sinne? Dieses Buch enthüllt die unberechenbaren Gefahren, die von alltäglichen Medikamenten, illegalen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr ausgehen. Es ist ein dringender Appell an jeden Verkehrsteilnehmer, sich der oft unterschätzten Risiken bewusst zu werden. Von Schmerzmitteln über Antidepressiva bis hin zu Cannabis und Amphetaminen – diese umfassende Analyse beleuchtet, wie Substanzen unsere Reaktionsfähigkeit, unser Urteilsvermögen und unsere Wahrnehmung beeinträchtigen können, oft mit fatalen Folgen. Anhand von Fallbeispielen, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Expertenmeinungen werden die verheerenden Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit schonungslos offengelegt. Erfahren Sie, welche Medikamente Ihre Fahrtüchtigkeit einschränken, wie Alkohol die Wirkung von Drogen verstärkt und welche rechtlichen Konsequenzen drohen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Unterschätzung der Gefahren durch Medikamente und Drogen im Vergleich zu Alkohol, sowie auf der oft mangelnden Aufklärung und den Defiziten bei der Erkennung von Drogenkonsum im Straßenverkehr. Dieses Buch ist ein unerlässlicher Ratgeber für Autofahrer, Ärzte, Apotheker, Juristen und alle, die sich für die Sicherheit im Straßenverkehr engagieren. Es rüttelt auf, klärt auf und fordert eine verantwortungsvolle Auseinandersetzung mit dem Thema, um Unfälle zu verhindern und Leben zu retten. Es werden die Auswirkungen verschiedener Medikamentengruppen wie Schmerzmittel, Blutzuckersenkende Mittel, Blutdrucksenkende Mittel, Augenwirksame Arzneien und Psychopharmaka auf die Fahrtüchtigkeit detailliert beschrieben. Auch die spezifischen Gefahren durch Drogen wie Cannabis, Opiate, Kokain, Amphetamine und LSD werden beleuchtet. Abschließend werden die rechtlichen Aspekte des Drogen- und Medikamentenmissbrauchs im Straßenverkehr sowie die aktuellen Nachweismethoden erläutert. Ein aufrüttelnder Weckruf, der das Bewusstsein für die unsichtbaren Gefahren im Straßenverkehr schärft und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Medikamenten, Drogen und Alkohol mahnt – für Ihre Sicherheit und die aller anderen Verkehrsteilnehmer.
Medikamente, Drogen und Alkohol im Straßenverkehr
Die Rolle von Medikamenten
- Medikamente sollen eigentlich den Menschen heilen. Es gibt jedoch einige Medikamentengruppen, die körperliche Reaktionen und Verhaltensweisen beeinflussen können. Gefährlich können Medikamente vor allem dann werden, wenn sie nicht kontrolliert eingenommen werden.
- Das Verhalten im Straßenverkehr kann vor allem durch Psychopharmaka und durch sogenannte Designer-Drogen beeinflußt werden; wobei Designer-Drogen von der Substanz her im wesentlichen Arzneistoffe enthalten, aber als Droge konsumiert werden.
I.Schmerzmittel (Analgetika)
Morphinhaltige Schmerzmittel können zu einer Beeinträchtigung der Fahrsicherheit führen. Nicht-morphinhaltige Schmerzmittel schränken die Fahrsicherheit ebenfalls ein, wenn sie unkontrolliert eingenommen werden.
Allgemeine Charakterisierung von Schmerzmitteln
- Analgetika dienen zur Eindämmung von Schmerzen und werden sowohl zur kurzfristigen als auch zur Langzeittherapie verwendet.
- Die morphinartig wirkenden Analgetika unterliegen der Verschreibungspflicht nach dem BtMG und beeinflussen die psychomotorische Leistungsfähigkeit des Patienten.
- Das größte Risiko für die Fahrsicherheit stellen Kombinationspräparate von Analgetika mit Codein und Koffein dar. Die Gefährdung potenziert sich bei diesen Präparaten, wenn gleichzeitig noch Alkohol konsumiert wird.
Morphinartige Schmerzmittel
Morphinartige Schmerzmittel oder Morphine (z.B:Pethidin) beeinträchtigen das Fahrverhalten deutlich. Die Einnahme dieser Medikamente schließt eine sichere Verkehrsteilnahme völlig aus.
Verkehrsrelevante Wirkungen der Morphin-Abkömmlinge
- Morphin und seine Abkömmlinge (z. B. Hydromorphon und Oxycodon) werden bei stärksten Schmerzen und entsprechenden Krankheitsbildern eingesetzt.
- Die Einnahme dieser Medikamente kann zu folgenden Symptomen führen: Benommenheit, starken Stimmungsschwankungen sowie (dosisabhängigen) Hemmungen des Atemzentrums.
- Gleichzeitiger Alkoholgenuß verstärkt die negativen Wirkungen von Morphin bzw. seinen Abkömmlingen.
- eines evtl. Entzugs ist eine sichere Verkehrsteilnahme völlig ausgeschlossen. Wer ständig morphinhaltige Medikamente einnimmt, sollte auf keinen Fall fahren.
- Auch für den Zeitraum
- Hypnotische, euphorisierende und atemdepressive Wirkungen schließen bei diesen Mitteln eine sichere Verkehrsteilnahme völlig aus.
- Kombinationspräparate der morphinartigen Schmerzmittel mit Codein (= ein Alkaloid des Opiums) wirken bei normaler Dosierung kaum sicherheitsbeeinträchtigend.
- Bei gleichzeitiger Einnahme von zentral wirkenden Arzneien (etwa Depressiva oder Neuroleptika) sowie bei zusätzlichem Alkoholgenuß wird die dämpfende Wirkung verstärkt.
- Nicht morphinartige Schmerzmittel
- Bei den nicht-morphinartig wirkenden Analgetika (z.B. Acetylsalicylsäure) besteht eine geringere Einschränkung der Fahrsicherheit. Wegen des hohen Anteils der Selbstmedikation, die sowohl bei kurzfristigen als auch bechronischen Schmerzzuständen je nach Schmerzintensität in entsprechenden Mengen genommen werden, bewirken auch diese Präparate eine (dosisabhängige) Beeinträchtigung der Fahrsicherheit
- Gefährlich sind bei den nicht-morphinartigen Schmerzmitteln vor allem Überdosierungen.
- Dies gilt vor allem für Acetylsalicylsäure bei einer Tagesdosis von über 2-4 Gramm. Hierbei führen Erbrechen, Schwindel und Übelkeit zu erheblichen Leistungsbeeinträchtigungen im Straßenverkehr.
- Andere zentraldämpfende Medikamente (z. B. Benzodiazepine) erzeugen in der Wechselwirkung mit nicht-morphinartigen Analgetika erhebliche Wirkungsverstärkungen dieser Mittel.
II. Blutzuckersenkende Mittel (Antidiabetika)
Die Hauptgefahr bei der Verkehrsteilnahme von Diabetikern besteht im plötzlichen Absinken des Blutzuckerspiegels (= Hypoglykämie). Die Unterzuckerung geht mit psycho-physischen Ausfallerscheinungen bis hin zur Bewußtlosigkeit einher. Für Diabetiker ist es daher wichtig, bei der Wahl des Medikaments und bei den Ernährungsgewohnheiten die Gefahr einer Unterzuckerung so weit wie möglich auszuschalten. Alkoholgenuß und ungewohnte körperliche Belastungen verstärken die Beinträchtigungen durch orale Antidiabetika.
Hauptsymptome des erhöhten Blutzuckerspiegels (Diabetes mellitus)
- Diabetes mellitus ist eine Kohlenhydrat-Stoffwechselerkrankung, bei der ein Mangel an Insulin (= ein Hormon der Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse) vorliegt.
- Das verkehrsmedizinische Risiko eines Diabetikers besteht einerseits in einer Stoffwechselentgleisung mit zu niedrigem Blutzuckerspiegel (= Hypoglykämie) und andererseits zu hohem Blutzuckerspiegel (= Hyperglykämie). Ein zu hoher Blutzuckerspiegel entwickelt sich über einen längeren Zeitraum und ist von schweren Krankheitssymptomen (bis hin zum Koma diabeticum) begleitet.
- Der wichtigste Anhaltspunkt zur Einschätzung der Verkehrstauglichkeit von Diabetikern ist somit deren Tendenz zur plötzlichen Unterzuckerung (= hypoglykämischer Schock).
- Von einer Blutunterzuckerung spricht man, wenn Blutzuckerwerte unter einer Grenze von 50 mg/dl vorliegen.
- Die klassischen Symptome der Hypoglykämie zeigen sich in folgendem Ablauf: Zunächst treten Heißhunger oder Übelkeit auf, es folgt eine verlangsamte Pulsfrequenz (= Bradykardie), Müdigkeit und Gähnen.
- Im weiteren Verlauf kommt es zu Verwirrungs- und Angstzuständen, gefolgt von einer beschleunigten Pulsfrequenz (= Tachykardie).
- Weitere Symptome sind Schwitzen, Hyperventilation und Krämpfe.
- Wenn der Blutzuckerspiegel auf weniger als 35 mg/dl absinkt, kommt es schließlich zur Bewußtlosigkeit. Fatal für die Verkehrsteilnahme ist bei den ersten Phasen der Blutunterzuckerung, daß nur ein Teil der Diabetes-Kranken das Gefühl der Gefährdung hat.
- Die Spätschäden des Diabetes mellitus - wie z. B. die Netzhautveränderungen am Auge (= Retinopathia diabetica) - können durch die Einschränkung des Sehvermögens zur Fahruntauglichkeit führen.
- In der 1992 (4. Auflage) vom Bundesminister für Verkehr herausgegebenen Schriftenreihe "Krankheit und Kraftverkehr" werden Diabetiker nach verkehrsmedizinischen Aspekten in 3 Gefahrengruppen unterteilt:
1.) Mit Diät behandelte Diabetiker:
Sie halten eine geregelte Diät ein und führen regelmäßige Stoffwechselkontrollen durch den Arzt im Abstand von höchstens 12 Wochen durch (zusätlich Selbstkontrollen) Diabetiker dieser Gruppe sind aus verkehrsmedizinischer Sicht nicht durch ihre Stoffwechselstörung gefährdet.
2.) Mit Diät und oralen blutzuckersenkenden Mitteln behandelte Diabetiker:
Sie lassen regelmäßig Stoffwechselkontrollen vom Arzt im Abstand von höchstens 8 Wochen durchführen (z.Stoffwechsel-Selbstkontrollen) Diabetiker dieser Gruppe sind in der Regel nicht vermehrt durch Blutunterzuckerung gefährdet. Sie können darum jedes Kraftfahrzeug führen, wenn sie die geforderten Bedingungen erfüllen.
3.) Mit Diät und Insulin, auch mit tragbarem Insulindosiergerät oder mit Insulin und oralen Antidiabetika behandelte Diabetiker:
Sie lassen regelmäßige Stoffwechselkontrollen durch den Arzt im Abstand von höchstens 6 Wochen durchführen und begleiten diese durch Selbstkontrollen. Diabetiker dieser Gruppe sind unabhängig von der Höhe der erforderlichen Insulindosis und auch unabhängig von der Durchführungsart der Insulinbehandlung hypoglykämiegefährdet. Sie erscheinen daher nicht geeignet, Kraftfahrzeuge der Klasse 2 oder Fahrzeuge, die der Fahrgastbeförderung gemäß § 15 der StVZO dienen, zu führen. Kraftfahrzeuge der Klassen 1, 3, 4 und 5 können sie jedoch führen.
Verkehrsrelevante Wirkungen des Insulins
- Der größte Risikofaktor für den Kraftfahrer ist eine direkte Überdosierung des blutzuckersenkenden Insulins mit der Folge einer Blutunterzuckerung. Eine Überdosierung kann auch bei zu geringer Kohlehydratzufuhr und "normaler" Insulingabe eintreten.
- Der Gefahr einer Insulin-Überdosierung kann mit neuen Methoden - besonders mit der "Insulinpumpe" - entgegengewirkt werden.
- In den ersten drei Monaten einer Insulintherapie sollte der Patient noch nicht am aktiven Straßenverkehr teilnehmen. Wer erstmals oder wer überhaupt neu auf eine Behandlung eingestellt wird, ist zum Führen von Kraftfahrzeugen aller Klassen ungeeignet, bis die Einstellphase durch Erreichen einer ausgeglichenen Stoffwechsellage abgeschlossen ist.
Verkehrsrelevante Wirkungen oraler Antidiabetika
- Bei der Behandlung eines nichtinsulinpflichtigen Diabetikers mit oralen blutzuckersenkenden Mitteln (Sulfonylharnstoffe) liegt das Risiko einer schweren Unterzuckerung bei nur 0,01 %; leichte, gut erkennbare Formen der Unterzuckerung treten bei 2 - 10 % der Patienten auf.
- Einige Sulfonylharnstoffe (z. B. Chlorpropramid) können die Verkehrstauglichkeit des Patienten negativ beeinflussen. Die Unterzuckerungsgefahr wird erhöht durch Organschäden wie Niereninsuffizienz und Leberzirrhose.
- Weitere Unterzuckerungs-Risikofaktoren sind falsche Nahrungsaufnahme und ungewohnte schwere körperliche Arbeit.
- Besonders schwerwiegend ist die Wechselwirkung oraler blutzuckersenkender Mittel mit Alkohol. Bereits eine geringe Menge Alkohol (1 Glas Wein) kann zu einer deutlichen Wirkungssteigerung führen. Je nach individueller Disposition können größere Mengen Alkohol zu Übelkeit, Atemnot, Tachykardie und Blutdruckabfall bis hin zum akuten Kreislaufversagen führen.
III. Blutdrucksenkende Mittel (Antihypertonika):
Bluthochdruck kann das sichere Verkehrsverhalten gefährden. Blutdrucksenkende Mittel können zu einer ganzen Reihe von Beeinträchtigungen im Straßenverkehr führen. Gleichzeitiger Alkoholgenuß wirkt risikoverschärfend.
Sicherheits-Richtlinien für Bluthochdruck-Kranke im Straßenverkehr
- Die unbehandelten hypertonischen Kraftfahrer stellen ein erhebliches Gefahrenpotential im Straßenverkehr dar. Deshalb hat der gemeinsame Beirat für Verkehrsmedizin beim Bundesminister für Verkehr und beim Bundesminister für Gesundheit Leitsätze im Gutachten "Krankheit und Kraftverkehr" für bluthochdruckkranke Kraftfahrer herausgegeben, die folgenden Inhalt haben:
- Wer unter einem Bluthochdruck mit ständig zu messendem diastolischen Wert über 140 mm Hg leidet, ist zum Führen von Kraftfahrzeugen aller Klassen ungeeignet.
- Zum Führen von Kraftfahrzeugen der Klasse 2 und zum Führen von Fahrzeugen, die der Fahrgastbeförderung gemäß § 15 der StVZO dienen, ist ungeeignet und zum Führen von Kraftfahrzeugen der Klassen 1, 3, 4 und 5 ist nur noch bedingt geeignet
Auswirkungen von Bluthochdruck auf das Fahren
- Bei nichtbehandeltem Bluthochdruck kommt es unter der Belastung des Autofahrens meist zur Verstärkung der Bluthochdrucksymptome: Seh-, Hör- und Gleichgewichtsstörungen bis hin zu Netzhautblutungen. Als gravierendste Komplikationen sind auch Schlaganfälle (= apoplektische Insulte) und Herzinfarkte möglich.
Verkehrsgefährdende Wirkungen von blutdrucksenkenden Mitteln
Beta-Rezeptorenblockern: Während die Hypertonie-Therapie mit Beta-Rezeptorenblockern ohne zusätzliche Arzneimittel eine Verbesserung der psychomotorischen Fähigkeiten zur Folge hat, sind folgende Arznei-Kombinationen mit Beta-Rezeptorenblockern verkehrssicherheitsgefährdend:
- Werden Beta-Rezeptorenblocker mit zentral wirksamen Antihypertensiva (z. B. Reserpin) kombiniert, die allein genommen schon eine stark einschränkende Wirkung auf die Fahrtauglichkeit haben, so werden Müdigkeit und Neigung zu verlangsamter Pulsfrequenz erheblich verstärkt.
- Die Kombination von Beta-Rezeptorenblockern mit Methyldopa führt in einigen Fällen zur hypertonen Krise.
- Antidiabetika können in der Kombination mit Beta-Rezeptorenblockern eine Hypoglykämie auslösen.
- Calciumantagonisten Wenn Calciumantagonisten zusammen mit Beta- Rezeptorenblockern eingenommen werden, addieren sich die Wirkungen der beiden Medikamente mit der Folge von ausgeprägten Pulsfrequenz-Verlangsamungen.
- Wegen seiner kardialen Nebenwirkungen sollte insbesondere das Medikament Verapamil in der Kombination mit Calciumantagonisten bei der Verkehrsteilnahme vermieden werden.
- Diuretika Nebenwirkungen der konventionellen Entwässerungstherapie (mit Diuretika) können die Verkehrstauglichkeit erheblich einschränken.
- Durch Hyperventilation in Streßsituationen, die der Straßenverkehr beispielsweise immer darstellt, kann die Alkalose so verstärkt werden, daß Muskelkrämpfe und Herzrhythmusstörungen auftreten.
- Vasodilatatoren Therapien mit ausschließlich gefäßerweiternden Mitteln (Vasodilatatoren) können Nebenwirkungen haben - wie Kopfschmerz, Schwindel und beschleunigte Pulsfrequenz.
- Sie können aber auch zu einer Beeinträchtigung der psychomotorischen Fähigkeiten führen. Dem wirkt eine Kombinationstherapie mit Beta-Rezeptorenblockern und Diuretika entgegen.
- Der Alpha-Rezeptorenblocker Prazosin birgt die Gefahr eines Kreislauf-Kollapses. Dies kann durch eine "einschleichende Therapie" mit langsamer Dosis-Anhebung ausgeschaltet werden.
Verkehrsrelevante Wirkungen von zentralwirksamen Antihypertonika
- Zentralwirksame Antihypertonika - wie Reserpin, Methyldopa, Clonidin - haben eine ermüdende bis einschläfernde Wirkung und setzen die Konzentrationsfähigkeit deutlich herab. Die Fahrtüchtigkeit ist damit eingeschränkt.
- Zusätzlich konsumierter Alkohol verstärkt die zentral-dämpfende Wirkung.
V. Augenwirksame Arzneien (Ophthalmika)
Sowohl pupillenverengende als auch pupillenerweiternde Arzneimittel führen zu Einschränkungen des Dämmerungssehens und der Sehschärfe sowie zu erhöhter Blendungsgefahr. Außerdem treten bei einigen Medikamenten dieser Gruppe weitere systemische Störungen auf. Andere Therapeutika weisen diese Beeinträchtigungen als Nebenwirkungen auf.
Sehleistung und Seh-Beeinträchtigungen im Straßenverkehr
- Für die Fahrtauglichkeit ist die Wahrnehmungsfähigkeit der Augen - besonders die Sehschärfe, das räumliche Sehvermögen und die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Lichtverhältnisse - entscheidend. Die Sehleistung wiederum wird von den Faktoren Alter, Augenerkrankungen und Arzneimitteleinnahme erheblich beeinflußt.
- Bei älteren Menschen ist der Pupillendurchmesser in der Regel geringer als bei jüngeren; daher wirken pupillenverengende Medikamente bei älteren Menschen besonders stark. Dies macht sich besonders in der Dämmerung bemerkbar (mesopisches Sehen). Die bei eng gestellten Pupillen mangelhafte Dunkeladaptation mit ungenügender Beleuchtung der Netzhaut führt dann zu einer Verminderung der Sehschärfe.
Fahrbeeinträchtigungen durch augenwirksame Arzneimittel
- Sowohl pupillenerweiternde als auch pupillenverengende Medikamente haben negative Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit.
- Medikamente, die gegen andere Organerkrankungen eingenommen werden, können Nebenwirkungen auf die Augen haben. Deren Folgen können ebenfalls die Teilnahme am Straßenverkehr negativ beeinflussen.
Pupillenverengende und pupillenerweiternde Medikamente (Miotika und Mydriatika)
Miotika schränken das Dämmerungssehen und die Sehschärfe ein und können negative Wirkungen auf Herz und Zentralnervensystem haben. Mydriatika bewirken eine Verminderung der Sehschärfe und führen zu erhöhter Blendungsgefahr sowie zu einem beschleunigten Puls. Die Einnahme von Mydriatika ist mit einer aktiven Verkehrsteilnahme nicht zu vereinbaren.
1. pupillenverengenden Mittel (Miotika)
- Miotika sind pupillenverengende und augeninnendruckvermindernde Medikamente, die zur Therapie des Glaukoms (= krankhafte Erhöhung des Augeninnendrucks) eingesetzt werden.
- Durch die medikamentös eng gestellte Pupille fällt bei Dämmerungsfahrten weniger Licht, was eine deutliche Herabsetzung der Wahrnehmung zur Folge hat.
- Die Sehleistung durch eine zentrale Linsentrübung bei älteren Menschen wird durch Miotika noch weiter vermindert, da das Licht dann nur noch durch die zentralen, getrübten Linsenanteile zur Netzhaut gelangt.
2.pupillenerweiternden Mittel (Mydriatika)
- Als Mydriatika werden Parasympatholytika - wie Atropin und Tropicamid - bzw. Sympathomimetika - wie Adrenalin und Naphazolin - bezeichnet. Ihre pupillenerweiternde Wirkung wird für diagnostische und therapeutische Zwecke benutzt.
- Der Pupillendurchmesser beeinflußt u. a. die Sehschärfe, welche bei eng gestellter Pupille besser ist als bei weit gestellter Pupille. Durch Mydriatika kann die Pupillenfunktion gestört und damit die Sehschärfe vermindert sein. Außerdem ist die Blendungsgefahr bei weit gestellter Pupille größer.
- Von einer Teilnahme am Straßenverkehr ist nach Anwendung von Mydriatika dringend abzuraten.
3. Nebenwirkungen von anderen Medikamenten auf die Augen
Verschiedene Medikamente haben gravierende Nebenwirkungen auf die Augen (Pupillenverengung, Sehschärfenverschlechterung und Blendungsempfindlichkeit).
Blutzuckersenkende Mittel (Antidiabetika)
- Nach einer Insulinzufuhr, aber auch nach einer oralen Behandlung mit Antidiabetika kann der Flüssigkeitsgehalt der Linse abnehmen. Die Schwankungsbreite kann bis zu 9 Dioptrien betragen. Außerdem wirkt Insulin pupillenverengend und trägt damit zu einer Einschränkung der Dämmerungssehfähigkeit bei.
Kortisontherapie (Corticosteroidtherapie)
- Die Behandlung kann zur Erhöhung des Augeninnendrucks und zur Linsentrübung führen. Dies schränkt die Sehleistung schleichend ein und erhöht die Blendungsempfindlichkeit. Oft bemerken die Betroffenen diese Entwicklung nicht. Daher sind bei dieser Medikation regelmäßige Augenkontrollen empfehlenswert.
Entwässerungsmittel (Diuretika)
- Die ausschwemmende Wirkung von Diuretika kann zu einer Herabsetzung der Sehleistung führen. Dabei nimmt das Ausmaß der Sehschärfenverschlechterung mit der Menge der ausgeschiedenen Flüssigkeit zu.
Psychopharmaka
- Einige Psychopharmaka (z. B. Neuroleptika, Antidepressiva) wirken pupillenerweiternd. Je nach Außmaß der Pupillenerweiterung können die zentrale Sehschärfe vermindert und die Blendungsempfindlichkeit erhöht sein.
Schmerzmittel (Analgetika)
- Morphin und seine Derivate haben eine pupillenverengende Wirkung, die zu Problemen beim Sehen in der Dämmerung führen können.
5.Psychopharmaka
Alle Arten von Psychopharmaka haben Auswirkungen auf das Verkehrsverhalten, wenn sie nicht kontrolliert und dosiert eingenommen werden.
Verkehrsrelevante Wirkungen einzelner Gruppen von Psychopharmaka
- Bei den Hypnotika (= Schlafmitteln) steht vor allem die früh einsetzende einschläfernde Wirkung einer Verkehrsteilnahme entgegen.
- Die Sedativa (= Beruhigungsmittel) sind aufgrund der zentral dämpfenden Eigenschaften ebenfalls als verkehrsgefährdend einzustufen.
- Mittel gegen Psychosen (= Neuroleptika) können erst nach erfolgter medikamentöser Einstellung des Patienten bei der Verkehrsteilnahme benutzt werden
- Mittel gegen Depressionen (= Antidepressiva) können Kreislauf- und Sehbeschwerden bewirken und erlauben ebenfalls erst nach der Einstellungsphase die Verkehrsteilnahme. MAO-Hemmstoffe verführen zu riskantem Fahren.
- Tranquilizer sind wegen der Gefahr der Überdosierung und langer Halbwertszeiten gefährlich.
- Lithium ist nur in exakter Dosierung unbedeutemd
- Zusätzlich konsumierter Alkohol wirkt bei allen Psychopharmaka stark risikoverstärkend.
Zwei Hauptgruppen von Psychopharmaka
- Psychopharmaka können in folgende zwei Gruppen unterteilt werden:
1.) Psychopharmaka im weiteren Sinne (Hypnotika und Sedativa), sowie
2.) Psychopharmaka im engeren Sinne (Neuroleptika, Tranquilizer und Antidepressiva).
Psychopharmaka und Verkehrstauglichkeit
- Die Nebenwirkungen von Psychopharmaka sind abhängig von den Wechselwirkungen zwischen der Persönlichkeit des Patienten, seiner Grunderkrankung und dem individuellen Ansprechen auf das verordnete Medikament.
- Für die Einschätzung der Verkehrstauglichkeit ist es bei der Therapie mit
Psychopharmaka wichtig,
- den Patienten über die erwartbaren Neben- und Wechselwirkungen genau zu informieren,
- genaue Dosierungsanweisungen zu geben,
- engmaschige Kontrollen der psychophysischen Leistungsfähigkeit durchzuführen (vor allem zu Beginn der Behandlung), sowie
- bei Unsicherheiten eine verkehrspsychologische Untersuchung durch den TÜV zu veranlassen.
- Wichtig ist außerdem, daß bei Einnahme von Psychopharmaka jeder Alkoholgenuß strikt verboten ist.
Verkehrsrelevante Wirkungen von Schlaf- und Dämpfungsmitteln (Hypnotika und Sedativa)
Schlafmittel haben erhebliche psychomotorische Leistungseinschränkungen zur Folge und erlauben keine aktive Verkehrsteilnahme. Auch einzelne Dämpfungsmittel (z. B. Bromide und Clomethiazol) heben die Fahrtüchtigkeit auf.
Allgemeine Wirkung von Schlafmitteln (Hypnotika)
- Schlafmittel haben direkt nach der Einnahme eine psychomotorische Leistungseinschränkung zur Folge. Daher verbietet sich die aktive Verkehrsteilnahme nach der Einnahme von Hypnotika.
- Wegen der müdemachenden Nachwirkung (= "hang over") von Hypnotika ist darauf zu achten, daß bei beabsichtigter Verkehrsteilnahme ein Schlafmittel mit geringer Halbwertszeit gewählt wird und eine mindestens 8 -10stündige Schlafdauer eingehalten wird.
- Eine andere Gefahr von Hypnotika sind Kumulationstendenzen, die bei chronischer Einnahme zu Koordinationsstörungen, Verlangsamung, Apathie und psychotischen Einbrüchen führen können und damit die Fahrtauglichkeit aufheben.
- Bei älteren Verkehrsteilnehmern können Hypnotika Erregung statt Beruhigung bewirken, die aufgrund der daraus folgenden Konzentrationsstörungen zu Fahrtauglichkeitsbeeinträchtigungen führen kann
Spezielle Wirkung einiger Schlaf- und Dämpfungsmittel (Hypnotika und Sedativa)
- Beim Einsatz von Bromiden als Dämpfungsmittel besteht wegen der spät einsetzenden Wirkungen die Gefahr von Überdosierungen, die zu ähnlichen Nebenwirkungen wie bei den Schlafmitteln führen können.
- Der starke psychomotorische Dämpfungseffekt von Clomethiazol, das gegen Erregungszustände (besonders bei Delirium tremens) gegeben wird, führt zur Aufhebung der Fahrtauglichkeit.
- Die Beruhigungswirkung der antiallergischen Medikamente (Antihistaminika) Diphenhydramin und Doxylamin kann vor allem bei Therapiebeginn zu Einschränkungen der Verkehrstauglichkeit führen.
- Alle Schlaf- und Dämpfungsmittel werden durch Alkohol in ihrer Wirkung erheblich verstärkt, weshalb während der gesamten Therapiedauer mit diesen Mitteln ein absolutes Alkoholverbot gilt.
- Nach dem Absetzen von längerfristig eingenommenen Hypnotika können Entzugserscheinungen bis hin zum Delirium auftreten, die eine aktive Verkehrsteilnahme verbieten.
Verkehrsrelevante Wirkungen von Mitteln gegen Psychosen (Neuroleptika)
Vor allem zu Beginn der Neuroleptikatherapie und bei akuten psychotischen Schüben ist eine aktive Verkehrsteilnahme für Neuroleptika-Patienten nicht möglich. Im therapeutischen Rahmen ist die Wirkung von Neuroleptika auf lange Sicht jedoch verkehrssicherheitsfördernd
- Phenothiazin- und Butyrophenon-Präparate können Nebenwirkungen wie Zittern und Bewegungsverlangsamung zur Folge haben. Diese Erscheinungen können sich durch eine Dosisreduktion wieder zurückbilden.
- Eine Kombinationstherapie mit mehreren Neuroleptika bewirkt eine Verstärkung der antipsychotischen und der dämpfenden Wirkung.
- Hinsichtlich der Verkehrstauglickeit ist vor allem Alkoholgenuß streng verboten.
Antidepressiva:Bei hohen Dosierungen und zu Therapiebeginn ist bei Einnahme von Antidepressiva von einer aktiven Verkehrsteilnahme abzuraten. MAO-Hemmstoffe haben im Straßenverkehr eine antriebs- und risikosteigernde Wirkung und schließen ebenfalls eine aktive Verkehrsteilnahme des Patienten auf.
- Die verkehrsrelevanten Wirkungen von Antidepressiva weisen erhebliche Variationen auf. Vor allem bei hohen Dosen und dämpfender Wirkungskomponente zu Beginn der Therapie ist von der aktiven Verkehrsteilnahme grundsätzlich abzuraten. Diese Phase wird mit etwa 10 - 15 Tagen angesetzt.
- Auch bei geringeren Dosen muß sich der Körper auf das neue Medikament einstellen, so daß auch hier von der aktiven Verkehrsteilnahme für 5 - 10 Tage abgeraten werden sollte.
- Als Nebenwirkungen können Kreislaufbeschwerden, Einschränkungen des Sehvermögens, Entzugserscheinungen und schnelle Ermüdung auftreten, die die Fahrtauglichkeit aufheben.
- MAO-Präparate: Bei der (seltenen) Verwendung von MAO (= Mono-aminoxidase)- Hemmstoffen zur Antidepressions-Therapie kann es wegen der antriebssteigernden Wirkung zu risikoreicherem und damit verkehrsgefährdendem Verhalten kommen.
- Außerdem besteht wegen der fehlenden stimmungsaufhellenden Wirkung dieses Medikaments erhöhte Suizidgefahr.
- Deshalb gilt auch bei einer MAO-Therapie ein Ausschluß der Verkehrsteilnahme des Patienten.
- Narkotika: Ambulant verabreichte Betäubungsmittel - z. B. beim Zahnarzt - sowie Schmerzmittel und fiebersenkende Mittel können die Fahrtüchtigkeit (auch bei medikamentös gut eingestellten) depressiven Patienten einschränken.
- Abhängig von der Halbwertszeit der eingesetzten Arzneistoffe sollte für 12 bis 17 Stunden nach der zusätzlichen Medikamentengabe kein Kraftfahrzeug gefahren werden.
Absolutes Alkoholverbot bei der Einnahme von Antidepressiva
- Alkohol ist auch bei der Einnahme von Antidepressiva wegen der verstärkenden Wirkung bei Beabsichtigung der Verkehrsteilnahme absolut verboten.
Verkehrsrelevante Wirkungen von Beruhigungsmitteln (Tranquilizern)
Die Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch Tranquilizer ist dosis- und Halbwertszeitabhängig. Die leistungsmindernde (dämpfend-beruhigende) Wirkung von Tranquilizern wird durch gleichzeitige Einnahme anderer zentral wirksamer Präparate deutlich verstärkt.
Dosierung bei Beruhigungsmitteln als wesentlicher Faktor für die Verkehrssicherheit
- Bei Tranquilizern ist die Abnahme der psychomotorischen Fähigkeiten abhängig von der Höhe der Dosierung und von der Halbwertszeit des Medikaments. (Die Halbwertszeit ist der Zeitraum, in dem die Hälfte der Wirksubstanz freigesetzt wird.)
- Eine Verschlechterung der psychomotorischen Leistungen wurde bereits bei einmaliger Dosierung von 10 bzw. 20 mg Diazepam (z. B. Valium) gefunden; dagegen waren bei einmaligen Dosen von 2 mg Diazepam keine Leistungsveränderungen feststellbar.
Besonderheiten der Benzodiazepin-Gruppe
- Benzodiazepine weisen - besonders bei Präparaten mit mittlerer oder langer Halbwertsszeit - leistungsmindernde Nachwirkungen auf. Hohe Dosen dieser Medikamente führen mit Sicherheit zu einer Wirkungsverstärkung der dämpfenden Anteile. Beide Effekte können mit kurzzeitig wirksamen Benzodiazepinen vermieden werden.
Wechselwirkung mit anderen Medikamenten
- Gleichzeitig eingenommene zentral wirksame Medikamente (z. B. Barbiturate, Neuroleptika oder Antidepressiva) verstärken die Beruhigungswirkung und damit die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit.
Verkehrsuntauglichkeit zu Therapiebeginn und nach langfristiger Einnahme
- Sowohl zu Beginn als auch nach langfristiger Ein-nahme von Beruhigungsmitteln ist eine aktive Verkehrsteilnahme nicht empfehlenswert.
- Zu Beginn der Einnahme ist die individuelle Ansprechbarkeit des Medikamentes noch unbekannt.
- Bei langfristiger Einnahme können sich Unruhezustände, Angst, Zittern, vegetative Symptome und mögliche paranoidhalluzinatorische Symptome einstellen.
Absolutes Alkoholverbot bei der Einnahme von Beruhigungsmitteln
- Auch bei der Tranquilizer-Therapie besteht ein absolutes Alkoholverbot wegen dessen dämpfungsverstärkender Wirkung.
Verkehrsrelevante Wirkungen von Lithium
Bei der Einnahme von Lithium verbietet sich die aktive Verkehrsteilnahme zu Beginn der Therapie. Bei exakter Dosierung und guter medikamentöser Einstellung ist die Verkehrstauglichkeit des Patienten jedoch gegeben.
Bei Therapiebeginn mit Lithium ist die Verkehrsteilnahme nicht möglich
- In der Initialphase der Lithium-Therapie, die zur Vorbeugung wiederkehrender manisch-depressiver Zustände dient, ist die aktive Verkehrsteilnahme wegen des dämpfenden Effektes und der Möglichkeit von Zittern, Übelkeit und Brechreiz nicht angeraten.
Bei Erhaltungsdosis ist die Verkehrsteilnahme möglich
- Unter der Erhaltungsdosis scheint die psychomotorische Leistungsfähigkeit jedoch im Normbereich zu liegen und die Verkehrstauglichkeit kann dann wieder als gewährleistet betrachtet werden.
- Wichtig ist die exakte Einhaltung der verordneten Dosis. Bei Konzentrationen über 1,4
mval/l können die folgenden Symptome auftreten:
- erhebliche Verstärkungen des Dämpfungseffekts,
- grobschlägiges Zittern der Hände sowie
- Krampfanfälle.
- Treten diese Symptome auf, verbietet sich eine aktive Verkehrsteilnahme.
Wechselwirkung mit anderen zentral wirksamen Medikamenten und Alkohol
- Zusätzlich verabreichte zentral wirksame Substanzen sowie zusätzlicher Alkoholgenuß schließen bei der gleichzeitigen Einnahme von Lithium wegen der deutlichen Wirkungsverstärkungen eine aktive Verkehrsteilnahme aus.
VI.Arzneien gegen Anfallsleiden (Antiepileptika)
Bei Antiepileptika haben neben psychophysischen Störungen bei einigen Präparaten vor allem Dosisänderungen und Änderungen des verwendeten
Medikaments verkehrsgefährdende Auswirkungen. Gleichzeitiger
Alkoholgenuß wirkt bei dieser Arzneigruppe erheblich risikoverstärkend.
- Anfall- oder Krampfleiden führen in der Regel zum Entzug der Fahrerlaubnis.
- Die Fahrerlaubnis kann unter folgenden Bedingungen wiedererlangt werden:
- eine erfolgreiche Therapie,
- eine mindestens zweijährige anfallsfreie Zeit sowie
- der sichere Ausschluß von zentralnervösen Nebenwirkungen der medikamentösen Therapie.
- Ständige ärztliche Kontrollen zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit: Daher sind für die Feststellung der Fahrtüchtigkeit eines mit Antiepileptika behandelten Kraftfahrers häufige Blutspiegelkontrollen der eingesetzten Arzneimittel sowie weitere krankheitsspezifische Untersuchungen erforderlich.
Zwei Gruppen von Antiepileptika
- Hinsichtlich ihrer verkehrsrelevanten Aspekte muß zwischen Antiepileptika mit deutlicher Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit und solchen, die diese Gefahr nicht sicher aufweisen, unterschieden werden.
- Antiepileptika mit deutlicher Beeinflussung der Fahrtauglichkeit
- Antiepileptika mit Beeinflussung der Fahrtauglichkeit sind: Phenytoin, Phenobarbital, Primidon, Mesuimid, Clonazepam, Diazepam (z. B. Valium), Nitrazepam sowie Carbamazepin.
- Bei diesen Substanzen kommt es in verschieden starker Ausprägung zu einer zentralen Dämpfung und bei einigen Substanzen zusätzlich zu psychischen Reaktionen.
- Bei Primoiden besteht die Gefahr der Verstärkung von Wesensveränderungen.
- Bei Ethosuximid, Mesuximid und vor allem bei Clonazepam kann es zu aggressiven Reaktionen kommen, die auch nach der Einstellungsphase anhalten können.
- Dosisänderungen und Wechsel des Präparats können bei diesen Substanzen besonders einschneidende Folgen haben.
- Antiepileptika ohne sichere Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit
- Antiepileptika ohne sichere Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit sind:
- Valproinsäure, Trimethadion, Beclamid und Ethosuximid.
- Auch wenn bei der Monotherapie mit diesen vier Substanzen eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit nicht wahrscheinlich ist, kann es unter Valproinsäurebehandlung in Einzelfällen doch zu einer psychischen Beeinflussung -wie gereizter Stimmungslage - und sogar vereinzelt zu Halluzinationen kommen.
- Besonders muß ein striktes Alkoholverbot bei allen Antiepileptika beachtet werden, da bei Alkoholgenuß erhebliche Störungen auftreten können.
VII.Arzneien gegen Allergien (Antihistaminika)
Bei den Antihistaminika sind vor allem die zentraldämpfenden Nebenwirkungen für die Verkehrsteilnahme kritisch. Wechselwirkungen mit anderen zentraldämpfenden Mitteln und Alkohol stellen ein zusätzliches Risikopotential dar.
Wirkungen und Nebenwirkungen von Antihistaminika
- Antihistaminika sind Medikamente zur Eindämmung der allergischen Reaktionen (besonders der Atemwege). Als Folge sind Dämpfung (z. B. durch Promethazin, Diphenhydramin), aber auch Erregung (z. B. durch Astemizol und Terfenadin) möglich. Diese Wirkung erklärt sich durch die strukturelle Verwandtschaft der Antihistaminika mit den Neuroleptika.
Verkehrsteilnahme ist unter der Wirkung von Antihistaminika nur eingeschränkt möglich
- Bei der Mehrzahl der Antihistaminika sollte zum Behandlungsbeginn von einer aktiven Teilnahme am Straßenverkehr abgesehen werden, weil zu diesem Zeitpunkt die dämpfende Wirkung besonders ausgeprägt ist.
- Auch beim Nachlassen der subjektiv empfundenen Dämpfungswirkung ist Vorsicht geboten, da es sich oft lediglich um eine Gewöhnung handelt, während der eigentliche Dämpfungseffekt nach wie vor wirksam ist.
- Tatsächlich gibt es jedoch Unterschiede in der Intensität der Dämpfungswirkung, die medikamentenabhängig sind. Bei einigen Präparaten kann eine Anpassung an die Wirkung des Antihistaminikums und damit eine Verbesserung der Fahrtauglichkeit erreicht werden.
- Die Kombination von Antihistaminika und Koffein kann als besonderes Gefahrenmoment gerade im Straßenverkehr, z. B. bei längeren Autofahrten angesehen werden.
Bei den Antihistaminika muß zwischen Präparaten mit stärkerer und schwächerer Dämpfungswirkung unterschieden werden. Danach richtet sich die Einschränkung der Verkehrstüchtigkeit nach der Einnahme dieser Medikamente.
Antihistaminika mit deutlichem Dämpfungseffekt
- Folgende Antihistaminika weisen eine deutliche Dämpfungswirkung auf:
- Alimemazin
- Carbinoxamin
- Chlorphenoxamin
- Dimenhydrinat
- Doxylamin
- Ketotifen
- Meclozin
- Medrylamin
- Mequitazin
- Oxomemanzin
- Piprinhydrinal
- Promethazin
Antihistaminika mit sehr schwachem Dämpfungseffekt
- Folgende Antihistaminika weisen eine geringe Dämpfungswirkung auf:
- Chlorphenamin
- Clemastin
- Mebhydrolin
- Medrylamin
- Pyrrobutamin
- Terfenadin
- Obwohl bei diesen Substanzen nur in Ausnahmefällen leichte Dämpfungseffekte beobachtbar sind, können unvorhersehbare Wirkungen bei gleichzeitigem Alkoholkonsum nicht ausgeschlossen werden.
Nicht-dämpfende Antihistaminika
- Keine Beeinträchtigung des Fahrverhaltens ist von Azatadin, Cromoglicinsäure, Isothiopendyl, Oxatomid und Tritoqualin zu erwarten.
VIII.Muskelentspannungs-Präparate (Zentrale Muskelrelaxantien)
Die Medikamente dieser Gruppe erzeugen verkehrsgefährdende Dämpfungseffekte und Störungen der peripheren Muskelempfindungen. Gleichzeitiger Alkoholgenuß wirkt risikoverstärkend.
Allgemeine Charakterisierung von Zentralen Muskelrelaxantien
- Medikamente dieses Typs werden zur symptomatischen Therapie von Muskelverspannungen, Beschwerden der Hals-Wirbelsäule, Ischialgien, Gelenkentzündungen etc. eingesetzt. Da diese Beschwerden auch Autofahrer mit großer Kilometerfahrleistung betreffen, haben die Wirkungen der Zentralen Muskelrelaxantien im Verkehrsgeschehen eine signifikante Bedeutung.
- Die allgemeinen Wirkungen der Muskelentspannungs-Präparate sind:
- eine allgemeine Reaktionsdämpfung, sowie
- ein Schwächegefühl der peripheren Muskulatur.
Verkehrsrelevante Wirkungen der Zentralen Muskelrelaxantien mit deutlichen Beeinträchtigungen
- Folgende Substanzen weisen neben einer deutlichen Dämpfungswirkung periphere Schwächegefühle, Gangstörungen und Störungen der Muskelkoordination auf:
- Baclofen
- Carisprodol
- Chlormezanon
- Chloroxazon
- Dantrolen
- Phenyramidol
- Mephenesin
- Methocarbomol
- Orphenadrin
- Phenprobamat
- Bei dieser Gruppe sind Gefühle der Schläfrigkeit und Trunkenheit am stärksten ausgeprägt. Dies stellt vor allem bei längeren Autofahrten ein erhebliches Gefährdungspotential dar.
- Bei der Kombination von Tolbutamid mit Phenyramidol kann es zum Abfall des Blutzuckerspiegels mit starken psycho-physischen Auswirkungen kommen.
- Bei gleichzeitiger Einnahme von Antihypertonika und Baclofen ist ein verstärkter Blutdruckabfall zu beobachten.
Verkehrsrelevante Wirkungen von Zentralen Muskelrelaxantien mit keinem oder geringem Dämpfungseffekt
- Folgende Substanzen weisen nur eine geringe oder gar keine Dämpfungswirkung sowie geringe oder gar keine Störungen der peripheren Muskelempfindungen auf und sind für die Verkehrsteilnahme entsprechend weniger problematisch:
- Pridinol
- Tetrazepam
- Tolperison
IX.Sonstige Medikamente
Die Verkehrstüchtigkeit kann auch beeinträchtigt werden durch Medikamente gegen Reisekrankheit und Durchfall, sowie durch Antiparkinsonmittel und Kurznarkosen.
Wirkungen von Medikamenten gegen die Reisekrankheit
- Bei Symptomen der Reisekrankheit findet auch Meclocin Verwendung, das als Antihistaminikum ebenfalls eine deutlich dämpfende Komponente besitzt.
- Vor allem das zur Bekämpfung von Gastritis, Übelkeit und Erbrechen häufig eingesetzte Metoclopramid, das mit Erfolg auch zur Prophylaxe und Therapie von Reise-krankheit verwendet wird, hat eine erheblich sedierende Wirkung. Es sollte daher von Autofahrern vor und während der Fahrt auf keinen Fall eingenommen werden.
- Das bei chronischen Durchfallserkrankungen eingesetzte Diphenoxylat kann ebenfalls dämpfend wirken.
Wirkungen von Antiparkinsonmitteln
- Von einigen Antiparkinsonmitteln geht eine Verkehrsgefährdung aus, die mit der dämpfenden Nebenwirkung dieser Präparate zusammenhängt. Dies ist besonders zu beachten bei Scopolamin, den synthetischen Anticholinergika, Bromocriptin und den für diesen Zweck eingesetzten Antihistaminika.
- Bei Levodopa sind vor allem die verkehrssicherheitsgefährdenden Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten von Bedeutung.
Wirkungen von Kurznarkosen
- Nach einer kurzen Anästhesie (ambulant oder im Krankenhaus) kann der Patient für die Dauer von etwa 24 Stunden nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen.
Drogen im Straßenverkehr!
Im Drogenrausch
Ob Joint, Aufputschmittel, Ecstasy oder Heroin - Drogen verleihen keine Flügel, sondern führen direkt in den Abgrund - im Straßenverkehr noch schneller als anderswo. Das gilt für illegale Suchtgifte ebenso wie für die legale Droge Alkohol.
Die Wirkung der verschiedenen Drogen lässt sich im Straßenverkehr auf einen gemeinsamen Nenner bringen: Tödliche Gefahr für alle!
Schein und Sein
Die Konzentrationsfähigkeit ist beeinträchtigt bis gar nicht vorhanden, die Reaktionszeit verlängert sich, die Realität wird verzerrt wahrgenommen - der Drogen-Lenker schätzt Situationen nicht richtig ein und handelt daher auch oft falsch.
Bei Aufputschtabletten stellt sich wie auch bei den "koffeinbombigen" Energydrinks nach Nachlassen der Wirkung die Müdigkeit schlagartig ein und Sekundenschlaf kann die Folge sein. Ein besonders gefährliches Gift ist ein "Cocktail" aus Alkohol und Drogen oder eine Kombination von verschiedenen Suchtgiften.
Drogen - nein danke!
Der steigende Drogenmissbrauch wird zwar als gesellschaftliches Problem gesehen, seine gefährliche Auswirkung auf den Straßenverkehr jedoch zu wenig beachtet. Als ersten Schritt, um "Drogen am Steuer" in den Griff zu bekommen, fordert das KfV: Stärkere Aufklärung und eine eindeutige gesetzliche Regelung, die besagt, dass Fahrzeuglenker in ihrem Blut und Harn - dort sind Suchtgifte nachweisbar - keine illegalen Drogen aufweisen dürfen.
Die Wirkung von Alkohol ist allgemein bekannt, ebenso seine Gefährlichkeit im Straßenverkehr. Der Gesetzgeber hat deshalb klare Regelungen geschaffen und den Vollzugsorganen entsprechendes Werkzeug in die Hand gegeben. Der Nachweis der Alkohol ist heute kein Problem mehr.
Die Wirkung von Drogen auf Fahrzeuglenker ist um keine Spur ungefährlicher, doch ist in der Öffentlichkeit darüber kaum etwas bekannt. Auch Exekutivbeamte sind über Drogeneinwirkung auf das Fahrverhalten kaum oder gar nicht informiert. Nur die wenigsten wissen, wie sie vorgehen können, um einem unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeuglenker dies auch nachzuweisen.
" Beifahrer Droge " betitelt der ÖAMTC einen Artikel über Drogenlenker in der Dezember- Ausgabe 1998 seiner Mitgliederzeitung. Einer von 20 Autofahrern sei bereits unter Drogeneinfluss meinte der Autor. Tatsächlich hatte die Wiener Polizei bei Planquadraten 546 Fahrzeuglenker angehalten und dabei 73 unter Alkoholeinfluss vorgefunden, 28 hatten Drogen genommen. Im Gespräch mit Kollegen erfährt man immer wieder, dass diese liebend gerne jene Lenker aussortieren würden, deren Alkotest zwar negativ, deren Fahruntüchtigkeit aber möglicherweise auf Medikamente oder Drogen zurückzuführen ist. Nur das " wie " schreckt die meisten ab. Offensichtlich liegt ein Wissensmanko vor. Dieses Manko ist nicht auf Österreich beschränkt, sondern scheint ein allgemein polizeiliches zu sein.
Was denn mit seinem Fahrstil nicht in Ordnung sei, wollte ein Autofahrer von der Polizeistreife wissen. Diese hatte den Mann gestoppt, weil er Schlangenlinien gefahren war. Ein Alkoholtest bestätigte den anfänglichen Trunkenheitsverdacht nicht. Das sonderbare Verhalten des Verkehrssünders machte die Polizisten argwöhnisch: Er hatte offensichtlich große Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Sein Gang war schwankend, die Bewegungen fahrig und unsicher. Bei einer daraufhin entnommenen Blutprobe wurden nicht weniger als sechs verschiedene unter das Betäubungsmittelgesetz fallende Stoffe festgestellt, darunter Cannabinoide (Haschisch oder Marihuana) und Aufputschmittel (Amphetamine).
Selten liegt der Fall so klar wie hier. Viele Drogenfahrten verlaufen unentdeckt, oder der Drogenkonsum kann nicht nachgewiesen werden. Die Gefahren von Drogen und Medikamenten für die Verkehrssicherheit wurden bislang weiterhin unterschätzt.
Unfallstatistik suggeriert Harmlosigkeit
Die Verkehrsunfallstatistik registriert alljährlich rund 2 Mio.Verkehrsunfälle mit einer halben Million verunglückter Verkehrsteilnehmer. Für 1995 verzeichnete die amtliche Statistik bei nur etwa 10 Prozent der Unfälle mit Verletzten bzw. 18 Prozent der Verkehrstoten Alkoholeinfluss. Experten auf dem Gebiet der Verkehrsmedizin und -statistik gehen jedoch von den ca. doppelt so hohen tatsächlichen Prozentsätzen aus. Die hohe Dunkelziffer unentdeckter Alkoholfahrten und -unfälle ist hinlänglich bekannt.
Noch unglaubwürdiger aber ist die amtliche Statistik bezüglich des offiziell registrierten Einflusses "anderer berauschender Mittel", also der Wirkung von Drogen und Medikamenten als Unfallursache:
Nur 0,14 Prozent (567) der Unfälle mit Personenschaden (388.003) erfassten die Wiesbadener Statistiker 1995 deutschlandweit unter dieser Ursache, mit 864 von insgesamt 521.595 Personen sollen nur 0,16 Prozent aller Verunglückten und nur ganze 16 der 9.454 Unfalltoden auf "andere berauschende Mittel" zurückzuführen gewesen sein.
1.Verkehrsgefährdung durch Cannabis
Cannabis hat vielfältige Wirkungen auf das Fahrverhalten. Die allgemeinen Leistungsbeeinträchtigungen beziehen sich hauptsächlich auf die Bereiche: Fahr- und Hand-Auge-Koordination sowie akustische Signalerkennung und Wahrnehmungsverarbeitung. Zusätzlich konsumierter Alkohol wirkt deutlich risikoverstärkend.
Bedeutung von Cannabis-Missbrauch im Straßenverkehr
- Cannabis-Produkte (besonders Haschisch und Marihuana) sind neben Alkohol die am weitesten verbreiteten Rauschdrogen in Deutschland.
- Wegen seiner seit mehr als zwanzig Jahren herausragenden Bedeutung als Jugend- und Subkultur-Droge sind die Wirkungen von Cannabis auf die Verkehrssicherheit von allen Drogen am umfassendsten untersucht und dokumentiert worden.
Auswirkungen von Cannabis
- Die Wirkstoffkonzentration ist sowohl beim Haschisch als auch beim Marihuana starken Schwankungen unterworfen. Durchschnittlich enthält Haschisch mehr vom Cannabis-Rauschwirkstoff THC als Marihuana.
- Innerhalb weniger Minuten nach der Inhalation eines "Joints" (als Haupt- Konsumform) beginnen die Wirkungen des THC. Das subjektive Wirkungsmaximum wird nach 15 - 20 Minuten erreicht.
- Nach einer einzelnen Zigarette sind die subjektiven Cannabiswirkungen in der Regel nach 2 - 4 Stunden abgeklungen.
- Die psychischen Effekte des THC können unterschiedliche Rauschwirkungen zur Folge haben. Die Fahrtüchtigkeit kann beim typischen Rauschverlauf durch folgende Fakten beeinträchtigt werden:
- Euphorie, Antriebsminderung, Konzentrationsstörungen, Wahrnehmungsstörungen, Denkstörungen, Veränderungen des Zeiterlebens, leichtere Ablenkbarkeit, sowie Störungen der Kritikfähigkeit.
- Beim atypischen Rauschverlauf können zusätzlich folgende Wirkungen die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen: psychopathologische Störungen (Dysphorie, Angst, Panik), innere Unruhe, gesteigerter Antrieb, Verwirrtheit.
Alkohol- und Cannabiswirkungen bei gleichzeitigem Konsum
- Bei gleichzeitigem Alkoholkonsum verstärken sich die Wirkungen des Cannabis. Es kommt darüber hinaus häufiger zu Sprachstörungen, Gangstörungen und verlangsamten Denkabläufen im Vergleich zum ausschließlichen Cannabis-Konsum.
Kontroverse über Cannabis-Wirkungen im Straßenverkehr
- Trotz eindeutiger Belege über die Verhaltensbeeinflussungswirkungen von Cannabis kommt es in dieser Frage immer wieder zu Kontroversen.
Verkehrsgefährdungsprofil von Cannabis
Cannabiskonsum führt zu massiven Leistungsbeeinträchtigungen im Bereich des Zeitgefühls, der optischen und akustischen Wahrnehmung, sowie des Reaktions - und Konzentrationsvermögens.
Verkehrsrelevante Leistungsbeeinträchtigungen durch Cannabis
- Aus den Rausch-Effekten des Cannabis resultieren folgende Leistungseinschränkungen im Straßenverkehr:
1.) Störungen des Zeitgefühls,
2.) Störungen der Bewegungskoordination,
3.) Verlängerung der Reaktions- und Entscheidungszeit (z. B. Fehleinschätzungen der für Überholvorgänge erforderlichen Zeit),
4.) Einschränkung des verkehrsrelevanten Hörvermögens im Sinne der "Signalentdeckung" (schwache Hörreize können aus irrelevanten Hintergrundgeräuschen nicht mehr zuverlässig herausgefiltert werden),
5.) Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit,
6.) Herabsetzung des Farbunterscheidungsvermögens,
7.) verschlechtertes Erkennen von zentralen und peripheren Lichtsignalen und von Details in bewegten Objekten,
8.) Verschlechterung der dynamischen Sehschärfe für bewegte Objekte sowie
9.) Verschlechterung des räumlichen Sehens.
Allgemeine cannabisbedingte Ausfallerscheinungen bei Tests
- Bei experimentellen Untersuchungen ergaben sich nach Cannabiskonsum die folgenden allgemeinen Ausfallerscheinungen (beim Test im Fahrsimulator und im realen Fahrversuch auf der Straße), die die o. g. Leistungsminderungen zusammenfassen:
- Leistungsminderungen bei der Fahrkoordination
- Leistungsminderungen beim "Tracking" (= Damit wird die Fähigkeit bezeichnet, einen Zeiger auf einem bewegten Ziel zu halten. Trackingaufgaben erfordern häufig Hand- Auge-Koordinationen.)
- Leistungsminderungen bei der "Vigilanz" (= Damit ist die Fähigkeit eines Individuums gemeint, seltene Signale bei einer ereignisarmen oder langweiligen Aufgabe zu entdecken und zu beantworten.)
- Leistungsminderungen bei der "Perzeption" (= Darunter versteht man den Vorgang des Auffassens, des Erkennens eines Gegenstandes und zugleich die Vorbereitung für seine Aufbewahrung als Erfahrung.)
Kontroverse über Cannabiskonsum im Straßenverkehr
Während eine holländische Studie zu dem Ergebnis kommt, dass Cannabisgenuss der Verkehrstüchtigkeit keinen Abbruch tut, weisen alle anderen Forschungsergebnisse auf die eindeutigen Gefahren von Cannabiskonsum im Straßenverkehr hin.
Zur Kontroverse über die potentielle Verkehrsgefährdung durch Cannabis
- Anlässlich des spektakulären "Hasch-Urteils" des Bundesverfassungsgerichts vom 9. März 1994 (2 BvL 43/92) wurde die potentielle Verkehrsgefährdung durch Cannabis- Produkte kontrovers diskutiert.
Maastrichter Studie als Befürworter des Cannabisgenusses im Straßenverkehr
- Die Befürworter der Ungefährlichkeit von Cannabiskonsum und Verkehrsteilnahme verweisen auf eine Studie des Instituts für Humane Psychopharmakologie (IHP) der Universität Maastricht, der zufolge ein Joint im Gegensatz zum Alkohol sogar vorsichtiges Fahrverhalten fördern soll.
Argumente gegen die Verkehrsteilnahme nach Cannabiskonsum
- Als Gegenargument sind die nachgewiesenen Beeinträchtigungen durch Cannabiskonsum anzuführen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Schilderung einer psychotischen Episode mit Verkehrsunfall nach Cannabiskonsum, die ein 24jähriger Student nach einem Joint hatte, den er zwei Tage vor dem Unfall geraucht hatte. Festzuhalten bleibt, dass die Wirkungsbreite von Cannabis individuell so große Unterschiede aufweist, dass selbst der Projektleiter der holländischen Untersuchung Cannabisgenuss bei beabsichtigter Verkehrsteilnahme trotz der dortigen Ergebnisse als Risiko bezeichnet.
2.Verkehrsgefährdung durch Opiate
Der alle Reaktionen stark dämpfende Effekt von Opiaten steht einer aktiven Verkehrsteilnahme von Morphin-/Heroinkonsumenten entgegen. Eine besondere Problematik ergibt sich aus den Entzugs-Symptomen von Morphin- / Heroinsüchtigen.
Auswirkungen von Opiatkonsum
- Unter dem Einfluss von Morphin/Heroin ergeben sich die folgenden (teilweise gegensätzlichen) psycho-physischen Auffälligkeiten:
- Euphorie, manchmal auch Dysphorie
- Stimmungslabilität
- Steigerung des Selbstbewusstseins
- Gleichgültigkeit gegenüber Außenreizen
- leichte Benommenheit
- Schläfrigkeit
- Verlängerung der Reaktionszeit
- Konzentrationsschwäche
- stecknadelkopfgroße Pupillenverengung, die in der Dunkelheit bestehen bleibt
Verkehrsrelevante Problematik des Morphin-/Heroinentzugssyndroms
- Morphin und Heroin sind Rauschgifte mit extremem psychophysischem Suchtgefährdungspotential.
Morphin und Heroin erzeugen etwa 6 - 8 Stunden nach dem letzten Drogenkonsum Entzugserscheinungen in Form des "Opiathungers".
- Der Höhepunkt der Entzugserscheinungen tritt nach ca. 36 -7 2 Stunden ein.
- Etwa 8 - 12 Stunden nach der letzten Drogenzufuhr kommen körperliche und weitere psychische Entzugssymptome hinzu, die in den ersten 24 Stunden zunehmen, etwa 72 Stunden anhalten und in den nächsten 5 - 10 Tagen abnehmen.
Psychophysische Entzugserscheinungen von Heroin/Morphin
- Aus der Sucht-Charakteristik dieser beiden Drogen ergibt sich die besondere Problematik der Entzugssymptome, die in den folgenden psychophysischen Bereichen eklatante Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben:
1.) Es kommt zu Pupillenerweiterung und Tränenfluss, gelegentlicher Wahrnehmung von Doppelbildern und Sehstörungen.
2.) Eine "laufende Nase" kann zur Entzugssymptomatik gehören; Niesattacken in Abständen von Minuten bis Stunden sind die Folge.
3.) Der Entzug kann einen gesteigerten Würgereflex währen der ersten Tage auslösen.
4.) Ein Zwang zum häufigen Gähnen geht mit vermehrtem Speichelfluss einher.
5.) Die Atemfrequenz und die bronchiale Schleimproduktion sind gesteigert; es stellt sich ein quälender Husten ein.
6.) Die Herzfrequenz kann gesteigert oder vermindert sein. Herzrhythmusstörungen, Blutdruckerhöhung und Kollapsgefahr stellen sich ein.
7.) Es besteht eine Tendenz zu Gänsehaut, vermehrtem Schwitzen mit kalter, feuchter Haut, Schüttelfrost und Hitzewallungen.
8.) Unkontrolliertes Muskelzittern und Muskelzuckungen, Gelenk-, Knochen- und Muskelschmerzen gehören zum Entzugssyndrom.
9.) Opiathunger erzeugt u. a. Ängstlichkeit, ausgeprägte Ruhelosigkeit, Nervosität, Reizbarkeit, Aggressivität, Schlaflosigkeit und Schlafstörungen, Verstimmungszustände, Depressionen, Dysphorie und Krampfanfälle.
10.) Eine verminderte Harnausscheidung, häufigeres Wasserlassen, Spontanejakulation und -orgasmus gehören ebenfalls zu den Folgen des Opiathungers.
11.) Schließlich lässt sich eine leicht erhöhte Körpertemperatur beobachten.
Verkehrsgefährdungsprofil von Heroin
Heroin dämpft alle Reaktionen des Konsumenten und führt zur Gleichgültigkeit bis hin zur Selbstmordneigung.
Leistungseinschränkungen durch Heroin im Straßenverkehr
- Beim "normalen" Suchtkonsumenten von Morphin oder Heroin fehlen Motivation und Energie für das Alltagsleben. Die Dämpfung aller Reaktionen durch die Opiatwirkung tritt bei Abhängigen häufiger in den Hintergrund. Diese Dämpfung ist nur noch während kurzer Zeitabschnitte am Tag unmittelbar nach der Injektion vorhanden.
- Der "subjektive Normalzustand" des Morphin-/Heroinabhängigen, der die meiste Zeit des Süchtigen-Alltags ausmacht, sieht folgendermaßen aus:
- veränderte Interessenausrichtungen,
- herabgesetzte Motivationslage sowie
- eine manchmal an Selbstmordneigung grenzende Gleichgültigkeit (vor allem sich selbst gegenüber).
- Im Straßenverkehr fallen Morphin-/Heroinabhängige immer wieder durch Schlangenlinienfahren, übermäßige Ermüdung, Erschöpfung bis zur Apathie, fahriges bis unruhiges und unstetes Verhalten und allgemeine psychomotorische Verlangsamung auf. Die Atemalkoholkonzentration beträgt bei Opiat-Abhängigen meist null Promille.
Alkoholgenuss als Risikoverstärkung beim Heroin-Konsum
- Der gleichzeitige Genuss von Alkohol und Heroin wirkt risikoverstärkend, ist jedoch bei Opiat-Konsumenten von geringer Bedeutung.
Zur Einschätzung der Verkehrssicherheit von Methadon-Substitutionspatienten
- Einer BASt-Untersuchung von 1993 zufolge sind Personen, die den Heroin-Ersatzstoff (= Substitution) konsumieren, in der Regel wegen ihrer Persönlichkeitsstörungen und deren Bewertung für das Verkehrsverhalten fahruntüchtig - und weniger wegen psycho-physischer Auffälligkeiten.
Verkehrsgefährdung durch Kokain
Kokain führt wegen seiner gegensätzlichen Wirksamkeit von gesteigerter Risikobereitschaft in der Anfangsphase bis zur (tendenziellen) Apathie in der Schlussphase des Rausches zum Verlust der Fahrtauglichkeit. Gleichzeitiger Alkoholgenuss wirkt risikoverstärkend.
Kokainmissbrauch ist auch im Straßenverkehr zu vermuten
- Wegen der aktuellen Bedeutung der "Modedroge" Kokain, deren Zenit noch nicht überschritten zu sein scheint, ist zu vermuten, dass dieses hochgefährliche Suchtgift inzwischen auch eine (wenngleich statistisch derzeit noch nicht signifikante) Bedeutung im Verkehrsgeschehen haben könnte.
Wirkungsausprägung und Verkehrsgefährdungsprofil von Kokain
- Für die Verkehrstüchtigkeit sind beim Kokainkonsum die drei Stadien des Kokainrausches von besonderer Bedeutung:
1.) Das "euphorische Stadium" zeichnet sich aus durch ausgeprägte Euphorie, Einschränkung der Kritikfähigkeit und des Urteilsvermögens, Antriebssteigerung, erhöhte Risikobereitschaft, Distanzlosigkeit, Abbau von Hemmungen, Unruhe, Reizbarkeit und ein gesteigertes Selbstwertgefühl. Parallel dazu sind Fahrigkeit, mangelnde Konzentration und reduzierte Aufmerksamkeit zu beobachten.
- Aus dieser Gesamtbefindlichkeit resultiert für den kokainkonsumierenden Kraftfahrer eine gefährliche Diskrepanz zwischen subjektiv gesteigertem Leistungsgefühl (z. B. durch Antriebssteigerung oder Abbau von Hemmungen) bei herabgesetztem Leistungsvermögen (z. B. durch Fahrigkeit, mangelnde Konzentration und reduzierte Aufmerksamkeit).
2.) Das euphorische Stadium kann in ein ausgeprägteres "Rauschstadium" übergehen. In diesem kann es zu Trugwahrnehmungen sowie Beziehungs- und Verfolgungswahn kommen.
3.) Im daran anschließenden "depressiven Stadium" kommt es schließlich zu Müdigkeit, Erschöpfung, Ungeduld und Reizbarkeit.
- Aus dieser Symptomkonstellation resultiert, dass Kokain in jedem Rauschstadium ein unkalkulierbares Verkehrsrisiko darstellt.
3.Verkehrsgefährdung durch Amphetamin, "Ecstasy" und Designerdrogen
Amphetamin, Ecstasy und Designerdrogen senken die Verantwortungsbereitschaft und die Fähigkeit zur realistischen Risikoeinschätzung im Straßenverkehr. Gleichze itiger Alkoholgenuss verstärkt die Risiken der Designerdrogen erheblich.
Auswirkungen und Verkehrsgefährdungs-Profil von Amphetamin-Abkömmlingen
- Die typischen Amphetamin-Wirkungen sind:
- Wegfall des Schlafbedürfnisses,
- Beschleunigung der Denktätigkeit und
- Stimulierung von initiativem Handeln.
- Diese Auswirkungen führen im Straßenverkehr zu Fehleinschätzungen des Fahrkönnens und von Verkehrssituationen.
- Besonders ausgeprägt sind die negativen Auswirkungen unter dem Einfluss von Mettamphetamin und Phenmetrazin.
Auswirkungen und Verkehrsgefährdungs-Profil von MDMA ("Ecstasy")
- Die psychophysischen Wirkungen von "Ecstasy" sind folgende:
- Die Pupillen weiten sich stark, oft auf das Doppelte der Normalgröße - sogar bei direktem Lichteinfall.
- Im Gehirn werden Substanzen ausgeschüttet, die ein Gefühl der Verbundenheit und Quasi-Verliebtheit erzeugen.
- Der Kiefer und die Zähne mahlen oft so heftig gegeneinander, dass es schmerzt - als Weigerung des Körpers und der Muskeln gegen eine Entspannung.
- Die Herzfrequenz steigt an.
- Hände und Füße werden zum Auftakt der Drogenwirkung kribbelig und weich. · Verkehrssicherheitsbeeinträchtigende Faktoren sind:
- amphetamin-typische Aufputschwirkungen,
- plötzlich einsetzende Müdigkeitsanfälle und
- bei chronischem Missbrauch die Gefahr von Hirnschäden und psychotischen Wirkungen.
Auswirkungen und Verkehrsgefährdungs-Profil von "Designer-Drogen"
- Viele "Designer-Drogen" enthalten neben Amphetamin-Derivaten noch weitere Stimulantien (z. B. Koffein).
Daher gelten für sie die gleichen Gefährdungsmerkmale wie für Amphetamin-Derivate (vor allem: stimulationsbedingte Fehleinschätzungen des eigenen Fahrkönnens). (siehe oben)
Alkoholgenuss als Risikoverstärkung beim Konsum von "Designer-Drogen"
- Der gleichzeitige Genuss von Alkohol und Designer-Drogen wirkt stark risikoverstärkend.
4.Verkehrsgefährdung durch LSD
LSD erzeugt sehr starke Halluzinationen, die die Realität des Verkehrsgeschehens verfremden. Der LSD-Konsument ist eine akute Gefahr im Straßenverkehr. Alkoholgenuss verstärkt die Risiken des LSDKonsums erheblich.
Auswirkungen und Verkehrsgefährdungs-Profil von LSD
- LSD ist als stärkstes Rauschgift der Gruppe der Halluzinogene für eine völlige Verzerrung und (halluzinatorische) Manipulation der Realität verantwortlich.
- Eine auf einem LSD-Trip" befindliche Person ist für die aktive Verkehrsteilnahme völlig ungeeignet.
Auswirkungen des LSD sind:
1.) Starke Halluzinationen erzeugen massive Störungen des Raum- und Zeitgefühls.
2.) In Abhängigkeit von der psychischen Ausgangslage des Konsumenten, die durch LSD verstärkt wird, kann die Stimmung zwischen euphorisch und depressiv wechseln.
3.) Schweißausbrüche, Kälteschauer, Schwindel, Bewegungsstörungen und andere körperliche Ausfallerscheinungen wechseln sich ab.
4.) Beim "Horror-Trip" kommt es zu panikartigen Zuständen, Verfolgungswahn bis zur Todesangst.
5.) Selbstüberschätzung und Sinnestäuschungen steigern die (oft unbeabsichtigte)
Suizidgefahr - z. B. dadurch, dass ein LSD-Konsument plötzlich glaubt, mit seinem Fahrzeug Hindernisse "überfliegen" zu können.
- Cannabiskonsum kann es auch durch LSD noch Wochen oder Monate nach dem letzten Konsum zu sogenannten "Echo-Psychosen" (= Flashback) kommen.
Alkoholgenuss als Risikoverstärkung beim LSD-Konsum
Auch im Falle des LSD-Konsums wirkt der zusätzliche Genuss von Alkohol erheblich risikoverstärkend
Alkohol im Straßenverkehr
"Don´t drink and drive!" sagen die Amerikaner zu Recht. Wer Alkohol konsumiert hat sollte nicht mehr fahren. In Österreich werden Drogen oder Medikamentenmißbrauch am Steuer meist nur als Folge einer auffälligen Fahrweise sanktioniert.
Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness! Wir möchten Sie im folgenden über die Problematik Alkohol, Medikamente und Drogen im Straßenverkehr informieren.
Medikamente und Drogen können die Fahrtüchtigkeit ebenso wie Alkohol beeinflussen. Selbst bei niedrigen Dosierungen sind "Ausfallerscheinungen" möglich. Besonders gefährlich kann die Wechselwirkung von Alkohol, Medikamenten und Drogen sein! Eine fachliche Beratung über Dosierung und Auswirkungen von Medikamenten ist deshalb für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr unerlässlich. Ähnlich wie beim Alkohol ist auch in diesem Problemfall die Dunkelziffer wahrscheinlich sehr hoch.
Jährlich sterben über 1000 Menschen auf Österreichs Straßen, etwa 50.000 werden verletzt.
Das Führen eines Kraftfahrzeugs stellt immer eine potentielle Gefahr für andere dar. Wenn der Fahrer alkoholisiert oder durch andere berauschende Mittel beeinflußt ist, vergrößert sich die ohnehin bestehende Gefährdung ohne Notwendigkeit noch erheblich. Die Vorstellung, daß allein wegen des Alkohol- oder Drogenkonsums von Einzelnen andere Menschen schwer verletzt oder getötet werden, ist bedrückend.
Die Einsicht, daß doch das Taxi für einen geringen Betrag viel Ärger ersparen kann, sollte nicht erst nach Eintritt eines schwerwiegenden Unfalls einkehren. Ordnungswidrig handelt auch, wer unter der Wirkung eines berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Eine solche Wirkung liegt vor, wenn eine in der Anlage genannte Substanz im Blut nachgewiesen wird. Bei den berauschenden Mitteln genügt für die Tatbestandsverwirklichung also allein der Nachweis eines solchen Mittels im Blut. Eine bestimmte Konzentration ist, anders als bei Alkoholverstößen, nicht erforderlich. Der Verstoß kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Daneben ist in der Regel ein Fahrverbot anzuordnen.
Der Bußgeldkatalog sieht für die erste Zuwiderhandlung ein Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Monat vor. Berauschende Mittel sind Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin und Designer-Amphetamin.
Anfang Jänner 1998 wurde die gesetzliche Grenze für Alkohol am Steuer auch in Österreich auf 0,5 Promille gesenkt. Das bedeutet jedoch nicht, daß Trinken und Autofahren jetzt erlaubt sind! Lenker mit 0,5 Promille haben ein doppelt so hohes Unfallrisiko im Vergleich zu nüchternen. Die Fahrleistung ist bereits eingeschränkt, man fühlt sich beschwipst. Und: Alkoholisierte Fahrer können sich mangels richtiger Selbsteinschätzung in Gefahr bringen und nicht mehr entsprechend reagieren.
Alkohol und seine Folgen:
0,3 Promille: „kurzsichtig" Fehleinschätzung von Abständen, erhöhtes Verkehrsrisiko.
0,5 Promille: „farbenblind" Rot wird nicht mehr richtig wahrgenommen, die Sehleistung ist um 15 % eingeschränkt, die Augen können sich auf Hell-Dunkel-Grenzen nur langsam einstellen.
0,8 Promille: „enthemmt" Gleichzeitig verliert man die Kontrolle über Augenbewegungen; das Blickfeld verengt sich. Reaktionen werden bis zu 50 % langsamer; die Sehkraft ist um 25 % verringert. Verkehrsrisiko vervierfacht.
1,1 Promille: „verwirrt" Verwirrtheit und Sprechstörungen kennzeichnen die 1,1 PromilleGrenze, bei der per Gesetz die absolute Fahruntüchtigkeit beginnt. gesteigerte Enthemmung und maßlose Selbstüberschätzung sind häufig feststellbar. Fahruntüchtigkeit bei jedem Verkehrsteilnehmern, auch ohne Nachweis von Ausfallserscheinungen.
1,5 Promille: Annahme eines chronischen Alkoholismus.
3,0 Promille: "ohnmächtig" Volltrunkenheit - der Körper wehrt sich gegen diese schwere Vergiftung mit Bewußtlosigkeit, das Gehirn meldet "absoluten Filmriß".
Weder Medikamente, Kaffee, die kalte Dusche noch die vermeintlichen Wundermittelchen können den Promillewert im Blut senken, auch wenn man sich danach wieder fit fühlt. Alkohol wird vom Körper nur sehr langsam abgebaut, man rechnet pro Stunde 0,1 Promille. Wer beispielsweise abends um 23 Uhr 1,5 Promille im Blut hatte, hat am nächsten Morgen um 6 Uhr immer noch eine Blutalkoholkonzentration von 0,8 Promille (Restalkohol).
1998 ereigneten sich 28.736 Alkoholunfälle mit Personenschaden, dabei wurden 24.724 Verkehrsteilnehmer/-innen leicht verletzt, 12.645 schwer verletzt und 1.114 getötet.
23 % der alkoholisierten Unfallbeteiligten in Deutschland waren zwischen 18 und 25 Jahren alt, weitere 29 % gehörten zur Gruppe der 25- bis 34-jährigen, 24 % waren zwischen 35 und 45 Jahren alt und 22 % waren über 45 Jahre alt. Fast 2/3 (62 %) der Alkoholunfälle passieren in der Dunkelheit und 50 % von Freitagabend bis Samstagmorgen und von Samstagabend bis Sonntagmorgen.
1997 kam es in Deutschland unter Einfluss "anderer berauschender Mittel", wie z. B. Drogen und Rauschgift, zu 612 Unfällen mit Personenschaden, bei denen 25 Personen getötet und 884 verletzt wurden. Es wird aber allgemein davon ausgegangen, dass die Dunkelziffer der Unfälle unter Drogen- und Medikamenteneinfluss viel höher ist. Laut Aussagen der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren ist ein Anstieg der Drogenakzeptanz und des Drogenkonsums zu registrieren. Einmal erwischt bedeutet im Durchschnitt 800-3000x unter Alkohol gefahren. Der Durchschnitt der Bevölkerung hat eine Wahrscheinlichkeit von 4% für eine Trunkenheitsfahrt, wer schon einmal mit Alkohol aufgefallen ist eine Wahrscheinlichkeit von 30- 40%.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, daß Fahrer, die mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,3 Promille und mehr am Straßenverkehr teilnehmen, an den Konsum großer und nicht mehr kontrollierbarer Alkoholmengen gewöhnt sind.
Bei einem solchen Trinkverhalten ist eine konsequente Trennung von Trinken und Fahren nicht mehr gewährleistet (Kunkel, E.: "Trunkenheitsdelikt und Fahreignung", DAR 56, 2, 1987, S. 41 ff.). Forschungsergebnisse weisen für alkoholauffällige Fahrer eine hohe
Rückfallwahrscheinlichkeit aus (Stephan, E.: "Die Rückfallwahrscheinlichkeit bei alkoholauffälligen Kraftfahrern in der Bundesrepublik Deutschland", ZVS 30, 1984, 1, S. 28 ff.). Darüber hinaus ist nach allen vorliegenden Erkenntnissen anzunehmen, "daß bei BAK-- Werten ab 1,6 Promille eine allgemeine Alkoholproblematik" vorliegt. Das gilt ausdrücklich auch für Personen, die erstmals aufgefallen sind (E. Stephan: "Die Legalbewährung von nachgeschulten Alkoholersttätern in den ersten zwei Jahren unter Berücksichtigung der BAK- Werte", Zeitschr. f. Verkehrssicherheit, 32, 1986; ) In der Bundesrepublik Deutschland wird pro Jahr in mehr als 180.000 Fällen der Entzug der Fahrerlaubnis angeordnet (Statistisches Bundesamt, 1995). Hierbei erfolgt die bei weitem überwiegende Zahl der Fahrerlaubnisentzüge wegen Fahruntauglichkeit infolge vorausgegangenen Alkoholgenusses. Ergibt sich ein begründeter Zweifel an der Fahreignung des Betroffenen, fordert die Verwaltungsbehörde die Einholung eines Sachverständigengutachtens. Bei dieser Begutachtung geht es um die Einschätzung des künftigen Verhaltens des betroffenen Kraftfahrers im motorisierten Straßenverkehr; der Gutachter muß also zu prognostischen Aspekten Stellung nehmen. Diese Prognosegutachten werden derzeit hauptsächlich von den aus den TÜV-Instituten ausgelagerten Medizinisch-Psychologischen Instituten oder vergleichbar organisierten Gesellschaften erstattet. In strittigen Fällen besteht die Möglichkeit, die Einholung eines weiteren Gutachtens durch einen behördlich anerkannten „Obergutachter", zumeist aus Psychiatrischen Universitätskliniken oder Psychologischen Universitäts-Instituten, zu beantragen (zur diesbezüglichen Problematik siehe Zabel u. Comes, 1997).1995 wurden von den TÜV-Instituten mehr als 150.000 Medizinisch- Pschologische Untersuchungen (MPU) erstattet, wobei in annähernd 70% sog. „Alkohol- Fragestellungen" die Begutachtungsanlässe darstellten. In 48,1% der Fälle wurden hierbei die Voraussetzungen für eine Wiedererteilung der Fahrerlaubnis verneint (VdTÜV in Jacobshagen und Utzelmann, 1996). Der Anteil der Personen, die an eindeutig faßbaren und definierten psychiatrischen und/oder neurologischen Erkrankungen - dementiellen Entwicklungen, chronisch verlaufenden endogenen Psychosen oder schweren Abhängigkeitserkrankungen - leiden, beträgt in diesem Gutachtenkollektiv weit unter 5% (ebenda). Müller (1993) zufolge beträgt der Anteil „reiner" Trunkenheitstäter im Straßenverkehr bei den Entziehungen der Fahrerlaubnis mehr als zwei Drittel; in etwa einem Viertel der Fälle komme es hierbei zu wiederholten Auffälligkeit.
Alkohol beeinflußt schon in geringen Mengen unser Verhalten. Bereits ab 0,3 Promille ändert sich unsere Befindlichkeit. Bei 0,5 Promille ist das Unfallrisiko im Straßenverkehr bereits doppelt so hoch wie bei 0,0 Promille. Bei 0,8 Promille gar vier- bis fünfmal höher. Im Bereich von 0,8 Promille steigt die Risikobereitschaft um ca. 80%, Reaktions- und Konzentrationsfehler treten zwei- bis dreimal häufiger auf, die Blickbewegungen des Autofahrers reduzieren sich um 30%, deshalb hat der Fahrer einen Drall zur Fahrbahnmitte.
Die Geschwindigkeitswahrnehmung ist gestört. Bei höheren Dosen führen Gleichgewichtsschwankungen zum Fahren in Schlangenlinie. Verkehrsexperten sind sich über die 0,5 Promille als Gefahrengrenzwert einig. Und meiner Meinung sind auch schärfere Kontrollen wichtig um die Unfälle endlich einzuschränken.
- Cannabiskonsum kann es auch durch LSD noch Wochen oder Monate nach dem letzten Konsum zu sogenannten "Echo-Psychosen" (= Flashback) kommen.
Alkoholgenuss als Risikoverstärkung beim LSD-Konsum
- Auch im Falle des LSD-Konsums wirkt der zusätzliche Genuss von Alkohol erheblich risikoverstärkend.
Rechtliche Aspekte des Drogen- und Medikamentenmißbrauchs
Derzeit existieren für den Bereich der Drogen und Medikamente noch keine gesetzlichen Grenzwerte. Ein Gefährdungstatbestand zur Ahndung von Drogen- und Medikamentenmißbrauch im Straßenverkehr ist in Vorbereitung.
Momentane rechtliche Möglichkeiten bei Drogen- oder Arzneimittelmißbrauch im Straßenverkehr
- Grundsätzlich macht sich jeder strafbar, der ein Fahrzeug führt, obwohl er wegen des Konsums von Alkohol oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen und dadurch Leib und Leben eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet (§ 315 c StGB).
- Noch weiter geht § 316 StGB. Er stellt schon allein das Führen eines Kraftfahrzeug unter den genannten Bedingungen - ohne konkrete Gefährdung - unter Strafe. Außerdem wird einem nach §§ 315 c, 316 StGB Verurteilten die Fahrerlaubnis nach §
69 StGB dann entzogen, wenn sich ergibt, daß er zur Verkehrsteilnahme charakterlich nicht geeignet ist.
- Bei der Begehung von Straftaten nach §§ 315 c, 316 StGB wird in der Regel davon ausgegangen, daß der Täter zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist.
(Quelle: Straßenverkehrsrecht 1993)
- Nach einem Fahrerlaubnisentzug (nach § 69 StGB) erhält der Verurteilte nach Ablauf der Sperrfrist eine neue Fahrerlaubnis nur auf einen entsprechenden Antrag. Bevor dies geschieht, muß die zuständige Verwaltungsbehörde die Kraftfahreignung des Antragstellers erneut prüfen und die Beibringung eines Gutachtens einer amtlich anerkannten medizinisch-psychologischen Untersuchungsstelle anordnen.
Drogen- und Arzneimittelmißbrauch im Straßenverkehr ohne Verkehrsauffälligkeit
- Aufgrund fehlender gesicherter medizinisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnisse existiert bislang im Gegensatz zum Alkohol-Bereich noch keine gesetzliche Grenzwert-Regelung für Drogen und Medikamente.
- Wie die Forschungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, führt der Drogen- und Medikamentenmißbrauch im Straßenverkehr zu deutlichen Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit.
- Diese Tatsache wurde bereits 1985 in der 3. Auflage des Gutachtens des gemeinsamen Beirats für Verkehrsmedizin beim Bundesminister für Verkehr und beim Bundesminister für Gesundheit betont. Darin wurde festgestellt, daß Halluzinogen- Abhängige und regelmäßig Drogen Konsumierende zur Führung von Kraftfahrzeugen ungeeignet sind. Der Deutsche Verkehrsgerichtstag unterstrich 1993 diese Einschätzung.
Gesetzeslücke und Regelungsbedarf für Drogen- und Medikamentenkonsum im Straßenverkehr
- Wegen des derzeitigen Fehlens von gesetzlichen Drogen- und Medikamentengrenzwerten zur absoluten Fahruntüchtigkeit ist die Strafgerichtsbarkeit auf Sachverständigen-Gutachten zur Beurteilung der Fahruntüchtigkeit angewiesen.
- Man verweist bei den notwendigen Klärungsbemühungen dieses Mangels an gesetzlicher Regelung auf die folgenden vier Problembereiche, die die Diskussion um Drogengrenzwerte bestimmen:
"1. Rechtliche und ethische Vorbehalte gegen aussagekräftige umfassende Versuche.
2. Mangelnde Standardisierung von Stoffen und Dosis-Konzentrations- Wirkungsbeziehungen. Das gilt vor allem bei unterschiedlichen Einnahmeformen, bei Kombination mit anderen berauschenden Mitteln und im Zusammenwirken mit Substitutionsstoffen.
3. Probleme der Rückrechnung gemessener Werte auf den Zeitpunkt der Tatbegehung.
4. Auf dem Sektor der Umsetzung in die präventive Polizeiarbeit: Probleme, die zur Untersuchung benötigten Körperflüssigkeiten (Urin und Speichel) in einem praktikablen Verfahren ohne prozessual und verfassungsrechtlich unzulässigen Zwang zur Mitwirkung und Selbstbelastung zu gewinnen."
Rechtsprechung zum Drogenproblem momentan nicht einheitlich
- In der Rechtsprechung herrscht derzeit unterschiedliche Auffassung über Verkehrsbeeinträchtigungen durch Drogeneinfluss.
Gesetzesintitiative in der Diskussion
- Derzeit bereitet das Bundesministerium für Verkehr eine Gesetzesinitiative vor, nach der das Führen von Kraftfahrzeugen unter Drogeneinfluß als Ordnungswidrigkeit - auch ohne Verkehrsauffälligkeiten - geahndet werden soll.
- Im Bereich des Medikamentenkonsums ist zur Zeit keine verbindliche Regelung in Sicht, da die Problematik der Grenze zwischen therapeutischem Erfordernis und Mißbrauch kaum mit gesetzlichen Mitteln zu ziehen ist.
Rechtsprechung zum Drogenproblem im Straßenverkehr
In der Rechtsprechung herrschen derzeit unterschiedliche Auffassungen über Verkehrsbeeinträchtigungen durch Drogeneinfluß.
Medikamente und Drogen schwer nachzuweisen
Im Straßenverkehr lassen sich bei Fahrzeugführern Medikamente und Drogen nur schwer nachweisen. Die vorhandenen Nachweismethoden sind langwierig und aufwendig.
Immunologische Vortests
- Immunologische Vortests dienen dazu, Substanzen von Drogen oder Medikamenten von anderen Körperstoffen zu trennen.
- Diese Vortests können noch keine Auskunft über die Mengen der jeweiligen Substanz im Körper geben.
- Es gibt unterschiedliche Methoden immunologischer Vortests
- Relativ gut geeignet für den polizeilichen Einsatz ist der immunologische Test "Triagen“
Gaschromatographie und Massenspektrometrie
- Nach positivem immunologischen Vortest können mit der Gaschromatographie und der Massenspektrometrie Aussagen über die Mengen der Substanzen von Medikamenten und Drogen gemacht werden.
(Beispiel Deutschland)
In Deutschland ist bei fast jedem zweiten Nachtunfall Alkohol im Spiel, mindestens jeder fünfte Verkehrstote ist Opfer eines "Alkoholunfalls". Wegen Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenmißbrauchs werden in München jährlich ca. 6500 Führerscheine sichergestellt bzw. Fahrerlaubnisse von der Straßenverkehrsbehörde entzogen.
Verordnungen und Polizeikontrollen allein können dieses Problem nicht lösen.
Gerade Alkohol ist bei uns der "Stimmungsmacher Nr. 1". Bei allen möglichen Gelegenheiten werden alkoholhaltige Getränke angeboten. Zum gemütlichen Beisammensein gehört oft gemeinsames Trinken.
Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!
Wir möchten Sie im folgenden über die Problematik Alkohol, Medikamente und Drogen im Straßenverkehr informieren.
Die Rechtslage
Häufig gestellte Fragen zu Medikamente, Drogen und Alkohol im Straßenverkehr
Welche Rolle spielen Medikamente im Straßenverkehr?
Medikamente sollen heilen, aber einige können körperliche Reaktionen und Verhaltensweisen beeinflussen. Besonders Psychopharmaka und Designer-Drogen können gefährlich sein, vor allem bei unkontrollierter Einnahme.
Wie beeinflussen Schmerzmittel die Fahrsicherheit?
Morphinhaltige Schmerzmittel beeinträchtigen die Fahrsicherheit deutlich. Auch nicht-morphinhaltige Schmerzmittel können gefährlich sein, besonders bei Überdosierungen.
Was sind die Risiken morphinartiger Schmerzmittel?
Sie beeinträchtigen das Fahrverhalten stark und schließen eine sichere Verkehrsteilnahme aus. Symptome wie Benommenheit, Stimmungsschwankungen und Atemhemmungen können auftreten. Alkohol verstärkt die negativen Wirkungen.
Welche Gefahren bergen nicht-morphinartige Schmerzmittel?
Überdosierungen sind besonders gefährlich, vor allem bei Acetylsalicylsäure. Erbrechen, Schwindel und Übelkeit können die Leistungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigen. Wechselwirkungen mit anderen dämpfenden Medikamenten können die Wirkung verstärken.
Wie beeinflussen blutzuckersenkende Mittel (Antidiabetika) die Verkehrssicherheit?
Die Hauptgefahr besteht im plötzlichen Absinken des Blutzuckerspiegels (Hypoglykämie). Symptome reichen von Heißhunger bis zur Bewusstlosigkeit. Alkohol und ungewohnte körperliche Belastungen verstärken die Beeinträchtigungen.
Welche Gefahrengruppen von Diabetikern werden in Bezug auf die Verkehrstauglichkeit unterschieden?
Es werden drei Gruppen unterschieden: Diät-behandelte, Diät- und oral behandelte, sowie Diät- und Insulin-behandelte Diabetiker. Die Insulin-behandelte Gruppe ist am meisten durch Hypoglykämie gefährdet und daher eingeschränkt verkehrstauglich.
Welche Risiken birgt eine Überdosierung von Insulin?
Eine Überdosierung kann zu einer Blutunterzuckerung führen. In den ersten drei Monaten einer Insulintherapie sollte nicht am aktiven Straßenverkehr teilgenommen werden.
Welche Auswirkungen haben orale Antidiabetika auf die Verkehrssicherheit?
Das Risiko einer schweren Unterzuckerung ist gering, aber leichte Formen können auftreten. Einige Sulfonylharnstoffe können die Verkehrstauglichkeit negativ beeinflussen. Alkohol verstärkt die Wirkungen erheblich.
Wie beeinflussen blutdrucksenkende Mittel (Antihypertonika) die Verkehrssicherheit?
Bluthochdruck kann das sichere Verkehrsverhalten gefährden. Blutdrucksenkende Mittel können zu Beeinträchtigungen führen. Alkoholgenuss wirkt risikoverschärfend.
Welche Auswirkungen hat unbehandelter Bluthochdruck auf das Fahren?
Es kann zu einer Verstärkung der Bluthochdrucksymptome wie Seh-, Hör- und Gleichgewichtsstörungen kommen. Gravierende Komplikationen wie Schlaganfälle und Herzinfarkte sind möglich.
Welche verkehrsgefährdenden Wirkungen können blutdrucksenkende Mittel haben?
Beta-Rezeptorenblocker in Kombination mit anderen Medikamenten (zentral wirksame Antihypertensiva, Antidiabetika) können Müdigkeit, verlangsamte Pulsfrequenz und Hypoglykämie auslösen. Calciumantagonisten können zu ausgeprägten Pulsfrequenz-Verlangsamungen führen. Diuretika und Vasodilatatoren können ebenfalls Nebenwirkungen haben.
Welche Auswirkungen haben zentralwirksame Antihypertonika?
Sie haben eine ermüdende bis einschläfernde Wirkung und setzen die Konzentrationsfähigkeit herab. Die Fahrtüchtigkeit ist damit eingeschränkt. Zusätzlich konsumierter Alkohol verstärkt die zentral-dämpfende Wirkung.
Wie beeinflussen augenwirksame Arzneien (Ophthalmika) die Verkehrssicherheit?
Sowohl pupillenverengende als auch pupillenerweiternde Arzneimittel führen zu Einschränkungen des Dämmerungssehens und der Sehschärfe sowie zu erhöhter Blendungsgefahr. Auch andere Medikamente können Nebenwirkungen auf die Augen haben.
Welche Auswirkungen haben pupillenverengende Mittel (Miotika)?
Sie schränken das Dämmerungssehen und die Sehschärfe ein und können negative Wirkungen auf Herz und Zentralnervensystem haben.
Welche Auswirkungen haben pupillenerweiternde Mittel (Mydriatika)?
Sie bewirken eine Verminderung der Sehschärfe und führen zu erhöhter Blendungsgefahr sowie zu einem beschleunigten Puls. Die Einnahme ist mit einer aktiven Verkehrsteilnahme nicht zu vereinbaren.
Welche Nebenwirkungen anderer Medikamente können die Augen beeinträchtigen?
Blutzuckersenkende Mittel, Kortisontherapie, Entwässerungsmittel, Psychopharmaka und Schmerzmittel können die Sehleistung beeinträchtigen.
Wie wirken Psychopharmaka auf das Verkehrsverhalten?
Alle Arten von Psychopharmaka haben Auswirkungen auf das Verkehrsverhalten, wenn sie nicht kontrolliert und dosiert eingenommen werden. Alkohol verstärkt die Risiken stark.
Welche verkehrsrelevanten Wirkungen haben Schlaf- und Dämpfungsmittel (Hypnotika und Sedativa)?
Schlafmittel haben erhebliche psychomotorische Leistungseinschränkungen zur Folge und erlauben keine aktive Verkehrsteilnahme. Auch einzelne Dämpfungsmittel heben die Fahrtüchtigkeit auf.
Welche Auswirkungen haben Mittel gegen Psychosen (Neuroleptika) auf die Verkehrssicherheit?
Vor allem zu Beginn der Neuroleptikatherapie und bei akuten psychotischen Schüben ist eine aktive Verkehrsteilnahme nicht möglich. Im therapeutischen Rahmen ist die Wirkung von Neuroleptika auf lange Sicht jedoch verkehrssicherheitsfördernd.
Welche Auswirkungen haben Antidepressiva auf die Verkehrssicherheit?
Bei hohen Dosierungen und zu Therapiebeginn ist von einer aktiven Verkehrsteilnahme abzuraten. MAO-Hemmstoffe haben im Straßenverkehr eine antriebs- und risikosteigernde Wirkung und schließen ebenfalls eine aktive Verkehrsteilnahme des Patienten auf.
Welche verkehrsrelevanten Wirkungen haben Beruhigungsmittel (Tranquilizer)?
Die Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit durch Tranquilizer ist dosis- und Halbwertszeitabhängig. Die leistungsmindernde Wirkung wird durch gleichzeitige Einnahme anderer zentral wirksamer Präparate deutlich verstärkt.
Welche verkehrsrelevanten Wirkungen hat Lithium?
Bei der Einnahme von Lithium verbietet sich die aktive Verkehrsteilnahme zu Beginn der Therapie. Bei exakter Dosierung und guter medikamentöser Einstellung ist die Verkehrstauglichkeit des Patienten jedoch gegeben.
Wie beeinflussen Arzneien gegen Anfallsleiden (Antiepileptika) die Verkehrssicherheit?
Bei Antiepileptika haben neben psychophysischen Störungen bei einigen Präparaten vor allem Dosisänderungen und Änderungen des verwendeten Medikaments verkehrsgefährdende Auswirkungen. Gleichzeitiger Alkoholgenuss wirkt erheblich risikoverstärkend.
Wie beeinflussen Arzneien gegen Allergien (Antihistaminika) die Verkehrssicherheit?
Bei den Antihistaminika sind vor allem die zentraldämpfenden Nebenwirkungen für die Verkehrsteilnahme kritisch. Wechselwirkungen mit anderen zentraldämpfenden Mitteln und Alkohol stellen ein zusätzliches Risikopotential dar.
Wie beeinflussen Muskelentspannungs-Präparate (Zentrale Muskelrelaxantien) die Verkehrssicherheit?
Die Medikamente dieser Gruppe erzeugen verkehrsgefährdende Dämpfungseffekte und Störungen der peripheren Muskelempfindungen. Gleichzeitiger Alkoholgenuß wirkt risikoverstärkend.
Welche sonstigen Medikamente können die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigen?
Die Verkehrstüchtigkeit kann auch beeinträchtigt werden durch Medikamente gegen Reisekrankheit und Durchfall, sowie durch Antiparkinsonmittel und Kurznarkosen.
Wie gefährlich sind Drogen im Straßenverkehr?
Drogen beeinträchtigen die Konzentrationsfähigkeit, verlängern die Reaktionszeit und verzerren die Realitätswahrnehmung. Das Fahren unter Drogen ist tödlich gefährlich.
Welche Auswirkungen hat Cannabis auf das Fahrverhalten?
Cannabis hat vielfältige Wirkungen auf das Fahrverhalten. Die allgemeinen Leistungsbeeinträchtigungen beziehen sich hauptsächlich auf die Bereiche: Fahr- und Hand-Auge-Koordination sowie akustische Signalerkennung und Wahrnehmungsverarbeitung. Zusätzlich konsumierter Alkohol wirkt deutlich risikoverstärkend.
Welche Auswirkungen haben Opiate auf das Fahrverhalten?
Der alle Reaktionen stark dämpfende Effekt von Opiaten steht einer aktiven Verkehrsteilnahme von Morphin-/Heroinkonsumenten entgegen. Eine besondere Problematik ergibt sich aus den Entzugs-Symptomen von Morphin- / Heroinsüchtigen.
Welche Auswirkungen hat Kokain auf das Fahrverhalten?
Kokain führt wegen seiner gegensätzlichen Wirksamkeit von gesteigerter Risikobereitschaft in der Anfangsphase bis zur (tendenziellen) Apathie in der Schlussphase des Rausches zum Verlust der Fahrtauglichkeit. Gleichzeitiger Alkoholgenuss wirkt risikoverstärkend.
Welche Auswirkungen haben Amphetamin, Ecstasy und Designerdrogen auf das Fahrverhalten?
Amphetamin, Ecstasy und Designerdrogen senken die Verantwortungsbereitschaft und die Fähigkeit zur realistischen Risikoeinschätzung im Straßenverkehr. Gleichzeitiger Alkoholgenuss verstärkt die Risiken der Designerdrogen erheblich.
Welche Auswirkungen hat LSD auf das Fahrverhalten?
LSD erzeugt sehr starke Halluzinationen, die die Realität des Verkehrsgeschehens verfremden. Der LSD-Konsument ist eine akute Gefahr im Straßenverkehr. Alkoholgenuss verstärkt die Risiken des LSDKonsums erheblich.
Welche Auswirkungen hat Alkohol auf das Fahrverhalten?
Alkohol beeinflußt schon in geringen Mengen unser Verhalten. Bereits ab 0,3 Promille ändert sich unsere Befindlichkeit. Bei 0,5 Promille ist das Unfallrisiko im Straßenverkehr bereits doppelt so hoch wie bei 0,0 Promille. Bei 0,8 Promille gar vier- bis fünfmal höher.
Wie sieht die Rechtslage bezüglich Drogen- und Medikamentenmissbrauchs im Straßenverkehr aus?
Derzeit existieren für den Bereich der Drogen und Medikamente noch keine gesetzlichen Grenzwerte. Ein Gefährdungstatbestand zur Ahndung von Drogen- und Medikamentenmißbrauch im Straßenverkehr ist in Vorbereitung.
Wie werden Drogen und Medikamente im Straßenverkehr nachgewiesen?
Im Straßenverkehr lassen sich bei Fahrzeugführern Medikamente und Drogen nur schwer nachweisen. Die vorhandenen Nachweismethoden sind langwierig und aufwendig. Es werden immunologische Vortests und Gaschromatographie/Massenspektrometrie eingesetzt.
- Quote paper
- Nicoletta Visconti (Author), 2001, Medikamente, Drogen und Alkohol im Straßenverkehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100539