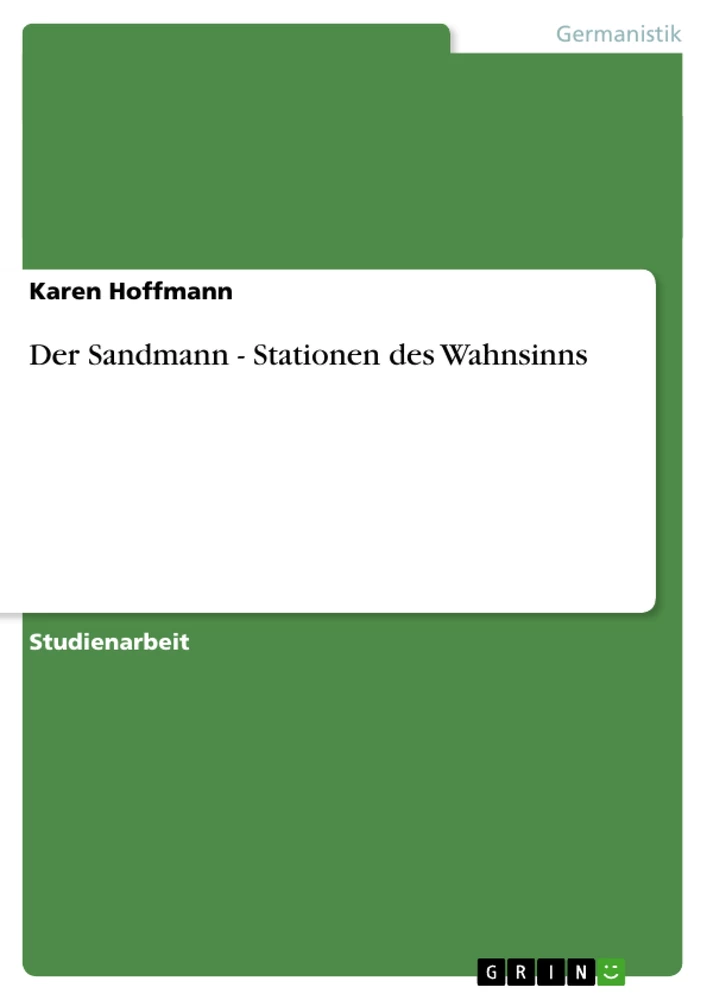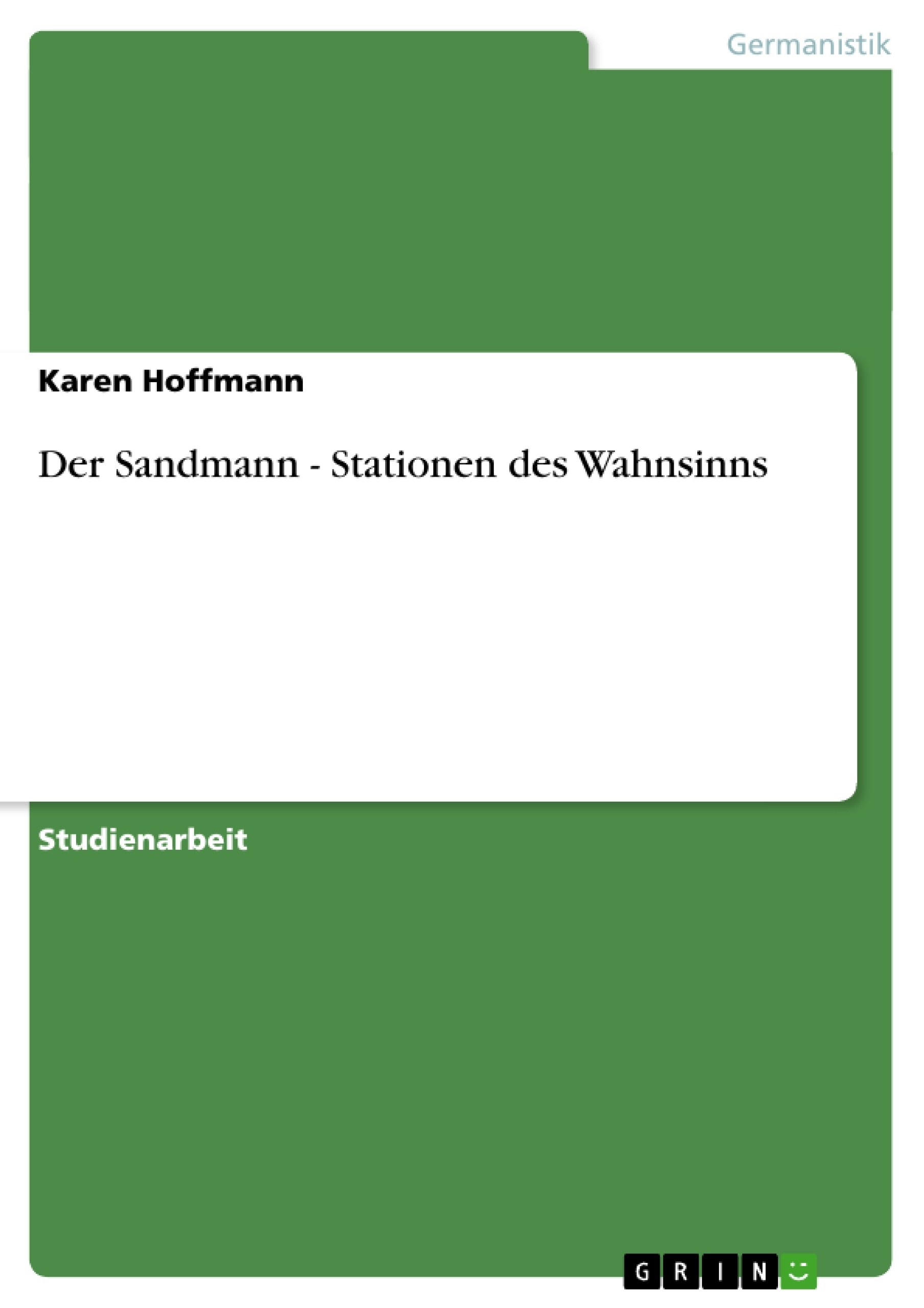Die Erzählung „Der Sandmann“ von E.T.A. Hoffmann erschien 1816 als erste Erzählung im ersten Teil des Sammelbandes „Nachtstücke“. Dieser erste Teil trägt jedoch wie der zweite die Jahreszahl 1817. Eine vorausgehende Einzelausgabe in einer Zeitschrift ist nicht nachgewiesen. Diesen Zyklus beherrscht eines der großen romantischen Themen, das Interesse für die "Nachtseiten der Natur", für das Unheimliche, Krankhafte und Verbrecherische. „Der Sandmann“ ist die bekannteste Erzählung der Sammlung. Die erste Niederschrift der Erzählung wurde „d. 16. Novbr. 1815 Nachts 1 Uhr“ begonnen. Diese Mitteilung stammt von Hoffmann selber. Gegenüber der endgültigen Fassung unterscheidet sich die erste vor allem durch einen ausführlicheren Schluß und durch die Existenz einer zusätzlichen Greuelgeschichte des Coppelius gegenüber der Schwester Nathanaels.
Die frühe Rezeption des „Sandmann“ war weitgehend durch das abwertende Urteil des Aufklärers Walter Scott geprägt und die Erzählungen Hoffmanns bis tief ins 20. Jahrhundert kaum beachtet. Der Erzählung wurde auch Uneinheitlichkeit vorgeworfen, während heute hingegen die Multiperspektivität der Darstellung im positiven Sinne als ein konstitutives Merkmal des Textes angesehen wird.
Sigmund Freud analysiert den „Sandmann“ in seiner Studie über das Unheimliche und bringt die Angst vor dem Augenraub mit der Kastrationsangst in Verbindung. Die Diskussion, die daraus erwachsen ist, macht Hoffmanns erstes Nachtstück zu einer seiner meist besprochenen Erzählungen, beliebt bei den Interpreten verschiedenster wissenschaftstheoretischer Ausrichtung.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Nathanaels Kindheit
- 2.1 Der Vater
- 2.2 Die Mutter
- 2.3 Die Amme
- 3. „Nathanaels Frauen“
- 3.1 Clara
- 3.2 Olimpia
- 4. Coppelius, Coppola und Spalanzani
- 4.1 Der Advokat Coppelius
- 4.2 Der Wetterglashändler Coppola
- 4.3 Der Professor Spalanzani
- 5. Symbolik
- 5.1 Die Augen
- 5.2 Der Feuerkreis
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ mit dem Fokus auf die Ursachen und Bedingungen für Nathanaels Wahnsinn. Die Analyse geht der Frage nach, ob und wie sich die Rezeption des Unheimlichen seit Freuds Interpretation verändert hat. Dabei wird die Kindheit Nathanaels und seine Beziehungen zu wichtigen Figuren detailliert betrachtet.
- Nathanaels Kindheitserfahrungen und deren Einfluss auf seine psychische Entwicklung
- Die Rolle der verschiedenen Figuren (Coppelius, Coppola, Spalanzani, Clara, Olimpia) im Kontext von Nathanaels Wahnsinn
- Die Symbolik in der Erzählung, insbesondere die Bedeutung der Augen und des Feuerkreises
- Die Interpretation des „Sandmanns“ im Lichte psychoanalytischer und literaturwissenschaftlicher Ansätze
- Die Frage nach der Kontinuität und Veränderung der Rezeption des Unheimlichen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Entstehungsgeschichte und die Rezeptionsgeschichte von E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“ ein. Sie beleuchtet die frühe, überwiegend negative Rezeption, geprägt von Walter Scotts Urteil, im Kontrast zur heutigen Betrachtung, die die Multiperspektivität der Erzählung als konstitutives Merkmal wertschätzt. Die Arbeit wird auf die Frage nach den Bedingungen für Nathanaels Wahnsinn fokussiert, wobei die zahlreichen Interpretationen der Erzählung, von psychoanalytischen bis hin zu literaturwissenschaftlichen Ansätzen, als Herausforderung und Bereicherung gleichermaßen hervorgehoben werden.
2. Nathanaels Kindheit: Dieses Kapitel analysiert die prägenden Kindheitserfahrungen Nathanaels. Es wird seine bürgerliche Herkunft, die Rolle seines berufstätigen Vaters und seiner fürsorglichen Mutter, sowie die Bedeutung der Amme thematisiert. Die Abende im Arbeitszimmer des Vaters, geprägt von wechselnden Stimmungen und dem Erzählen von Geschichten, werden als zentrale Momente hervorgehoben. Diese Kindheitserinnerungen werden im Kontext der späteren Ereignisse und der Entwicklung von Nathanaels Wahnsinn gedeutet.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Wahnsinn, Unheimliches, Kindheit, Psychoanalyse, Augen, Symbolik, Interpretation, Multiperspektivität, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen zu E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine akademische Arbeit zu E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ursachen und Bedingungen für Nathanaels Wahnsinn und der Rezeption des Unheimlichen in der Erzählung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Kindheit Nathanaels und deren Einfluss auf seine psychische Entwicklung. Sie analysiert die Rolle wichtiger Figuren wie Coppelius, Coppola, Spalanzani, Clara und Olimpia im Kontext von Nathanaels Wahnsinn. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Symbolik in der Erzählung, insbesondere der Bedeutung der Augen und des Feuerkreises. Die Arbeit betrachtet verschiedene Interpretationsansätze, von psychoanalytischen bis hin zu literaturwissenschaftlichen Perspektiven, und untersucht die Kontinuität und Veränderung der Rezeption des Unheimlichen seit Freuds Interpretation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einleitung, die die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte von "Der Sandmann" beleuchtet; ein Kapitel über Nathanaels Kindheit, das seine prägenden Erfahrungen und deren Bedeutung für seine spätere psychische Entwicklung analysiert; ein Kapitel zu den Frauen in Nathanaels Leben (Clara und Olimpia); ein Kapitel über die Figuren Coppelius, Coppola und Spalanzani; ein Kapitel zur Symbolik in der Erzählung (Augen und Feuerkreis); und schließlich ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Wahnsinn, Unheimliches, Kindheit, Psychoanalyse, Augen, Symbolik, Interpretation, Multiperspektivität, Rezeption.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Ursachen und Bedingungen für Nathanaels Wahnsinn in "Der Sandmann" zu untersuchen. Sie analysiert, wie sich die Rezeption des Unheimlichen seit Freuds Interpretation verändert hat und betrachtet dabei die Kindheit Nathanaels und seine Beziehungen zu den wichtigsten Figuren der Erzählung.
Wie wird die Rezeption des Unheimlichen behandelt?
Die Arbeit untersucht, ob und wie sich die Rezeption des Unheimlichen in "Der Sandmann" seit Freuds Interpretation verändert hat. Sie vergleicht frühe, oft negative Rezeptionen mit der heutigen Betrachtungsweise, die die Multiperspektivität der Erzählung als konstitutives Merkmal wertschätzt.
- Quote paper
- Karen Hoffmann (Author), 2001, Der Sandmann - Stationen des Wahnsinns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10045