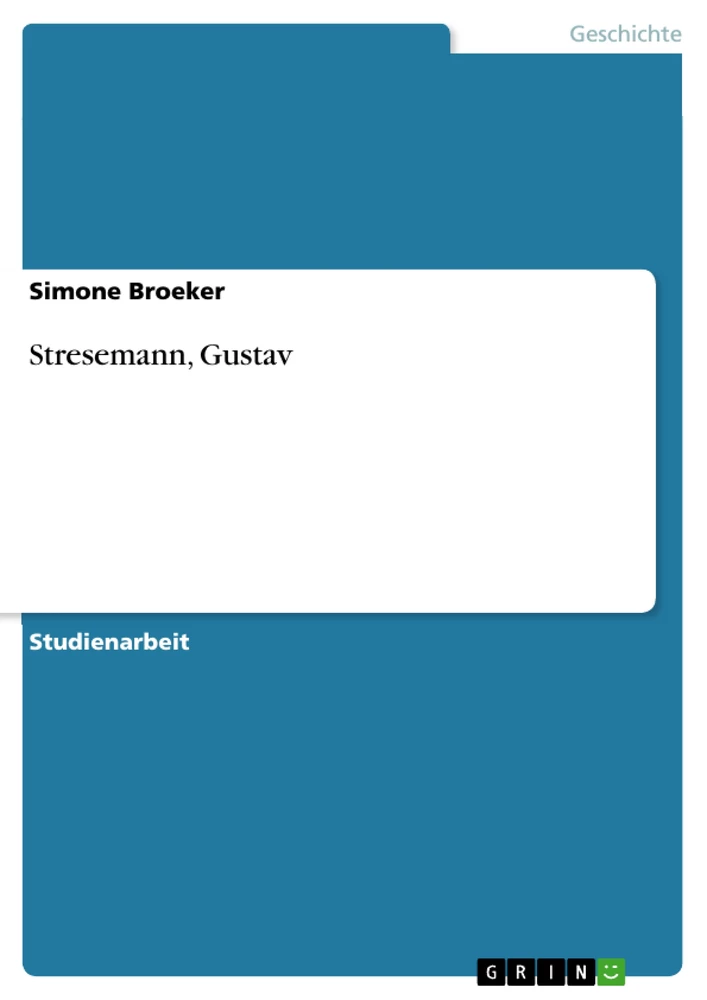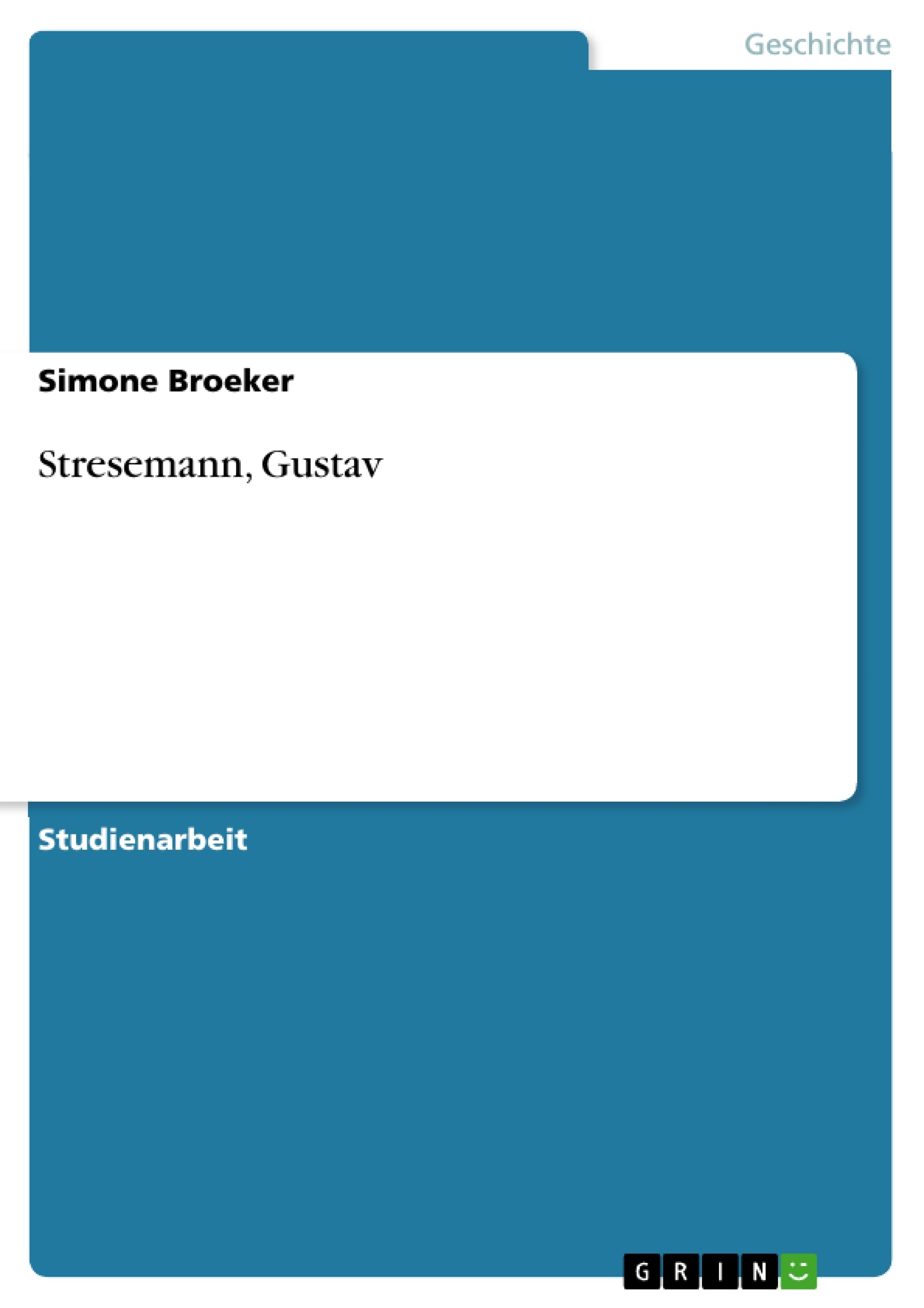Was verbirgt sich wirklich hinter dem „Geist von Locarno“? Tauchen Sie ein in die intrigenreiche Welt der europäischen Diplomatie der 1920er Jahre, in der Gustav Stresemann, der deutsche Außenminister, eine Schlüsselrolle spielte. Diese packende Analyse enthüllt die wahren Motive und Strategien Stresemanns während der Konferenz von Locarno im Oktober 1925. Anhand von zwei zentralen Quellen, dem umstrittenen „Kronprinzenbrief“ und Stresemanns Rede zum Abschluss der Konferenz, wird untersucht, ob Stresemann tatsächlich vom nationalen Revisionspolitiker zum überzeugten Europäer und Friedensapostel mutierte. Die Untersuchung beleuchtet Stresemanns Forderungen und Ziele in Locarno, die notwendigen Zugeständnisse Deutschlands und die Hoffnungen, die er mit dem Vertrag verband. Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern Stresemanns vermeintlicher Wandel vom Monarchisten zum Vernunftrepublikaner und vom Annexionisten zum Friedenspolitiker authentisch war oder ob es sich lediglich um eine taktische Anpassung an die politischen Realitäten handelte. Die Analyse enthüllt, wie Stresemann die deutsch-russischen Beziehungen als Mittel zum Zweck einsetzte, um die deutschen Revisionsforderungen voranzutreiben und die Beziehungen zu den Westmächten zu verbessern. Locarno erscheint hier als ein Schachzug in einem komplexen politischen Spiel, bei dem es darum ging, Deutschland von den Fesseln des Versailler Vertrages zu befreien und den Großmachtstatus wiederzuerlangen. Es wird auch die Bedeutung des persönlichen Kontakts zwischen Stresemann und Briand, dem französischen Außenminister, für den Verlauf der Konferenz hervorgehoben. Abschließend wird bewertet, inwieweit Stresemanns Visionen und Hoffnungen durch die Realität der Nachkriegszeit getrübt wurden. Die Analyse zeichnet ein vielschichtiges Bild von Stresemann als einem pragmatischen Politiker, der stets die nationalen Interessen Deutschlands im Auge behielt, auch wenn er dafür den Weg der friedlichen Verständigung beschritt. Das Buch bietet somit einen neuen Blick auf die Locarno-Konferenz und die deutsche Außenpolitik der 1920er Jahre. Schlagwörter: Gustav Stresemann, Locarno, Außenpolitik, Weimarer Republik, Versailler Vertrag, Revisionismus, Deutsch-Französische Beziehungen, Europäische Geschichte, Zwischenkriegszeit, Diplomatie, Völkerbund, Kronprinzenbrief, Friedensnobelpreis, Aristide Briand, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, Dawes-Plan, Reparationen, Rheinland, Sicherheitspakt, Nationalismus, Pazifismus, Internationale Politik, Geschichte, Politikwissenschaft, Friedensforschung, Europäische Integration, 20 Jahrhundert.
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit soll einen tiefergehenden Einblick in die außenpolitische Konzeption des deutschen Außenministers Gustav Stresemann auf der Konferenz von Locarno im Oktober 19251 ermöglichen. Hierbei wird auf der Basis zweier Quellen vom 7. September 1925 und vom 16. Oktober 1925, die zum einen den sehr umstrittenen ,,Kronprinzenbrief" und zum anderen die Rede Stresemanns beim Schlußakt der Locarno-Konferenz zum Inhalt haben, gearbeitet2. Die Zielsetzung wird die Erläuterung der Motivation der Stresemannschen Außenpolitik sein. Herausgefunden werden soll, ob sich Stresemann durch den sagenumwobenen ,,Geist von Locarno" vom auf die nationalen Interessen Deutschlands ausgerichteten Revisionspolitiker zum ,,guten Europäer" und ,,Friedensapostel"3 entwickelt hat. Der Schwerpunkt der Arbeit wird bei der Beantwortung von vier, zu den Quellen gestellten Fragen liegen, die durch eine Analyse der in den Quellen gegebenen Situation den Gesamtzusammenhang herstellen soll. Ob die allgemeine Entrüstung bei der Veröffentlichung des vertraulichen Kronprinzenbriefes 19324 gerechtfertigt war, oder ob es nur die Unterstreichung dessen war, was Stresemann ohnehin nie verheimlicht hatte, wird von besonderem Interesse sein.
Die Einordnung der Quellen in größere Zusammenhänge erläutert den weiteren Verlauf der Ereignisse. In der Schlußbemerkung werden schließlich gewonnene Erkenntnisse kurz zusammengefaßt und interpretiert.
Bevor die Arbeit aber mit Hilfe der Situationseinführung in die Thematik einsteigt sei noch kurz ein Hinweis in eigener Regie gegeben: Die Beantwortung der Fragen in Kapitel 3 setzt die Quellen als bekannt voraus. Die Textsicherung und der Nachweis der benutzten Edition sind bereits erbracht, so daß in dem genannten Kapitel auf Anmerkungen in Form von Fußnoten bei sinngemäßer Übernahme von Informationen aus den beiden Basisquellen aus Platzgründen abgesehen wird.
2. Situationseinführung
2.1 Kurzer Überblick der Vorgeschichte
Das deutsch-französische Verhältnis, das bereits seit der Niederlage Frankreichs im Krieg von 1870/71 stark vorbelastet war und sogar lange Jahre als ,,Erbfeindschaft" deklariert wurde, erreichte auch nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrages am 28.6.1919 keinerlei Besserung. Obwohl der in der deutschen Öffentlichkeit als ,,Schanddiktat" mit größter Empörung aufgenommene Vertrag das Deutsche Reich wirtschaftlich, militärisch und politisch enorm schwächte und vornehmlich Frankreich als Nutznießer präsentierte, beherrschte nach wie vor die Angst vor einer deutschen Revanche das politische Geschehen in Frankreich5. Um seinem erhöhten Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden, fossierte Frankreich am Tag der Unterzeichnung des Versailler Vertrages die Paraphierung von Beistandsgarantien mit England und den USA, welche aber vom amerikanischen Senat abgelehnt wurde6. Generell versuchte Frankreich in den ersten Nachkriegsjahren die Schwächung des ,,besiegten, potentiell jedoch überlegenen Gegners"7 auszubauen, da des einen Stärke in der Unterlegenheit des anderen gesucht wurde.
Auch der Vorsitzende der Deutschen Volkspartei (DVP), Gustav Stresemann, stimmte zu diesem Zeitpunkt überzeugt in den Chor der Vertragsgegner ein und bildete somit keine Ausnahme innerhalb der vorherrschenden öffentlichen Meinung im Deutschen Reich8. Obwohl er schon im Oktober 1919 vor der Nationalversammlung erklärte, daß Deutschland momentan nicht anders könne, als den Vertrag zu erfüllen, wollte er sich jedoch nicht dem allgemeinen Pessimismus beugen und die Lage als grundsätzlich ausweglos einzuschätzen9. Bestärkt wurde er in dieser Meinung von der - zu diesem Zeitpunkt jedoch noch zu frühen10 - Einsicht, daß Frankreich in wirtschaftspolitischer Hinsicht auf Deutschland angewiesen sein würde, also einen wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands durch immense Forderungen und Bestimmungen aus eigenem Interesse nicht zulassen könne: ,,Frankreich wird in dem Augenblick trotz Clemenceau die Notwendigkeit einsehen müssen, sich mit uns wirtschaftlich zu verständigen, wenn die Lüge des Schlagwortes erkannt wird: L`Allemagne payera tout.[...] Ich glaube, der Haß wird dann der wirtschaftlichen Vernunft weichen."11 Bereits Anfang 1920 entwickelte Stresemann, der als oppositioneller Politiker noch wenig Einfluß auf die offizielle Außenpolitik ausüben konnte, eine persönliche Strategie für die Zukunft, die bei der notwendigen Anerkennung des Versailler Vertrages trotzdem die friedliche Revision der Bestimmungen ,,als wünschenswertes Ziel jeder nationalen deutschen Außenpolitik"12 ins Auge faßte. Da er unlängst die deutschen Chancen auf wirtschaftlichem und finanziellem Sektor erkannt hatte und sich in Bezug auf die politischen und militärischen Kapazitäten Deutschlands keine Hoffnungen machte, erschien ihm der Weg der Gewaltpolitik von vornherein als undurchführbar und außerdem unverantwortlich. Die Grundsatzfrage, von der nach Stresemanns Ansicht die außenpolitischen Geschicke ganz Europas abhängen würde und die zugleich die Durchsetzungskraft des Reiches wiederherstellen sollte, lag in der Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland13. Daß Stresemann mit dieser Vermutung nicht gänzlich falsch lag, wird sich im weiteren Verlauf der geschichtlichen Ereignissen bestätigen.
Neben den wirtschaftlichen Ansatzpunkten für eine deutsche Außenpolitik konkretisierte sich für Stresemann sehr schnell die Nutzbarkeit des russischen Gefahrenpotential des Bolschewismus, der den Bestand der west- und mitteleuropäischen Staatenwelt zu bedrohen in der Lage schien14. Besonders Frankreich fürchtete eine etwaige deutsch-russische Zusammenarbeit.
Hiermit konnte Stresemann den zweiten entscheidenden Hebel, der Deutschland zum wichtigen Verhandlungspartner für die Entente zu etablieren vermochte, in Bewegung setzen15. Praktisch zeigte sich dies beispielsweise in der 1920 aufgestellten Forderung Stresemanns, ,,sofort in Handelsbeziehungen mit Sowjetrußland einzutreten"16. Wie vorsichtig die deutsche Außenpolitik aber diesen Trumpf handhaben mußte, ließ der ,,Streich von Rapallo" auf der Wirtschaftskonferenz in Genua 1922 erkennen, der die ohnehin gespannten deutsch-französischen Beziehungen zusätzlich belastete und unter anderem für die Besetzung des Ruhrgebiets Anfang 1923 verantwortlich zeichnete. Zwar hatte sich durch diesen deutsch-russischen Vertrag, den Stresemann durchaus wohlwollend aufnahm, die außenpolitische Manöverierfähigkeit des Reiches potentiell vergrößert, doch akzentuierte der zukünftige deutsche Außenminister, daß die Geschicke Deutschlands trotzdem von dem Verhalten der Westmächte abhängen würden17. Das nach dem Sturz der Regierung Aristide Briands einberufene Kabinett unter Ministerpräsident Poincare´ zeigte sich gegenüber den deutschen Bestrebungen nach steter Revision des Versailler Vertrages nicht sehr aufgeschlossen und pochte weiterhin auf die Erfüllung aller Bestimmungen. Da von Frankreich momentan folglich wenig zu erwarten war, baute Stresemanns Konzeption vornehmlich auf das wirtschaftliche Interesse Englands und der USA an Deutschland18. Entgegen vieler Meinungen spekulierte Stresemann dabei weniger auf die etwaige Uneinigkeit der Entente-Mächte, um im geeigneten Augenblick einen Keil in diese Koalition zu treiben. Er hatte eine umfassende Neuregelung des Reparationsproblems im Auge, die unter der wirtschaftlichen Führung der USA möglich werden sollte19. Denn unlängst hatte auch Stresemann herausgefunden, daß die meisten Siegerstaaten und auch Neutrale wirtschaftlich litten und neben einer Wiederbelebung der Weltwirtschaft wohl auch die deutschen Reparationszahlungen sehnsüchtig erwarten dürften20. Außerdem mußte auch Frankreich, wenn es die eingeforderten Zahlungen erhalten wollte und zudem nicht die Beziehungen zu den beiden angelsächsischen Staaten, die aufgrund der erläuterten wirtschaftlichen Eigeninteressen einem Kompromiß nicht abgeneigt schienen, gefährden wollte, einem neuen Arrangement zugunsten Deutschlands offener gegenüberstehen21.
Stresemanns Anekdote ,,von einem hochverschuldeten Dresdner, der der gesündeste Mensch der Stadt gewesen sei, weil ihm jeder Gläubiger sofort einen Spezialarzt geschickt habe, sobald er nur am Telefon hustete"22, zeigte die Konzeption des Außenpolitikers auf: Auch die Gläubiger sind im hohen Maße von ihrem Schuldner abhängig. Eine Einsicht, die nunmehr Bewegung in die festgefahrene Kontroverse zwischen Frankreich und Deutschland bringen sollte und zudem die Chancen für eine günstige Entwicklung auf internationaler Ebene bereit hielt.
2.2 Auf dem Weg nach Locarno
Bereits während des Ruhrkampfes 1923 hatte Stresemann, der mittlerweile das Amt des Reichskanzlers innehatte, die entscheidende Wendung innerhalb der Außenpolitik erreicht:
Die von ihm angestrebte Internationalisierung des Reparationsproblems wurde von Frankreich selbst in Bewegung gesetzt: Schon lange hatten die beiden angelsächsischen Mächte die französische, starrsinnige Ruhrpolitik mit wachsendem Mißmut beobachtet und festgestellt, daß Frankreich weniger auf die Zahlungen aus war, sondern vielmehr die Zersplitterung Deutschlands vorantreiben wollte23. London und Washington waren von dieser Politik, die herbe wirtschaftliche und politische Folgen in sich barg, keineswegs angetan, so daß sich der bereits 1922 vom amerikanischen Außenminister Charles Hughes geäußerte Plan, eine unabhängige Expertenkommission zur Lösung des Reparationsproblems einzusetzen, mehr und mehr etablierte.
Während sich damit die Grundvoraussetzung der Stresemannschen Idee zu erfüllen schien, hielt sich der Enthusiasmus auf französischer Seite verständlicherweise in Grenzen: Poincare´ fürchtete, daß das französische Sicherheitsbedürfnis hinter den finanziellen Interessen der USA zurückbleiben würde24. Unter dem Druck Englands und der USA mußte Frankreich aber schließlich der Bildung eines Komitees zustimmen, daß Mitte Januar 1924 seine Arbeit aufnahm. ,,Die anglo-amerikanischen Mächte, auf deren ökonomische Interessen Stresemann sein Revisionskalkül gegründet hatte, wurden endlich aktiv, um die Bereinigung der Reparationsfrage in die Wege zu leiten".25
Bereits seit dem 30. November 1923 bekleidete Stresemann unter der Regierung Marx das Amt des Außenministers. Als am 9. April 1924 der Dawes-Plan - das Gutachten der Expertenkommission - veröffentlicht wurde, war diese der erste große Durchbruch für Stresemann: Sein auf weltwirtschaftliche Verflechtungen angelegter Entwurf der neuen deutschen Außenpolitik tat mit Hilfe des Dawes-Plan die ersten kleinen Schritte in Richtung Verständigung26. Und diese Verständigung mit den ehemaligen Kriegsgegnern, vor allem mit Frankreich, war für Stresemann die allererste Voraussetzung für eine mögliche Revision des Versailler Vertrages und die Wiederherstellung des deutschen Großmachtstatus27. Denn dies war seit jeher - und daraus machte er auch kein Geheimnis - Stresemanns erklärtes Ziel. Neben weitreichenden Innovationen in bezug auf die Reparationen sah der Dawes-Plan auch die Wiederherstellung der deutschen Wirtschaftseinheit ( Räumung der Ruhr binnen eines Jahres) vor. Praktisch bedeutete dies das Ende der französischen Sanktionspolitik, da die deutschen Reparationen nur an Frankreich gehen würden, wenn auch sie den Dawes-Plan vorbehaltlos anerkennen würden28. Zusätzlich erhielt Deutschland durch die Anerkennung seiner Reparationsverpflichtungen die Garantie seiner territorialen Einheit. Der größte Erfolg, den Deutschland indes mit dem Dawes-Plan verbuchen konnte, war die Zusage einer internationalen Anleihe über 800 Millionen Goldmark, durch die sich die Chance auf einen wirtschaftlichen Wiedereinstieg beträchtlich vergrößerte und außerdem auch die USA (als hauptsächlichen Geldgeber) finanziell an das Deutsche Reich band29. Doch bevor schließlich am 5. August 1924 der Dawes-Plan auf der Londoner Konferenz beschlossen wurde, hatte Stresemann mit enormen innenpolitischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ebenso wie in Frankreich wurde die politische Meinung der deutschen Öffentlichkeit von starken nationalistischen Strömungen beherrscht, die jeweils den anderen Staat als bevorzugt ansahen und sich selbst übervorteilt fühlten. Dennoch entpuppten sich die internationalen Umstände als durchaus fruchtbare Verhandlungsgrundlage, da sich gerade sowohl in England als auch in Frankreich ein ,,Linksruck" bei den Staatsoberhäuptern vollzog30. Eine seltene Chance, die wohl auch auf der Londoner Konferenz, bei der Deutschland erstmalig als gleichberechtigter Partner anwesend war, zum erfolgreichen Votum für den Dawes-Plan beitrug31.
. ,,Mit den Londoner Beschlüssen traten auch die deutsch-französischen Beziehungen in eine neue Phase ein. [...] Die Politik der Diktate hatte einer Ära vertraglicher Vereinbarungen Platz gemacht."32 Das Inkrafttreten des Dawes-Plan hatte für die deutsche Außenpolitik eine ergiebige Verhandlungsgrundlage geschaffen, auf der man sich nun zügig dem Ereignis entgegen bewegte, daß zum Synonym einer ganzen Ära wurde: Locarno. Mit Hilfe der ersten zu bearbeitenden Quelle steigt die vorliegende Arbeit nun etwa vier Wochen vor Beginn der Locarno-Konferenz in die Diskussion der geschichtlichen Ereignisse ein, um die außenpolitische Motivation Stresemanns zu untersuchen.
3. Analyse der außenpolitischen Motivation Stresemanns in Form einer Diskussion ausgewählter Quellen
3.1 Der ,,Kronprinzenbrief"
3.1.1 Wie sind die von Stresemann aufgestellten Forderungen und Ziele, die er in Locarno zu verwirklichen gedenkt, einzuschätzen?
Bereits seit dem 9. Februar 1925 liefen die Vorverhandlungen zu Locarno33. Die Initiative zu einem neuen Sicherheitssystem war dabei eindeutig von Stresemann ausgegangen, der durch das deutsche Angebot eines Sicherheitsmemorandums an Frankreich einer Ratifizierung des Genfer Protokolls und somit einer etwaigen Erneuerung der Entente Cordiale entgegenwirken wollte34. Über ein halbes Jahr lösten sich die deutschen und französischen Antwortnoten ab, gekennzeichnet von den steten gegenseitigen Versuchen, dem anderen Zugeständnisse abzutrotzen und selbst die nationalen Interessen möglichst unverändert durchzusetzen35.
Obwohl in der Forschung sehr umstritten und kontrovers beurteilt36, zeigt der vorliegende
Brieftext Stresemanns an Kronprinz Wilhelm in annähernder Vollständigkeit die Zielvorstellungen des deutschen Außenministers auf. Stresemann teilt dabei den bevorstehenden Kraftakt von Locarno in drei Hauptaufgaben ein, die sich neben dem ,,Schutz der Auslandsdeutschen" und der ,,Korrektur der Ostgrenzen" vornehmlich mit der Lösung der Reparationsfrage beschäftigen. Letzteres gilt - wie schon oben erläutert wurde - als Grundvoraussetzung für den angestrebten wirtschaftlichen und politischen Aufstieg Deutschlands. Doch insbesondere die Stellungnahme Stresemanns zur Wiedergewinnung der deutschen Gebiete im Osten und der zusätzliche ,,Anschluß von Deutsch-Österreich" an das Reich zeigt eindeutig sein deutsches Großmachtdenken auf. Hinsichtlich der angestrebten Ostpolitik erklärt sich die revisionistische Grundstimmung Stresemanns in diesem Brief: Ohne eine Beendigung der französischen Besatzung, also das ,,Freiwerden deutschen Landes", ist zum einen keine ergiebige nationale Realpolitik zu verrichten, geschweige denn eine für Deutschland erträgliche Lösung hinsichtlich der Reparationen zu erreichen. Für Stresemann sind die gesteckten Ziele objektiv gesehen nur durch den in einem Monat in Locarno zu verhandelnden Sicherheitspaktes zu erreichen. So ist ihm zu diesem Zeitpunkt aus der französischen Antwortnote Briands bereits bekannt, daß England sich zum Garanten der deutschen Westgrenze bereit erklärt, was sich von englischer Seite aber nicht aus Uneigennützigkeit vollzogen hatte (die Garantie der deutschen Ostgrenze lehnte es ja bekanntermaßen ab).37 Während Stresemann in dieser Quelle den leichten ,,Pro-Deutschland- Kurs" Londons während der Vorverhandlungen mit der ungeliebten Vormachtstellung Frankreichs im Völkerbund erklärt, lag das eigentliche Interesse Englands an Deutschland woanders: Obwohl Stresemann im Kronprinzenbrief, der ja ganz offensichtlich nicht der Öffentlichkeit in die Hände fallen sollte, vor einer zu intensiven Annäherung an Rußland warnt, wurde die englische Politik von dem Versuch, Deutschland an das ,,eigene Lager zu binden", beherrscht und kam somit den nationalen Interessen Deutschlands entgegen38. So stellte auch der italienische Botschafter in London, Torretta, während der Vorverhandlungen fest, daß die englischen Beweggründe für den anstehenden Rheinpakt nur sehr begrenzt in der Sicherung des Status quo im Westen zu finden waren39. Tatsächlich versuchte London, indem es Deutschland in das ,,europäische Konzert" der Mächte zurückführen wollte, eine deutsch- russische Verbindung zu unterbinden und Moskau zu isolieren40. Die Vorsicht Rußland gegenüber, die Stresemann in dieser Quelle zu verifizieren versucht, müßte demnach eigentlich unbegründet sein, weil das Zusammenwirken von einem Sicherheitsangebot an Frankreich (Befriedigung der französischen Sicherheitsbedürfnisses) auf der einen Seite und die allseits bekannten Beziehungen zu Rußland (Rapallo) auf der anderen Seite anscheinend erst die wohlwollende Grundlage für die Vorverhandlungen zu Locarno geschaffen hat41. ,,Stresemann begriff die deutsch-russischen Beziehungen (in der Konsequenz seiner ,,Balancepolitik") vorrangig als Mittel zu Zweck, d.h. als Instrument für ständig zu verbessernde deutsch-angelsächsische bzw. deutsch-französische Beziehungen - und zwar mit dem Ziel, dadurch die deutschen Revisionsforderungen der Verwirklichung näherzubringen."42
Da auch auf Seiten der Alliierten, ja sogar bei Briand43, unlängst bekannt war, daß Stresemanns Ziel die friedliche Revision des Versailler Vertrages war und blieb, können seine - zugegeben- weitreichenden und selbstbewußten Forderungen und Ziele im Kronprinzenbrief eigentlich niemanden überraschen44. Die Quelle gibt Anlaß zu der Annahme, daß auch Locarno für Stresemann Mittel zum Zweck sein wird, Deutschland soweit wie möglich von den ihm auferlegten Zwängen zu befreien und den ,,Würger" zu entfernen.
3.1.2 Welche notwendigen Zugeständnisse von Seiten Deutschlands kündigt Stresemann an?
In Bezug auf die Konzessionen, die Deutschland ohne Zweifel während der Verhandlungszeit zu leisten bereit sein mußte, hält sich Stresemann sehr bedeckt. Besonders der bevorstehende Beitritt Deutschlands zum Völkerbund, auf dem Frankreich und England während der Vorverhandlungen strikt bestanden hatten, gerät in der Quelle fast zum dankenswerten Privileg, obwohl Deutschland sich dem zunächst - mit Blick auf Rußland - widersetzt hatte45.
Die Erklärung für diesen Sinneswandel lag, wie Stresemann ja im Brief selbst bekundet, in der Erkenntnis, daß sich der Völkerbund auch durchaus positiv für Deutschland auswirken konnte. So sieht er einen hervorragenden Vorteil in der Möglichkeit, daß das Reich mit Hilfe des Völkerbundes ,,alle die Fragen, die dem deutschen Volk auf dem Herzen brennen" auf europäischer Ebene zur Sprache bringen kann, wie z.B. ,,Fragen der Kriegsschuld, allgemeine Abrüstung, Danzig, Saargebiet".
Die in der deutschen Öffentlichkeit allseits existenten Befürchtungen, Deutschland käme innerhalb des Völkerbundes durch ewige Überstimmungen nicht zum Zuge, zerstreut Stresemann durch den Übereinstimmungsmodus im Völkerbundsrat, in dem Deutschland ein ständiger Sitz von Seiten Englands und Frankreichs bereits zugesichert worden war46. In ebensolchem beschwichtigendem und auch verharmlosenden Ton begründet Stresemann den Verzicht der kriegerischen Auseinandersetzung mit Frankreich bezüglich Elsaß- Lothringens mit der Unmöglichkeit einer solchen Kampfhandlung. Dies stimmte zwar in der Tat mit den militärischen Gegebenheiten im Reich überein, doch der Dreh- und Angelpunkt seiner Argumentation liegt beim lediglich ,,theoretischen" Verzicht auf Elsaß-Lothringen. Zwischen den Zeilen ist also durchaus zu erkennen, daß Stresemann eine friedliche Einigung diesbezüglich nicht zu verwerfen gedenkt. Doch wie deckt sich diese Äußerung mit dem eigentlich ja freiwilligen Verzicht Deutschlands?47
Der Schlüssel, der sowohl diese Ungereimtheit, als auch die überaus nationalistische Rhetorik Stresemanns in diesem Brief aufklärt, ist in der Untersuchung des Adressaten dieser Quelle zu finden. Der ehemalige Kronprinz Wilhelm, Empfänger dieses Briefes, gehört bekanntermaßen zum monarchistisch-nationalistischen Lager Deutschlands. Die Außenpolitik, die Stresemann spätestens seit dem Dawes-Plan verfolgte, stieß innerhalb dieses Lagers, bei dem es sich nicht nur um eine kleine Minderheit handelte, auf heftige Abwehr und ließ den deutschen Außenminister während der Vorverhandlungen zu Locarno mehrere Male an den Rand der politischen Isolation geraten48. Insbesondere die Rechtsopposition, aber auch die DNVP- Minister betrieben eine harte Agitation gegen den außenpolitischen Kurs Stresemanns49. So besiegelte dann der Verzicht auf Elsaß-Lothringen definitiv den Haß der Nationalisten auf Stresemann.
Diese innenpolitischen Schwierigkeiten können nun den verharmlosenden Ton des Außenministers den Verzicht betreffend erklären: Er zeigt auf, daß es sich bei diesem Zugeständnis ja lediglich um eine Untersagung der kriegerischen Lösung handele, welches aber die Rückgewinnung des Gebietes auf dem Verhandlungsweg ganz und gar nicht ausschließe. Tatsächlich war für Stresemann aber, wie sich in Locarno herausstellte, die Sache längst vom Tisch und die bagatellisierende Interpretation der Klausel eine ,,innenpolitische Beruhigungspille"50 für seine Gegner.
Nach nahezu gleichem Schema verfährt Stresemann in der Quelle mit der Befürchtung, Deutschland habe sich durch den Eintritt in den Völkerbund auf den Westen fixiert. In Rechtskreisen war zu diesem Zeitpunkt der Wunsch nach einem militärischen Bündnis mit Rußland sehr populär51. Ein entsprechendes Angebot Rußlands während der Vorverhandlungen lehnte Stresemann jedoch ab, wohl in der Annahme, der Zeitpunkt sei ungünstig und könne die gesamten Verhandlungen platzen lassen. Da er aber, wie bereits erläutert, selber diesen russischen Trumpf zielsicher für seine Politik einzusetzen wußte, stellt er hier im Kronprinzenbrief eindeutig heraus, daß Deutschland sich durch den Eintritt in den Völkerbund weder für die Orientierung nach Osten noch nach Westen entschieden habe: ,,Die Frage des Optierens zwischen Osten und Westen erfolgt durch unseren Eintritt in den Völkerbund nicht." Die Erklärung, daß man zwar kein deutsch-russisches Bündnis einzugehen gedachte, sich aber auch ebensowenig zum ,,Kontinentaldegen für England" machen lassen wollte, mochte besagte Kreise zwar nicht befriedigen, aber eventuell - durch das Argument der fehlenden militärischen Macht - ruhigstellen.
Stresemann hatte indes aber schon längst erkannt, daß gerade durch den bevorstehenden Sicherheitspakt die Lösung der Ostprobleme (durch eine Trennung der Westprobleme, Verzicht auf ein ,,Ost-Locarno") in greifbare Nähe rückten und somit der Pakt einer deutschrussischen Zusammenarbeit durchaus nicht widersprach52, wie sich spätestens beim Berliner Vertrag 1926 herausstellen sollte.
Die nationalistische Rhetorik und die harschen Zielsetzungen Stresemanns in dieser Quelle, die bei ihrer Veröffentlichung 1932 enormen Wirbel verursachte und insbesondere in Frankreich die Skeptiker auf den Plan rief53, könnten also im Hinblick auf den Adressaten erklärt werden und dürften demnach der Sichtweise vom ehrlichen Wandel Stresemanns ,,vom Monarchisten zum Vernunftrepublikaner und vom Annexionisten zum Friedenspolitiker"54 keinen Abbruch tun. Natürlich mußte Stresemann gegenüber ,,dem Kronprinzen und anderen nationalistischen Adressaten, die er von der Notwendigkeit seiner Politik überzeugen mußte"55, einen anderen Ton anschlagen, als beispielsweise bei der Verleihung des Friedensnobelpreises.
Dennoch bleibt eine Frage bestehen: Worin soll Stresemann die Veranlassung, den ehemaligen Kronprinzen von seiner Politik zu überzeugen, gesehen haben? De facto hatte dieser keinerlei politische Kompetenzen in Deutschland, seitdem mit Ausbruch der Novemberrevolution 1918 die Republik ausgerufen worden war; er konnte also nicht in den Entscheidungsprozeß während der Vorverhandlungen eingreifen. Hinzu kommt die Tatsache, daß Stresemann, getrieben von der Furcht, der Brief könne in ,,fremde Hände" fallen, nicht unterschreibt. Genügend Hinweise also, die den Anschein erwecken, daß Stresemann in der vertrauten Atmosphäre des Briefwechsels seine wirkliche Meinung über die Verständigungspolitik offenbart habe und aus realpolitischen Überlegungen eine ,,Erfüllungsund Verzichtpolitik"56 nur vortäuschte.
3.2 Stresemanns Rede beim Schlußakt der Locarno-Konferenz
3.2.1 Wie ist dieser sehr euphorische Vortrag Stresemanns zu verstehen und einzuschätzen?
Ganz im Gegensatz zum etwa einen Monat zuvor verfaßten Kronprinzenbrief zeigt die Schlußrede Stresemanns den deutschen Außenminister von einer völlig neuen Seite. Fast schon ein wenig pathetisch muten die von ihm gewählten Sätze an, in denen er ,,aufrichtig und freudig" die ,,große Entwicklung des europäischen Friedensgedanken" herausstellt und Locarno als den ,,Anfang einer Periode vertrauensvollen Zusammenlebens der Nationen" bezeichnet. So sei gerade für Europa das friedliche Nebeneinander der Staaten von entscheidender Bedeutung.
Hat der sagenumwobene ,,Geist von Locarno" Stresemann innerhalb von zehn Tagen vom Deutschen zum Europäer ,,umgepolt" oder gibt der deutsche Außenminister (im Hinblick auf die zuvor behandelte Quelle) eine Kostprobe seiner etwaigen Schauspielkunst? Was war geschehen?
Betrachtet man die verschiedensten zeitgenössischen Ausführungen und Quellen, so haben sie in Bezug auf Locarno eines gemeinsam: Sie alle heben den ,,neuen Konferenzstil"57 und die Höflichkeit, Vertrauen und guten Willen ausstrahlende Atmosphäre unter den Delegierten hervor58. Schon in der Sitzordnung - alle Anwesenden saßen gleichberechtigt um einen großen Tisch herum - zeigte sich, daß es ,,keine Sieger und keine Besiegten mehr geben"59 sollte, wie der französische Ministerpräsident Edouard Herriot schon hinsichtlich des DawesPlan prophezeit hatte. ,,Die Deutschen erschienen diesmal nicht als Angeklagte oder Bittsteller, sondern als gleichberechtigte Gesprächspartner."60
Doch insbesondere der enge persönliche Kontakt zwischen Stresemann und Briand, der sich für die weitere Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen als enorm fruchtbar und bedeutungsvoll erwies, nahm hier in Locarno seinen Lauf61. So war es immer wieder Briand, der es durch Humor und Ironie schaffte, prekäre oder peinliche Situationen aus der vermeintlichen Sackgasse zu bugsieren62. Stresemann, dem diese Art der Verhandlungsführung ganz offensichtlich gefiel, hegte von daher sehr schnell Sympathie für den französischen Außenminister, wodurch die ganze Konferenz sehr zum Positiven beeinflußt wurde63. Die zahlreichen persönlichen Kontakte zwischen allen Beteiligten, sowie auch die Möglichkeit der privaten Besprechungen steuerten das Übrige zum Gelingen der Konferenz bei64.
Dennoch darf man bei der Betrachtung Locarnos unter diesen erfreulichen Gesichtspunkten nicht vergessen, daß es sich um einen ungeheuren Kraftakt handelte, wie Stresemann später selbst erklärte: ,,Man soll sich die Dinge nicht so vorstellen, als ob wir unter der Sonne Locarnos in einem neuen Freundschaftsbund umhergetaumelt wären."65 Tatsächlich sind die Verhandlungen in sehr beharrlicher und zielbewußter Art und Weise geführt worden, denn schließlich waren ja sowohl Stresemann als auch Briand als Vertreter ihres Landes nach Locarno gekommen: ,,Zweifellos zielte Stresemann als ein ,,Bismarck der Niederlage" [...] auf nationale Größe und Stärke; genauso wollte Briand die durch Versailles führende Position Frankreichs erhalten und mit kollektiven Mitteln sichern."66
Besonders das Rededuell zwischen Briand und Stresemann über den Artikel 16 der Völkerbundssatzung streifte die ,,[...] Grenze des politisch Möglichen [...], sei aber in so vornehmer Form geführt worden, daß Herr Briand sich selbst außerordentlich anerkennend über das Rededuell ausgesprochen habe [...]"67, wie Stresemann in seinem Locarno-Tagebuch vermerkte.
Insgesamt gesehen war die Konferenz von Locarno für Stresemann ein voller Erfolg. Er, der auch schnelle Erfolge aufgrund seiner innenpolitischen Feinde aufweisen mußte68, hatte neben einer - zwar nur sehr unverbindlichen - Zusage Briands, sich hinsichtlich der von Deutschland geforderten Rückwirkungen des Paktes für eine baldige Räumung des Rheinlandes einzusetzen, auch ein ,,Ost-Locarno" verhindern können69. Auch in der Auslegung des Artikels 16 der Völkerbundssatzung gelang es Stresemann, die deutsche Position gegenüber Rußland zu wahren70. Sie hätten in Locarno hundertprozentig alles erreicht, was sie sich vorgenommen hätten, rief demnach auch Luther nach seiner Rückkehr in einem erregten Augenblick. Noch nie habe eine Delegation einen solchen Erfolg gehabt71. Somit kann der euphorische und enthusiastische Ton Stresemanns in der vorliegenden Quelle durch zweierlei erklärt werden: Zum einen hatte sich der entspannte Konferenzstil und der persönliche Kontakt zu Briand sehr positiv auf Stresemann ausgewirkt, so daß man mit Recht davon ausgehen kann, daß er in der Schlußrede seine wahren Gefühle ausdrückt. Zudem muß man sich die Kulisse, vor der der Vertrag paraphiert wurde, vor Augen halten: Nach der Unterzeichnung traten Briand, Stresemann und Chamberlain, begleitet vom Glockengeläut, auf dem Balkon des Rathauses einer jubelnden Menge entgegen, die im Freudentaumel den neuen Frieden feierte72. Ein Eindruck, dem sich sicherlich auch Stresemann nicht entziehen konnte.
Zum anderen sah Stresemann, wie oben erläutert, die politischen Erfolge, die er in Locarno erreicht hatte und zu Hause vorweisen konnte. Trotzdem muß man hinzufügen, daß Stresemann - beseelt von dem eigenen Wunschdenken, sowie von den berauschenden Eindrücken und Erfahrungen der Konferenz - vieles des Gesagten überbewertete und die Schwierigkeiten, denen man zweifelsohne auch ausgewichen war, in den Hintergrund drängte73. Nur so ist auch das ungewohnt europäische Vokabular Stresemanns zu erklären.
3.2.2 Welche Hoffnungen verbindet Stresemann mit dem Vertrag von Locarno?
Der deutsche Außenminister bringt in dieser Quelle zu Ausdruck, daß die deutschen Delegierten von dem ehrlichen Wunsch begleitetet werden, ,,daß die auf das Werk gesetzten Hoffnungen sich auswirken mögen". Aufgrund des im Kapitel 3.2.1 schon erläuterten Vokabulars könnte man annehmen, daß sich auch diese Äußerung auf das friedlichen Zusammenleben und das neu entstandene Vertrauen der Nationen beziehen soll. Doch wird bei näherer Betrachtung sehr schnell offensichtlich, daß Stresemann hier - mit Hilfe seiner allseits bekannten diplomatischen Umsicht - die wirklichen Hoffnungen, die Deutschland mit dem Vertrag von Locarno verbindet, unterschwellig zur Sprache bringt. Gemeint sind die umfangreichen Rückwirkungen, wie sich von dem von Stresemann in diesem Zusammenhang benutzen Verb ,,auswirken" nur unschwer ableiteten läßt. Stresemann hatte am 12.Oktober in Locarno die deutschen Forderungen, die er im Gegenzug zum Sicherheitspakt verwirklicht sehen wollte, zum Ausdruck gebracht74. Dabei handelte es sich vornehmlich um die Räumung der Kölner Zone, die schon seit dem 10. Januar 1925 überfällig war75, sowie um die Verminderung und Verkürzung der Besatzung im gesamten Rheinland76. Wie Stresemann in seinem Locarno-Tagebuch verzeichnet hat, wäre Briand angesichts dieses Ansinnens ,,beinahe vom Sofa gefallen" und habe betont, daß dies ,,eine Bezahlung des Sicherheitspaktes sei, der er nicht zustimmen könne."77 Briand äußerte sich zwar nicht gänzlich ablehnend, doch die Verhandlungspartner Deutschlands wichen dem Thema Rückwirkungen in Bezug auf verbindliche Zusagen auf der gesamten Linie aus78. Die vorliegende Quelle zeigt nun auch an anderer Stelle, daß die deutschen Delegierten den Vertrag annahmen, ,,weil wir zu dem Vertrauen berechtigt sind, daß politische Auswirkungen der geschlossenen Verträge insbesondere auch dem deutschen Volk in der Form der Erleichterung seiner Bedingungen des politischen Lebens zugute kommen werden." Hierbei zeigt sich, daß Stresemann lediglich das ,,Vertrauen" in eine Erleichterung, sprich in die Verwirklichung der geforderten Rückwirkungen, haben kann. Denn wie zuvor erwähnt, konnte sich Stresemann zu diesem Zeitpunkt auf keinerlei verbindliche Zusagen stützen.
Dennoch bringt er dieses Manko in seiner Rede nicht explizit zum Ausdruck, sondern beschränkt sich auf seine neu erworbenen europäischen Vokabeln. Warum? Aus seinem Locarno-Tagebuch ist zu entnehmen, daß es kurz vor der Rede Stresemanns, der die Rede Briands folgte, eine kurze Unterhaltung zwischen den beiden Außenministern gegeben hat79. Hierin erklärte Stresemann, der in einer Unterredung mit Chamberlain nochmals das Gespräch auf die Rheinlandfrage lenkte, seine Absicht das undankbare Thema in der Rede eines deutschen Delegierten unterzubringen. Briand machte daraufhin den Vorschlag, selbst in seiner Rede dieses Thema anzusprechen, wenn die deutsche Rede nicht den Ausdruck ,,besetzte Gebiete" enthalten werde80.
Stresemann hat sich, wie die Quelle zeigt, an diese Abmachung gehalten und auch mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung in Frankreich81 das heikle Thema ausgespart. Auch hier wird wieder die Tragweite des Verhältnisses Verfasser-Adressat deutlich: Stresemann sprach nicht nur vor den Delegierten der Konferenz, sondern gleichsam auch vor der Weltöffentlichkeit. Stil und auch Inhalt seiner Rede wird dadurch erklärbar. Die darauffolgende Rede Briands war ein ,,Meisterstück geschickter Formulierungen im Hinblick auf die Wirkung in beiden Ländern."82 Er ging, wie versprochen, auf die Rheinlandfrage ein, doch durch den sehr allgemein gehaltenen Wortlaut seiner Rede ist zu erkennen, daß er Deutschland wiederum keine exakten und verpflichtenden Zusagen machte, aber trotzdem Zuversicht bei der deutschen Delegation hinsichtlich der Reparationen erweckte: ,,Herr Stresemann hat mit einer Diskretion, für die ich ihm dankbar bin, auf gewisse Gegenden seines Landes hingewiesen, an denen sich zu desinteressieren Sie nicht das Recht haben. Auch ich darf mich an ihnen nicht desinteressieren."83.
Nach Briands Vortrag reichten sich die beiden die Hände, und Stresemann dankte seinem französischen Amtskollegen von Herzen für die gesprochenen Worte, worauf dieser erwiderte: ,,Nein, sprechen Sie nicht von Worten. Ich werde Ihnen den Beweis bringen, daß das nicht nur Worte waren, sondern Taten sind."84
Stresemann hat die Rede Briands und wohl auch diesen berühmten Satz aus heutiger Sicht wahrscheinlich überinterpretiert, denn wie der weitere Verlauf der geschichtlichen Ereignisse zeigt, verbrachte Deutschland nach Locarno lange Zeit damit, hinter den Rückwirkungen herzulaufen und somit außenpolitisch auf der Stelle zu treten85. Doch zum Zeitpunkt dieser Quelle war dies noch nicht abzusehen und hätte aufgrund der Atmosphäre wohl auch nicht gezählt.
4. Einordnung der Quellen in größere Zusammenhänge
Die Konferenz von Locarno, die am 16.Oktober 1925 zu Ende ging, war sowohl für Stresemann als auch für Briand ein Triumph86. Beide konnten, zurück in Berlin und Paris, eindeutige politische Erfolge aufweisen, die sich auf die öffentliche Meinung der Nationen auswirkten: Während Briand die Befriedigung des französischen Sicherheitsbedürfnisses durch Deutschlands Verzicht auf Elsaß-Lothringen sowie die Anerkennung der Schiedsgerichtsbarkeit und Völkerbundsverpflichtungen rühmen könnte, so hatte Stresemann neben allen Sicherheitsgarantien die über die Völkerbundsverpflichtungen hinausgingen auch ein ,,Ost-Locarno", also die Fixierung der deutschen Ostgrenze vermieden87. Doch den von Frankreich und England garantierten ständigen Ratssitz im Völkerbund betreffend, sollte es schon bald nach der Unterzeichnung Verträge in London (1.Dezember 191925) zu Schwierigkeiten kommen.
Als sich am 7.März 1926 die Delegierten zu den Völkerbundsverhandlungen in Genf einfanden, wurde nun bekannt, daß Briand bereits in Locarno insgeheim auch Polen einen ständigen Ratssitz im Völkerbund versprochen hatte, um eventuellen Gefährlichkeiten, die von dem deutschen Ratssitz ausgehen könnten, zu begegnen88. Darüber kam es zu schweren Verhandlungen und Kompromißversuchen, die die deutsche Delegation jedoch allesamt ärgerlich ablehnten89 Der vielzitierte ,,Geist von Locarno" wurde auf eine schwere Probe gestellt. Erst durch eine Warnung Chamberlains, lenkte Briand ein und trug, indem er nicht mehr auf den Ratssitz Polens bestand, zur Überwindung der Krise bei90. ,,Der Glaube an Locarno war doch auf allen Seiten so stark, daß niemand gegen ihn einen offenen Schlag zu führen wagte."91 Trotzdem mußte Stresemann unverrichteter Dinge abreisen und Deutschland wurde erst am 10. September 1926 - dafür aber als alleiniges neues Mitglied - triumphal in Völkerbundsrat aufgenommen92.
Nicht zuletzt der Berliner Vertrag, in dem sich Deutschland und Rußland im April 1926 ihre gegenseitige Neutralität versicherten, hat entscheidend auf die letztendliche Aufnahme Deutschlands in den Völkerbundsrat eingewirkt: So war Briand zwar wenig begeistert, sah nun aber die Notwendigkeit der Weiterführung der deutsch-französischen Annäherung um so mehr93. Stresemann hatte, indem er die ,,russische Karte" im geeigneten Augenblick ausspielte, drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Zum ersten gewann der deutsche Außenminister sein innenpolitisches Ansehen zurück, denn der Berliner Vertrag begeisterte von den Kommunisten bis zu den Rechten den gesamten Reichstag94. Zum zweiten gelang es Stresemann durch den Vertrag die russischen Bedenken gegen den deutschen Völkerbundseintritt zu zerstreuen95 und zum dritten beschleunigte er - wie erläutert - die ganze Völkerbundsprozedur.
Stresemann befand sich in den Jahren 1925 und 1926 auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Außenpolitiker, insbesondere als ihm - gemeinsam mit Briand - am 10. Dezember 1925 als erstem Deutschen der Friedensnobelpreis zuerkannt wurde96.
Was jedoch die praktische Durchführung der in Locarno beratenen Rückwirkungen betraf, so mußte Stresemann in den darauffolgenden Jahren mit einer großen Ernüchterung fertig werden: ,,Die ihm noch verbleibenden drei Jahre aber sind gekennzeichnet von Enttäuschung und Krankheit, von einem ermüdenden Kampf um die Haltung des Kurses, vom zähen Ringen, den ,,Geist von Locarno" zum deutschen Vorteil wachzuhalten."97 Erst im August 1929, fast vier Jahre nach Locarno, gelang es Stresemann Briand einen Zeitplan für die Räumung des Rheinlandes abzuringen98. Doch die Räumung der dritten und letzten Zone des Rheinlandes hat Stresemann schon nicht mehr miterlebt: Er starb 3. Oktober 192999.
5. Schlußbemerkung
Zusammenfassend ist nun am Ende zu sagen, daß Stresemann keineswegs ein engagierter Europa-Politiker im herkömmlichen Sinne war. Wie die anhand der ausgewählten Quellen erarbeiteten geschichtlichen Ereignisse in dieser Arbeit gezeigt haben, zielte seine gesamte außenpolitische Strategie von vornherein auf die Überwindung des Versailler Vertrages ab. Natürlich wählte er dafür den Weg der friedlichen Verständigung, aber doch wohl nur, weil ihm aufgrund der militärischen und politischen Lage Deutschlands kein anderer Weg offenstand.
Sowohl für Stresemann als auch für Briand war Politik ,,die Kunst des Möglichen"100. Gerade diese Geisteshaltung wird der entscheidende Schlüssel zur Ermöglichung der deutsch- französischen Verständigung in Locarno gewesen sein. Dennoch muß aber immer wieder betont werden, daß beide Außenminister aus nationalen Interessen handelten; auch - und gerade - in Locarno101.
Natürlich unterschied sich die Verhandlungsatmosphäre in Locarno in enormem Maße von der schwierigen und angespannten Stimmung der Jahre zuvor102, wie sich in der zweiten Quelle auch herausgestellt hat. Doch diese Konferenz als ,,Grundsteinlegung der Vereinigten Staaten von Europa" bezeichnen zu wollen, verfälscht die Ziele und Intentionen sowohl Stresemanns als auch Briands103. Wenn überhaupt, dann war es eher Briand, der, durch seinen schon früher sichtbar gewordenen Hang zum Pazifismus und zum Internationalismus, in Locarno ,,europäisch" sprach104. Stresemann dagegen hatte - als langjähriger Anhänger der Monarchie105 - erst nach der Niederlage einsehen müssen, daß die Wiedererlangung des deutschen Großmachtstatus nur durch eine Verständigungspolitik mit den ehemaligen Kriegsgegnern zu erreichen war106.
In Locarno hatten Stresemann und Briand gleichermaßen ,,finassiert und waren den ,,großen Entscheidungen" ausgewichen, wie Stresemann es so scharf in der ersten Quelle angekündigt hatte. Dies wurde von Seiten Briands nicht zuletzt durch die geheime Zusage der Ratsmitgliedschaft an Polen, die er in Locarno (!) gab, deutlich. ,,In den zwanziger Jahren gab es allenfalls in den politischen Sonntags- und Völkerbundsreden übernationale europäische Bekenntnisse. Auf den Konferenzen und in den Kabinetten aber wurde handfeste nationale Interessenspolitik betrieben."107 So kann man dann auch Briands Äußerung von der ,,Verwirklichung des Ideals eines Europas"108, die in seiner, im Anschluß an die zweite Quelle vorgetragenen Rede zu finden ist, in die richtige Kategorie einordnen. Ebenso verhält es sich mit der zweiten Quelle, also mit der Abschlußrede Stresemanns, obwohl man sowohl dem deutschen als auch dem französischen Außenminister hierbei die bereits erläuterten Impressionen und Gefühle beim Abschluß der Konferenz von Locarno zugute halten muß.
Schlußendlich ist zu sagen, daß sich Stresemann in Locarno nicht vom Saulus zum Paulus entwickelte, um dann als ,,Europäer" heimzukehren109. Zwar lag seiner Auffassung nach im Europagedanken allgemein ,,ein sehr bedeutsamer Kern", doch zielte Stresemann dabei im wesentlichen auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit110.
Die Stresemannsche Realpolitik blieb jedoch bis zu seinem Tod darauf ausgerichtet, die Fesseln von Versailles abzustreifen und den ,,Würger erst vom Halse" zu haben. Diese außenpolitische Konzeption, aus der Stresemann nie einen Hehl gemacht hat, war allen politischen Verhandlungspartnern über die Jahre hinweg deutlich sichtbar. Um so weniger ist die - vielleicht auch gespielte (?) - Entrüstung nach der Veröffentlichung des Kronprinzenbriefes nachzuvollziehen111. Denn im Endeffekt beschrieb Stresemann darin nichts, was nicht schon alle wußten.
[...]
1 Berg, Manfred: Gustav Stresemann. Eine politische Karriere zwischen Reich und Republik. Göttingen, Zürich 1992. S.96.
2 Quelle Nr.1: Harttung, Arnold (Hrsg.): Gustav Stresemann. Schriften mit einem Vorwort von Willy Brandt. Berlin 1976. S. 336, Nr.93 An Kronprinz Wilhelm. Quelle Nr. 2: Bernhard, Henry (Hrsg.): Gustav Stresemann. Vermächtnis. Der Nachlass in drei Bänden. Bd.2 , Berlin 1932, S. 202 Stresemanns Rede beim Schlußakt. Quellengattung: Nr.1: vertraulicher Brieftext in vollständiger Fassung wiedergegeben, Nr.2: Rede in vollständiger Fassung und direkter Rede wiedergegeben. Adressat: Nr.1: der ehemalige Kronprinz Wilhelm, nicht für die Öffentlichkeit. Nr.2: die Delegierten der Konferenz, die Weltöffentlichkeit. Entstehungsort: Nr.1: unbekannt. Nr.2: Locarno.
3 Siebert, Ferdinand: Aristide Briand. Ein Staatsmann zwischen Frankreich und Europa. Erlenbach-Zürich, Stuttgart 1973. S.345.
4 Berg, Manfred: a.a.O., S.85.
5 Maxelon, Michael-Olaf: Stresemann und Frankreich 1914 - 1929. Deutsche Politik der OstWest-Balance. Düsseldorf 1972. S.84.
6 ebenda, S.84.
7 ebenda, S.85.
8.Berg, Manfred: a.a.O., S. 60.
9 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S.86.
10 ebenda, S. 86 : ,,Der Hinweis der deutsch-französischen Interdependenz könnte als geniale Einsicht interpretiert werden, ging aber, so formuliert, an den Realitäten von damals fast gänzlich vorbei. Die französischen Militärs und nationalen Politiker dachten entscheidend in machtpolitischen Kategorien, nicht aber in Begriffen wirtschaftlicher Vernunft."
11 ebenda, S.87.
12 ebenda, S.89.
13 ebenda, S.90.
14 ebenda, S.90.
15 ebenda, S.91.
16 ebenda, S.92.
17 ebenda, S. 114.
18 ebenda, S.116f.
19 ebenda, S.117.
20 ebenda, S.115.
21 ebenda, S. 117.
22 Berg, Manfred: a.a.O., S. 93.
23 ebenda, S.79.
24 ebenda, S.80f.
25 ebenda, S.81.
26 ebenda, S.90.
27 ebenda, S.87.
28 ebenda, S.90.
29 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S. 165.
30 In England stellten mit Ramsey MacDonald erstmalig die Labours den Premierminister. In Frankreich wurde der antideutsche Poincare´ von dem radikalsozialistischen Herriot abgelöst. Vgl. dazu: Berg, Manfred: a.a.O., S. 91.
31 ebenda, S. 91.
32 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S. 163.
33 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S.173.
34 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.309.
35 ebenda, S.310ff.
36 vgl. dazu Berg, Manfed: a.a.O., S.85f.
37 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.311
38 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S.168 und 173.
39 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S. 315.
40 ebenda, S.315 und Koszyk, Kurt: Gustav Stresemann. Der kaisertreue Demokrat. Köln 1989. S.300.
41 ebenda, S.316: ,,Zu dieser neuen Politik sei Frankreich auch durch den Faktor ,,Rußland" veranlaßt worden. Es werde das beherrschende Problem der nächsten Jahre sein, ob Deutschland sich zur russischen oder zur westlichen Seite hin orientiere."
42 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S.186.
43 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S. 313: ,,Offensichtlich habe Deutschland den Hintergedanken, mit dem von ihm vorgeschlagenen Pakt die Revision des Versailler Vertrages vorzubereiten. Aber er [Briand] werde ihm diese Illusion nehmen."
44 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S.195.
45 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.312.
46 ebenda, S. 313f.
47 ebenda, S.327
48 Berg, Manfred: a.a.O., S.95.
49 ebenda, S.96.
50 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.327.
51 Berg, Manfred: a.a.O., S.97.
52 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S.185
53 Berg, Manfred: a.a.O., S. 85.
54 ebenda, S.85.
55 ebenda, S.86f.
56 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S.192.
57 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.322.
58 vgl. dazu: Bernhard, Henry (Hrsg.): Gustav Stresemann. Der Nachlass in drei Bänden. Bd.2, Berlin 1932, S. 188 und Siebert, Ferdinand: a.a.O., S. 316ff.
59 Berg, Manfred: a.a.O., S.92.
60 Koszyk, Kurt: a.a.O., S.301.
61 Maxelon, Michael-Olaf: a.a.O., S.190
62 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.317.
63 ebenda, S.317
64 vgl. dazu das Locarno-Tagebuch Stresemanns. In: Bernhard, Henry (Hrsg.): a.a.O., S.186ff.
65 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.319.
66 ebenda, S.310.
67 Bernhard, Henry (Hrsg.): a.a.O., S.192.
68 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.324.
69 ebenda, S.320f.
70 Berg, Manfred: a.a.O., S.98.
71 Bernhard, Henry (Hrsg.) a.a.O., S.206.
72 Koszyk, Kurt: a.a.O., S.302 und Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.325.
73 ebenda, S.324.
74 Bernhard, Henry (Hrsg.): a.a.O., S.193.
75 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.335.
76 ebenda, S.320.
77 Bernhard, Henry (Hrsg.): a.a.O., S.194.
78 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.321.
79 Bernhard, Henry (Hrsg.): a.a.O., S. 201.
80 ebenda, S.201.
81 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.323.
82 ebenda, S.323.
83 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.323.
84 Bernhard, Henry (Hrsg.): a.a.O., S.202.
85 ebenda, S.333.
86 Koszyk, Kurt: a.a.O., S.302.
87 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.328f.
88 ebenda, S.332.
89 ebenda, S.356.
90 ebenda, S.358.
91 ebenda, S.360.
92 ebenda, S.380.
93 ebenda, S.361f.
94 Koszyk, Kurt: a.a.O., S.308.
95 ebenda, S.308.
96 Sternburg, Wilhelm von: Gustav Stresemann. Frankfurt a. M. 1990. S.29.
97 ebenda, S.30.
98 ebenda, S.30.
99 ebenda, S.31.
100 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.307.
101 ebenda, S.308.
102 Berg, Manfred: a.a.O., S.96.
103 ebenda, S.96.
104 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.318.
105 Berg, Manfred: a.a.O., S.9
106 Koszyk, Kurt: a.a.O., S.300.
107 Sternburg, Wilhelm von: a.a.O., S.20f.
108 Siebert, Ferdinand: a.a.O., S.323.
109 ebenda, S.345.
110 ebenda, S.346f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Gustav Stresemanns Außenpolitik in Locarno 1925?
Die Arbeit analysiert die außenpolitische Konzeption des deutschen Außenministers Gustav Stresemann auf der Konferenz von Locarno im Oktober 1925. Sie untersucht anhand des "Kronprinzenbriefs" und der Rede Stresemanns beim Schlußakt der Konferenz, ob sich Stresemann vom Revisionspolitiker zum "guten Europäer" wandelte. Die Arbeit konzentriert sich auf Stresemanns Motivation und die Frage, ob die Kritik am "Kronprinzenbrief" gerechtfertigt war.
Welche Quellen werden in der Analyse verwendet?
Die Arbeit basiert hauptsächlich auf zwei Quellen: dem "Kronprinzenbrief" vom 7. September 1925 und der Rede Stresemanns beim Schlußakt der Locarno-Konferenz am 16. Oktober 1925.
Was waren Stresemanns Ziele in Locarno?
Stresemann verfolgte in Locarno mehrere Ziele, darunter den Schutz der Auslandsdeutschen, die Korrektur der Ostgrenzen und die Lösung der Reparationsfrage. Letzteres wurde als grundlegende Voraussetzung für den wirtschaftlichen und politischen Aufstieg Deutschlands angesehen. Er strebte die friedliche Revision des Versailler Vertrages an und wollte Deutschlands Großmachtstatus wiederherstellen.
Welche Zugeständnisse war Deutschland bereit zu machen?
Deutschland war bereit, dem Völkerbund beizutreten, obwohl es zunächst Bedenken hatte. Stresemann argumentierte, dass der Völkerbund Deutschland ermöglichen würde, wichtige Fragen auf europäischer Ebene anzusprechen. Der Verzicht auf eine kriegerische Auseinandersetzung bezüglich Elsaß-Lothringens wurde als unvermeidlich dargestellt, wobei Stresemann jedoch eine friedliche Einigung nicht ausschloss.
Was war der "Geist von Locarno"?
Der "Geist von Locarno" beschreibt die positive und vertrauensvolle Atmosphäre, die während der Konferenz herrschte. Es gab einen neuen Konferenzstil, der von Höflichkeit, Vertrauen und gutem Willen geprägt war. Besonders der enge persönliche Kontakt zwischen Stresemann und Briand trug dazu bei.
Welche Hoffnungen verband Stresemann mit dem Vertrag von Locarno?
Stresemann verband mit dem Vertrag von Locarno die Hoffnung auf eine Erleichterung der Bedingungen des politischen Lebens für das deutsche Volk. Dies umfasste vor allem die Räumung der Kölner Zone und die Verminderung der Besatzung im Rheinland. Er vertraute darauf, dass die politischen Auswirkungen der Verträge Deutschland zugute kommen würden.
Wie wurde der "Kronprinzenbrief" interpretiert?
Der "Kronprinzenbrief" wurde kontrovers diskutiert. Einige sahen darin eine Bestätigung von Stresemanns revisionistischen Zielen, während andere argumentierten, dass der Brief aufgrund des Adressaten (Kronprinz Wilhelm) in einem nationalistischeren Ton verfasst wurde, um innenpolitischen Widerstand zu minimieren. Die Veröffentlichung des Briefes 1932 führte zu großer Empörung, insbesondere in Frankreich.
Was war Stresemanns Verhältnis zu Russland?
Stresemann nutzte das russische Gefahrenpotential des Bolschewismus, um Deutschland als wichtigen Verhandlungspartner für die Entente zu etablieren. Er sah die deutsch-russischen Beziehungen als Mittel zum Zweck, um die deutsch-angelsächsischen bzw. deutsch-französischen Beziehungen zu verbessern und so die deutschen Revisionsforderungen durchzusetzen.
Wie war die deutsch-französische Beziehung vor Locarno?
Die deutsch-französische Beziehung war seit dem Krieg von 1870/71 stark vorbelastet. Auch nach dem Versailler Vertrag gab es keine Besserung, da Frankreich weiterhin Angst vor einer deutschen Revanche hatte. Stresemann erkannte jedoch, dass Frankreich in wirtschaftspolitischer Hinsicht auf Deutschland angewiesen sein würde.
Welche Rolle spielte der Dawes-Plan auf dem Weg nach Locarno?
Der Dawes-Plan war ein wichtiger Durchbruch für Stresemann, da er die erste Voraussetzung für eine Verständigung mit den ehemaligen Kriegsgegnern schuf. Er sah weitreichende Innovationen in Bezug auf die Reparationen vor und die Wiederherstellung der deutschen Wirtschaftseinheit. Deutschland erhielt außerdem eine internationale Anleihe, die den wirtschaftlichen Wiedereinstieg ermöglichte.
- Quote paper
- Simone Broeker (Author), 1998, Stresemann, Gustav, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100457