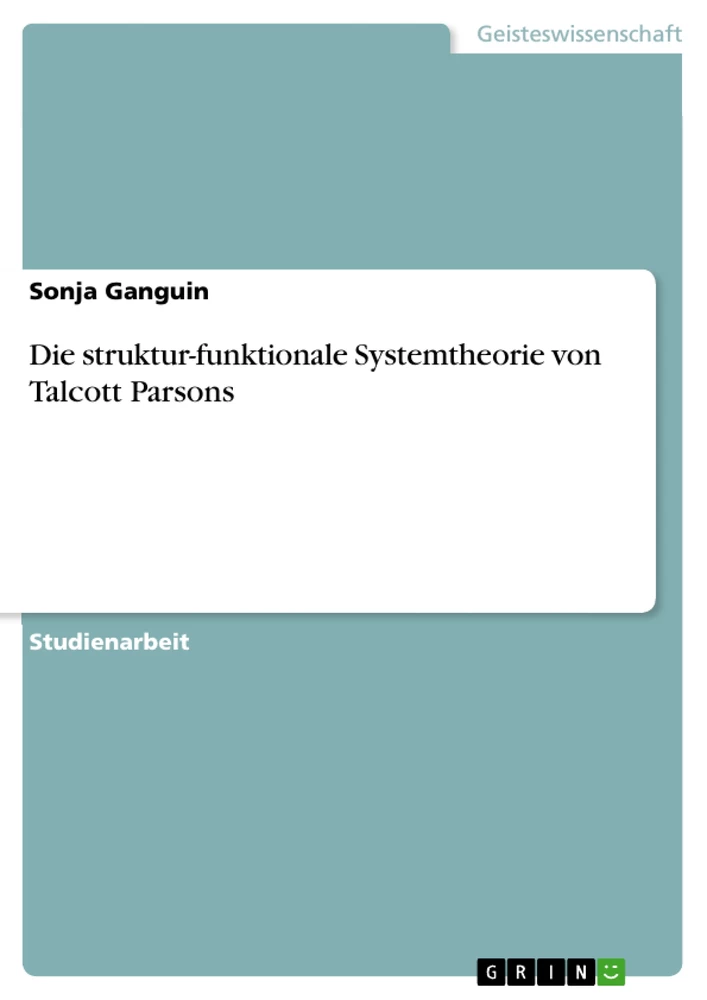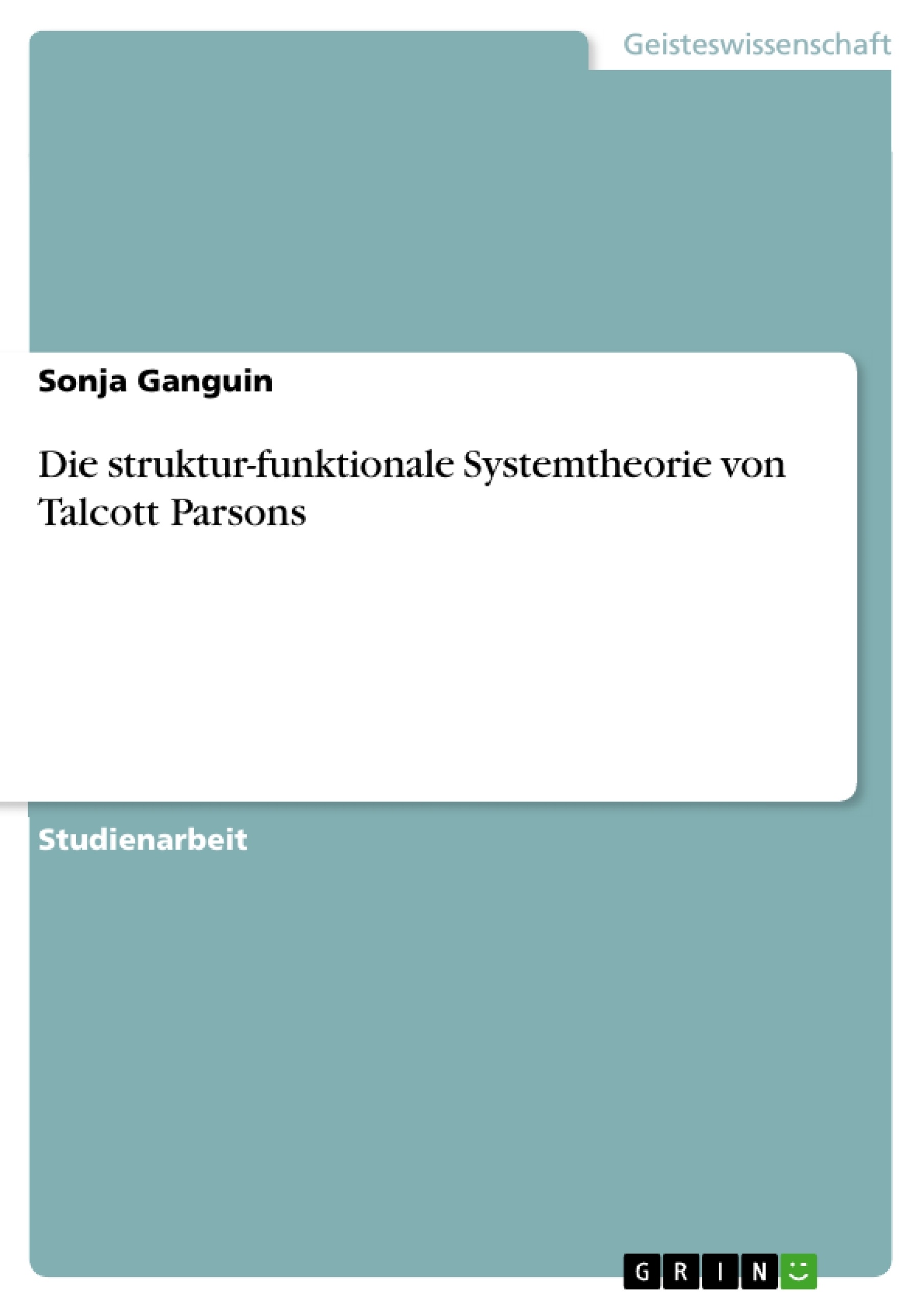Was formt uns zu dem, was wir sind? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Sozialisation mit Talcott Parsons' bahnbrechender strukturell-funktionalen Systemtheorie, einer umfassenden Analyse, die entschlüsselt, wie Individuen in die Gesellschaft integriert werden. Diese tiefgründige Untersuchung, die in den 1950er Jahren entwickelt wurde, beleuchtet die komplexen Prozesse der Internalisierung von Normen und Werten, die jede Generation prägen und die Kontinuität der Gesellschaft sichern. Von den grundlegenden Handlungssystemen – dem organischen, psychischen, sozialen und kulturellen – bis hin zu den entscheidenden Systemfunktionen der Anpassung, Zielverwirklichung, Integration und Latenz, enthüllt Parsons' Theorie die unsichtbaren Kräfte, die unser Verhalten lenken. Entdecken Sie, wie soziale Rollen, insbesondere innerhalb der Kernfamilie, zu Spiegelbildern des sozialen Systems werden und wie Mustervariablen unsere Wertorientierungen formen. Verfolgen Sie die Entwicklung des Individuums durch die Phasen des Sozialisationsprozesses, von der oralen Abhängigkeit bis zur Adoleszenz, und verstehen Sie die Bedeutung von Lernprozessen und sozialer Kontrolle. Diese kritische Auseinandersetzung mit Parsons' Werk bietet nicht nur ein tiefes Verständnis der Sozialisationstheorie, sondern regt auch zur Reflexion über die Rolle des Individuums in der modernen, pluralistischen Gesellschaft an. Erkunden Sie die Kritik an Parsons' Theorie, die die Annahme eines allgemeinen Norm- und Wertkonsenses in Frage stellt und die potenzielle Überformung des psychischen Systems durch gesellschaftliche Strukturen beleuchtet. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Soziologie, Sozialpsychologie und die tiefgreifenden Fragen der menschlichen Entwicklung interessieren. Erforschen Sie, wie wir lernen, uns anpassen und unseren Platz in der Welt finden, während wir die komplexen Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft entschlüsseln. Ein tiefgründiger Einblick in die Mechanismen, die uns zu sozialen Wesen machen, und eine Einladung, die Grundlagen unserer eigenen Identität zu hinterfragen. Die strukturfunktionalistische Systemtheorie von Talcott Parsons, dargestellt in leicht verständlicher Weise, bietet neue Perspektiven auf die Sozialisation des Menschen.
Inhult
1. Einleitung
2. Soziales Handeln
2.1. Handlungssysteme
2.2. Systemfunktionen
3. Sozialisation als Internalisierungs,-und Integrationsprozeß
3.1. Soziale Rolle
3.2. Rollensystem der Kernfamilie
4. Sozialisation als Differenzierungsprozeß von Rollen und Bedürfnisdispositionen
4.1. Mustervariablen
4.2. Prinzip der Zweiteilung
5. Sozialisation als Lernprozeß
6. Phasen des Sozialisationsprozeß
7. Kritik
Strukturell-funktionale Systemtheorie
1. Einleitung
Einer der wichtigsten Begründer des soziologischen Funktionalismus ist der amerikanische Soziologe Talcott Parsons. Talcott Parsons lebte von 1902 bis 1979 und entwickelte seine Sozialisationstheorie bereits in den 50er Jahren.
Diese Theorie ist einerseits das Ergebnis seiner Handlungs,-und Systemtheorie, andererseits ist sie hervorgegangen aus einer eigenwilligen Weiterentwicklung der Freudschen Objektbeziehungen des Kleinkindes (vgl. R. Reichwein 1970, S. 163).
Der Strukturfunktionalismus fragt nach den Aufgaben oder Funktionen von sozialen Phänomen, also welche Aufgaben und Funktionen soziale Phänomene innerhalb der Gesellschaft erfüllen.
Mit sozialen Phänomen sind soziale Handlungen gemeint, die einer Person in seinem Handlungssystem zur Verfügung stehen. Entweder erfüllen sie eine funktionale Aufgabe, so tragen sie zur Integration und Stabilisierung des gesellschaftlichen Systems bei, oder sie besitzen eine dysfunktionale Aufgabe zur Desintegration und Destabilisierung. Somit erhält der Begriff Funktionalität einen zentralen Stellenwert.
In der funktionalistischen Systemtheorie geht es daher um die Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft. So versucht Parsons die Mikroperspektive, also das Individuum mit seiner individuell psychischen Dynamik zu verbinden mit der Makroperspektive, den gesellschaftlichen Sozialstrukturen.
Das Ziel der funktionlistischen Systemtheorie ist es aufgrund dessen, zu erklären, wie Einheit und Ordnung in einer Gesellschaft entstehen. Anders ausgedrückt ist es die Frage, wie die nachwachsende Generation die Normen und Werte einer Gesellschaft übernimmt und verinnerlicht, so daß die Gesellschaft überdauern kann.
2. Soziales Handeln
2.1. Handlungssysteme
Das Medium, in dem das Lernen von der Übernahme und Verinnerlichung der gesellschaftlichen Normen und Werte geschieht, ist das soziale Handeln. Soziales Handeln von Menschen tritt nicht vereinzelt auf, sondern in Konstellationen, die Parsons „Systeme“ nennt. Es gibt vier Handlungssysteme, sie sind Subsysteme vom sozialen Handeln: das organische System, das psychische System, das soziale System und das kulturelle System.
Das organische System, oder auch das System des Organismus der menschlichen Persönlichkeit genannt, wird zur Ausgangsbasis aller Handlungsprozesse. Der Organismus besitzt nur diffuse organische Bedürfnisse z.B. Nahrungsaufnahme, Schlaf, Atmung. Er hat aber auch ein libidinöses Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Beziehungen. Diese eben erwähnten Bedürfnisse bezeichnet Parsons als die primären Bedürfnisse. Der Organismus besitzt eine generelle motivationale Energiequelle und versorgt die Persönlichkeit mit Energie für physische und psychische Grundfunktionen (Input-Output Beziehung).
Das psychische System umfaßt vor allem die Bedürfnisdispositionen. Aus den primären Bedürfnissen werden durch soziale Kontakte weitere Bedürfnisse hervorgerufen. Dies sind die sekundären Bedürfnisdispositionen. Sie sind Handlungsbereitschaften zur Bedürfnisbefriedigung. Das psychische System kontrolliert die Bedürfnisdispositionen und versucht sie in gesellschaftlich erlaubte und vorgeschriebene Bahnen zu lenken. Diese kontrollierten Bedürfnisdispositionen bilden sich im Zuge der Verinnerlichung der gesellschaftlichen Kontrollen zu stabilen Merkmalen und Antriebskräften heraus.
Das soziale System ist gekennzeichnet durch das Handeln von Individuen, also durch Interaktion. Der Ort ist die Familie und das soziale System wird gebildet durch die verschiedenen Beziehungen der Personen in ihrer Eigenschaft als Träger bestimmter Rollen. Das Kind verinnerlicht die Verhaltensweisen seiner Bezugspersonen und somit auch seine eigenen Verhaltensweisen. Der wechselseitige Interaktionszusammenhang zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen ist also entscheidend für das psychische System.
Das kulturelle System steht an der Spitze der Kontroll,-und Steuerungshierarchie. Folgend kontrolliert das kulturelle System das soziale und das soziale das psychische System. Das kulturelle System besteht aus alledem, was die Kultur in inhaltlicher Hinsicht ausmacht. Zur Erläuterung die folgende Definition: "Die Gesamtheit der Verhaltenskonfigurationen einer Gesellschaft, die durch Symbole über Generationen hinweg übermittelt werden, in Werkzeugen und Produkten Gestalt annehmen, in Wertvorstellungen und Ideen bewußt werden"(s. Lexikon zur Soziologie, 3. Auflage 1995) Aus diesen vier Systemen ergibt sich das soziale Handeln von Menschen.
2.2.Systemfunktionen
Diese vier Systeme stehen in einer System-Umwelt-Beziehung zueinander, danach sieht sich jedes System mit generellen Problemen konfrontiert, die unmittelbar aus dem Interaktionsverhältnis resultieren. Das Problem der oben erklärten Systeme ist die Bestandsicherung (Grenzerhaltung) gegenüber der Umwelt. Dies bedeutet, daß die Systeme gegenüber Umweltveränderungen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden müssen. Vier Systemfunktionen übernehmen diese Aufgabe. Und zwar die Anpassungsfunktion (adaption), die Zielverwirklichungsfunktion (goal attainment), Integrationsfunktion (integration) und die Latenzfunktion (latent pattern maintance).
Die Aufgabe der Anpassungsfunktion ist es jedes System an die jeweiligen externen Bedingungen anzupassen. Also die Anpassung an die Umwelt.
Die Zielverwirklichungsfunktion muß erreichen, das die Systeme ihre Energie bündeln, so daß sie die Ziele nach der Wichtigkeit versuchen durchzusetzen.
Die Integrationsfunktion ist für die Einbindung und der Kontrolle der inneren Ordnung zuständig.
Die Latenzfunktion ist für die Bestandserhaltung eines System unabdingbar, da die latenten zur Steuerung erforderlichen Grundstrukturen stabilisiert und aufrechterhalten werden müssen. Also eine latente Aufrechterhaltung der Wertmuster und ein Spannungsausgleich.
Diese vier Funktionen als Aufgaben der Bestands,-und Grenzsicherung von Systemen lassen sich auch als Grundeigenschaften der einzelnen Handlungssysteme begreifen. Nach den Anfangsbuchstaben jeder der Funktionen ergibt sich das AGIL- Schema. So braucht jedes System alle diese Funktionen um zu bestehen, wobei eine bestimmte Funktion auch einem bestimmtem System noch extra zugeordnet ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
So ist dem Organismus die Anpassungsfunktion noch extra zugeordnet. Dies bedeutet, daß das organische System, hauptsächlich durch die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen im zentralen Nervensystem, die Umweltanpassung realisiert. Damit ist die Anpassungfunktion die Symbolisierung der Bedingungen und Mittel in der Umwelt.
Die Zielverwirklichungsfunktion ist dem psychischem System zugehörig. Das psychische System organisiert daher die individuellen Handlungsprozesse um Hinblick auf die Funktion der Zielerreichung. Damit ist die Zielverwirklichungsfunktion der Motivationsinput für die Persönlichkeit.
Das soziale System übernimmt die integrativen also einbindenden Funktionen der Handlungkoordinierung. Die Integrationsfunktion hat deswegen die Aufgabe der systemischen Ordnung des sozialen System.
Die Kultur ist der Systemort für die kulturellen Werte. Durch die Latenzfunktion erfüllt das kulturelle System die Funktion der Werterhaltung
3. Sozialisation als Internalisierungs-und Integrationsprozeß
3.1.Soziale Rolle
Um die Theorie von Parsons zu verstehen möchte ich noch kurz auf den Begriff der sozialen Rolle eingehen, da dieser Begriff in der Sozialisationstheorie von Parsons entscheidend ist. Zu jeder Position, die ein Mensch in einer Gesellschaft einnimmt gehören gewisse Verhaltensweisen, die man vom Träger dieser Position z.B. Klassenkasper erwartet. Mit jeder Position gibt die Gesellschaft der Person eine Rolle in die Hand, die er zu spielen hat. Die Gesellschaft hat zu jeder Rolle bestimmte Rollenerwartungen, die durch Sanktionen entweder positive oder negative, geschützt werden. Entspricht die fragliche Person diesen Rollenerwartungen, dann zeigt sich ein entsprechendes Rollenverhalten.
3.2. Rollensystem der Kernfamilie nach Parsons
Das Kind fängt an soziale Objekte zu internalisieren, wobei in den ersten Monaten vor allem der ersten Pflegeperson die Aufmerksamkeit gilt. Diese Person, meisten die eigene Mutter, wird vor allem in ihren Rollenbezügen aufgenommen und verweist somit auf das soziale und das kulturelle System.
Die Familie wird zur wichtigsten Sozialisationsdistanz für das Kind, so daß im ersten Sozialisationsstadium das Kind sukzessiv die Rollenstruktur der Kernfamilie verinnerlicht. Die Kernfamilie besteht typischerweise aus Mutter, Vater, Sohn und Tochter. Die Rollenstruktur der Kernfamilie ist durch Aufteilung der Rollen in Generationsrollen und Geschlechterrollen gekennzeichnet. Die Generationsrollen der Eltern sind gekennzeichnet durch die Eigenschaften Macht und Autorität. Die der Kinder dagegen sind Ohnmacht und Abhängigkeit.
Die Geschlechterrollen von dem Vater und dem Sohn werden den Eigenschaften vom instrumentellen also zweckrationales Verhalten zugesprochen. Die Mutter und die Tochter dagegen zeigen expressives also emotionales Verhalten.
Dem Kind werden auf diesem Wege seine eigenen sozialen Rollen zu Bestandteilen seines Pesönlichkeitssystems und dieses wird zu einem Spiegelbild (mirrow image) des Sozialsystems.
4. Sozialisation als Differenzierungsprozeß von Rollen und Bedürfnisdispositionen
4.1.Mustervariablen
Die Aufgabe der primären Sozialisation besteht vor allem in der Übernahme der notwendigen Orientierungen zum befriedigenden Handeln in einer Rolle, also in der Entwicklung einer allgemeinen Handlungs,-und Rollenkompetenz.
So werden von der sozialen Umwelt Wertorientierungsmuster an das Kind herangetragen und das Kind lernt diese Orientierungsdimensionen auch Mustervariablen (pattern variables) genannt, kennen, die es in einem Handlungssystem zur Verfügung hat. Die fünf Wertorientierungen sind folgende:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Selbstorientierung gegenüber Kollektivorientierung.
Das Kind muß sich entscheiden, ob es seine eigenen Interessen durchsetzen will oder den vom ihm erwarteten sozialen Verpflichtungen nachgeht.
2. Spezifizierung gegenüber Diffusität
Entweder tritt das Kind in einen engen spezifischen Kontakt (Emotionen) zu anderen oder in einem allgemeinem, diffusen Kontakt.
2. Affektivität gegenüber Neutralität
Das Kind wird die Befriedigungsmöglichkeiten nutzen, oder die Bedürfnisse zurückstellen.
4. Partikularismus gegenüber Universalismus
In partikularistischen Beziehungen verhält sich das Kind gefühlsmäßig und Subjektiv, ansonsten eher rational.
5. Zuschreibung gegenüber Leistung
Entweder bewertet man eine andere Person nach seinen Äußerlichkeiten oder nach seinen Eigenschaften und Leistungen.
Hinter diesen Werorientierungen steht bei Parsons die Unterscheidung zwischen der familiären Kleingruppe und der komplexen durchrationalisierten Gesellschaft. Also Gemeinschaft gegenüber Gesellschaft.
Diese fünf Wertorintierungen werden nacheinander erworben und verinnerlicht. Sie dienen einerseits zur Kategorisierung von Objekten, dies bedeutet die Einordnung von wahrgenommenen und verinnerlichten Objekten, wie zum Beispiel der Mutter. Andererseits dienen sie zur Unterscheidung der Bedürfnisdispositionen, zum Beispiel Autonomie gegenüber Abhängigkeit.
4.2. Prinzip der Zweiteilung
Der Differenzierungsprozeß der Bedürfnisdispositionen verläuft nach dem Prinzip der Zweiteilung. Nach jeder Differenzierung verdoppeln sich sowohl die internalisierten Rollen als auch die Bedürfnisdispositionen. Die Zweiteilung ist nicht mehr umkehrbar es entsteht daher eine irreversible Reihenfolge.
Nach dem Prinzip der Zweiteilung entwickelt sich im Laufe des Sozialisationsprozesses im psychischen System des Kindes ein sich immer weiter verzweigendes System von Bedürfnisdispositionen, das wie ein Baum aus einer einzigen Wurzel herauswächst. Parsons spricht daher auch von einem „Stammbaum“ (genealogical tree) der Motivationsstruktur im Persönlichkeitssystem des sozialisierten Individuums.
In den Stammbaum werden im Verlauf des Sozialisationsprozesses alle primären organische Bedürfnisse und Antriebe integriert. Das Persönlichkeitssystem wird in das soziale System ebenfalls integriert und somit besteht bei beiden Sytemen eine Übereinstimmung. Durch diese Übereinstimmung wird das Persönlichkeitssystem zum „Spiegelbild“ des Sozialsystems.
5. Sozialisation als Lernprozeß
Lernen ist bei Parsons die Antwort auf veränderte Situationsbedingungen. Diese Veränderungen sind biologische Reifung des Kindes und die Reaktion anderer auf diesen Prozeß.
Aufgrund der bis dahin verinnerlichten Interaktionsstrukturen, Bedürfnisdispostionen und Wertorientierungen befindet sich das Kind in einem Gleichgewicht. Durch die veränderte Situationsbedingung kommt es zu einem Ungleichgewicht und ein neuer Gleichgewichtszustand muß aufgebaut werden.
Dazu gehören vier Phasen.:
1. Frustration
In der frühen Phase der Individualentwicklung zielen die verschiedenen elterlichen Kontrolltechniken darauf ab, den Kindern den Ausdruck all ihrer Bedürfnisse zu gestatten.
2. Unterstützung
Insbesondere werden die kindlichen Versuche, den sozialen Erwartungen ihrer Bezugspersonen zu entsprechen, aktiv unterstützt.
3. Verweigerung der Reziprozität
Damit sich die heranwachsenden Kinder allmählich dem Erwachsenenalter annähern können, müssen die Eltern vor allem in der ödipalen Phase ihren Kindern die volle Reziprozität (Vertauschung) der Interaktion verweigern.
4. Selektive Belohnung
Durch gezielten Einsatz von Sanktionen und Gratifikationen wird das kindliche Verhalten gesteuert.
Das Kind lernt so erwünschte und unerwünschte Verhaltensweisen zu unterscheiden (Diskriminierung), die erwünschten zu stärken und an der Stellen von anderen zu setzen (Substitution) und die unerwünschten zu unterdrücken und zu löschen (Extinktion). So entsteht auf dem Wege einer lerntheoretischen Konditionierung das neue angemessene Verhaltensmuster des Kindes. Diese vier Phasen dienen also zur sozialen Kontrolle des Kindes und werden daher auch vorherrschende Typen sozialer Kontrolle genannt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nach jeder der vier Phasen ist ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht, der nun zum Ausgangspunkt der nächsten Sozialisationsphase werden kann.
Parsons spricht von einem „spiralförmigen Zyklus“. Seine spiralförmige Verlaufsstruktur erhält der Sozialisationsprozeß dadurch, daß der neue Gleichgewichtszustand ein höheres Niveau einnimmt als der erste.
6. Phasen des Sozialisationsprozesses
Um als Erwachsener handlungsfähig zu sein, müssen die Heranwachsenden schrittweise ihre Handlungskompetenzen erweitern, da die Interaktionssysteme immer komplexer werden. Dieser Prozeß vollzieht sich in dem von Freud beschriebenen fünf aufeinanderfolgenden Entwicklungsetappen. Die Phasen des Sozialisationsprozesses entsprechen denen der psychosexuellen Entwicklung bei Freud und Erikson.
6.1. Die Phase der oralen Abhängigkeit von der Mutter (1. Jahr)
Die Übergangsphase von Zustand des Kindes als „pure oganism“ zur oralen Abhängigkeit wird bezeichnet als orale Krise. Mit der oralen Phase beginnt der Sozialisationsprozeß und die Mutter wird zur Quelle der Befriedigung und Fürsorge. Auf diese Weise entwickelt sich zwischen dem Kind und der Mutter ein besondere Beziehung, die „Mutter-Kind Identität“ genannt wird.
In der ersten Phase des Sozialisationsprozesses erlernt das Kind die Wertorientierungsdimension „Selbstorientierung“ gegenüber „Kollektivorientierung“. Damit lernt das Kind seine selbstbezogenen Aktionen zu trennen von der Mutter als „Wir-Einheit“. Das Kind besitzt in der ersten Phase nur organische Bedürfnisse und ein libidinöses Bedürfnis nach Fürsorge und Zärtlichkeit.
6.2. Die Phase der Liebesabhängigkeit von der Mutter (2.-3. Jahr)
Am Anfang der zweiten Phase ist das Gleichgewicht des Kindes gestört, da von dem Kind ein höheres Maß an Selbständigkeit und Aktivität erwartet wird. So kommt das Kind in die anale Krise. Das Kind muß erkennen, das es jetzt zwei Rolleneinheiten gibt und zwar die Mutterrolle, welche Macht und Autorität besitzt und die eigen Kindesrolle mit den jeweiligen Eigenschaften schwach und relativ expressiv.
Die Bedürfnisdispositionen teilen sich von den organischen Bedürfnissen in „Abhängigkeit“ in Form von Fürsorge, und „Autonomie“, weil das Kind der Mutter gefallen will. Der vorherrschende Typus der sozialen Kontrolle ist die „Unterstützung“ des Kindes, damit das Kind von Anfang an konformes Verhalten erlernen kann.
Die vorherrschende Orientierungsalternative ist in der zweiten Phase Spezifität gegenüber Diffusität, damit lernt das Kind Personen in ihren Rollen zu unterscheiden mit denen es einen spezifischen Kontakt hat (Mutter) und mit denen es nur einen diffusen Kontakt (Verwandte) besitzt.
6.3. Die ödipale Phase (4.-6. Lebensjahr)
Zu Beginn der ödipalen Phase treten Vater und Geschwister in den Gesichtskreis des Kindes. Sie werden zu Identifikationsobjekten, da ein Teil der affektiven Bindung der Mutter auf sie übertragen wird. So entsteht eine weitere Differenzierung der Interaktions,-und Rollensysteme. Drei Identifizierungen müssen in der Phase stattfinden:
1. Familie als Kollektiv
2. mit dem eigenem Geschlecht
3. mit der Generation
Dabei ist die Geschlechtsrollenidenfikation für den Jungen schwerer als für das Mädchen, da der Junge das frühere Identifikationsobjekt (die Mutter) aufgeben muß, um sich mit dem unbekannten und im mancher Hinsicht bedrohlichem Objekt, dem Vater zu identifizieren . Am Ende der dritten Phase hat das Kind die Kernfamilie internalisiert, welches als Prototyp des sozialen System angesehen wird. Ebenfalls ist der Psychische Apparat (Freud: Psychoanalyse) von „Über-Ich“, „Ich“ und „Es“ am Ende dieser Sozialisationsphase vollständig integriert. Die Bedürfnisdispositionen teilen sich von Abhängigkeit in Pflegebedürfnis und Konformität und von Autonomie in Sicherheit und Angemessenheit.
Die Orientierunsalternative in dieser Phase ist „Affektivität“ gegenüber „Neutralität“, also ob das Kind seine Möglichkeiten zur Befriedigung nutzt oder besser zurückstellt.
6.4. Die Latenzphase (7.-13. Lebensjahr)
Wenn das Kind in die vierte Phase eintritt, ist es so alt, um in die Schule zu gehen. In der Schule lernt es Gleichaltrige kennen. Somit setzt sich das weitere übergeordnete System sich nun aus der Herkunftsfamilie, der Schule und den „peer-groups“ zusammen. Die Orientierungsalternative ist „Universalismus“ gegenüber „Partikularismus“ und das Kind erlernt universelle Kategorien wie Mann, Frau, Junge, Nachbarn usw. kennen. Bei dem Kind rücken die rational-kognitiven Momente in den Vordergrund und es geht jetzt um die Bedeutung von Objekten also um Objektkategorisierung.
In der Latenzphase herrscht eine Arbeitsteilung der Sozialisation zwischen der Schule und der peer-group. Die Schule konzentriert sich auf die Generationsdiffenzierung und die peer-group auf die Geschlechtsrollenkategorisierung, da dies entscheidend für die nächste und letzte Phase ist.
6.5. Die Adoleszenzphase (14.-18. Lebensjahr)
In der letzten, der Adoleszenzphase vollzieht sich die weitere Ausweitung des sozialen Erfahrungsraum, denn es kommen neue zu den bisherigen Rollenbereichen hinzu und zwar:
1. die Zeugungsfamilie
2. das Berufssystem
3. Gemeinde
Mit der Zeugungfamilie meint Parsons die Wiederauferlebung von erotischen Beziehungen, die auf die soziale Rolle vom Elternteil und Ehepartner verweist.
Mit dem Berufssystem ist gemeint, das sich der Heranwachsende nun Gedanken über seine spätere Zukunft machen muß, nämlich welchen Beruf er gerne mal ausüben möchte. Die Gemeinde verweist auf die Restkategorie für die Rollendifferenzierung, wie zum Beispiel Nachbar, Staatsbürger usw..
Die vorherrschende Orientierungsalternative ist in der letzten Phase „Zuschreibung“ gegenüber „Leistung“. Der Heranwachsende muß sich nun entscheiden, wenn er neue Menschen kennenlernt oder, generell mit anderen in Kontakt tritt, ob er sie nach ihren Äußerlichkeiten, zum Beispiel Haarfarbe, Hautfarbe, Kleidung oder nach ihren Qualitäten und Leistungen beurteilt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7. Kritik
Die funktionalistische Rollen-und Sozialisationstheorie von Parsons ist eine logische und geschlossene Theorie, die durch ihre umfassende und nachvollziehbare Strukturierung beeindruckt. Parsons Theorie fundiert auf der Annahme eines allgemeinen Norm-und Wertkonsens des kulturellen Systems.
Dieser Konsens drückt sich vor allem in allgemeinen Rollenerwartungen und Rollennormen aus. Aber diese Grundvorraussetzung seiner Theorie wird in den heutigen entwickelten, pluralistischen Gesellschaften angezweifelt und somit wird seine Theorie brüchig.
Seine ganze Theorie stützt sich auf die These einer übermächtigen Gesellschaft , die keinen Raum mehr für Einzelne bietet. Es ist eine Theorie der Vergesellschaftung, in der die Zukunft der Jugendlichen stark vorherbestimmt ist.
So läuft seine Argumentation auf die Anpassung der Individuen an die gesellschaftlichen Verhältnisse und die herrschenden Normen hinaus.
Dies zeigt sich auch bei der ES-Konstruktion, die Parson von Freud übernommen hat.
Von Freud wird das ES als Gegenkraft aller sozikulturellen Umwelteinflüsse verstanden. Parson funktioniert diesem Begriff um, zu einem Produkt dieser Sozialisationseinflüsse. So entsteht das ES bei Parsons erst in der zweiten Sozialisationsphase, also von außen heran getragen und nicht angeboren. Somit wird dem ES seine Gegenkraft, sein eigentlicher Zweck in der Freudschen Theorie, genommen.
Dem Sozialisanden wird nur eine passive Rolle zugesprochen, denn er kann an seinem Sozialisations,-und Entwicklungsprozeß nicht mitwirken. Parsons Theorie impliziert somit eine Sozialisation zur vollständigen Rollenkonformität, die weder normal noch wünschenswert ist. Schlußfolgernd würde das Gesellschaftssystem das psychische System überformen und es käme die Frage auf, ob dann eine autonome Identitätsbildung überhaupt möglich ist.
Parsons hat als Untermauerung seiner Theorie die „soziale Kontrolle“ hinzugefügt. Die vier Phasen ( Permissivität, Support, Verweigerung der Reziprozität, Sanktionskontrolle und Statuskontrolle) zur Kontrolle der Verhaltensweisen des Kindes, also als eine lerntheoretische Konditionierung unterstützt somit seine Theorie und zeigt nochmals auf, daß er dem kulturellen System einen mittelschichtigen spezifischen bürgerlichen Normalpfad unterstellt.
Parsons interessiert sich nicht so stark für die Probleme einzelner/bestimmter Individuen. Er sieht sie mit ihren Problemen eher als „Kosten“, als Muß einer funktionalistischen Gesellschaft. Es ist ein reales, lebendes Beispiel, die auch als Warnung /Vorsicht für die andere gelten kann.
Zum Schluß möchte ich noch auf die von Parsons verwendeten Begriffskonstruktionen eingehen.
Die Begriffskonstruktionen der Bedürfnisdispositionen, als auch der Handlungsmotive und Wertorientierungen sind Setzungen. Es sind Behauptungen, die von Parsons in ihrer empirischen Bedeutung nicht überprüft wurden. Diese Begriffskonstruktionen haben eine Überzeugungskraft, die durch ihren argumentativ, logischen aufeinanderfolgenden Zusammenhang bestechen, aber allein betrachtend eher fragwürdig scheinen.
Abschließend kann man sagen, daß Parsons mit seiner funktionalistischen Sozialisationstheorie eine wirklich beeindruckende Arbeit geleistet hat. Seine Theorie ist umfassend, logisch, argumentativ gut untermauert und vor allem auch nachvollziebar.
Literatur
Hurrelmann, K.(1986): Einführung in die Sozialisationstheorie. Weinheim und Basel: Beltz Mühlbauer, K.-R.(1980): Sozialisation. Reinbek: Rowohlt
Tillmann, K. (1989): Sozialisationstheorien. Reinbek: Rowohlt
Strukturfunktionalismus
-fragt nach den Aufgaben oder Funktionen von sozialen Phänomenen
-funktionale Aufgabe: Integration und Stabilisierung nFunktionalität
-Mikroperspektive und Makroperspektive
-Ziel: Erklärung, wie die nachwachsende Generation die Normen und Werte einer Gesellschaft übernimmt und verinnerlicht
Soziales Handeln
-Medium, in dem die Verinnerlichung von Normen und Werten geschieht
-tritt in Konstellationen auf, die Parsons Systeme nennt
Vier Subsysteme sozialen Handelns
1. organische System
2. psychische System
3. soziale System
4. kulturelle System
-Problem der Bestandssicherung gegenüber Umweltveränderungen
-Systeme müssen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden
Vier Systemfunktionen übernehmen diese Aufgabe
1. „A“ ( Anpassungsfunktion)
2. „G“ ( Zielverwirklichungsfunktion)
3. „I“ ( Integrationsfunktion)
4. „L“ ( Latenzfunktion)
Rollensystem der Kernfamilie
- Familie wird zur wichtigsten Sozialisationsinstanz
- Im 1. Sozialisationstadium verinnerlicht das Kind sukzessiv die Rollenstruktur der Kernfamilie
- eigene soziale Rollen werden zum Bestandteil des Persönlichkeitssystem und dieses wird zu einem Spiegelbild (mirror image)
Mustervariablen / Wertorientierungen
-. Diese fünf Wertorientierungen werden nacheinander erworben und verinnerlicht
- Sie dienen zur Kategorisierung von Objekten und zur Unterscheidung von Bedürfnisdispositionen
-.Aus diesen Wertorientierungen muß der Handelnde in jeder Situation eine Auswahl treffen
-.Differenzierung verläuft nach dem Prinzip der Zweiteilung
-.„Stammbaum“ der Motivationsstruktur
Phasen des Sozialisationsprozesses
1. die Phase der oralen Abhängigkeit von der Mutter (1.Jahr)
2. die Phase der Liebesabhängigkeit der Mutter (2.-3.Jahr)
3. die ödipale Phase (4.-6.Jahr)
4. die Latenzphase (7.-13.Jahr)
Häufig gestellte Fragen
Was ist die strukturell-funktionale Systemtheorie nach Talcott Parsons?
Die strukturell-funktionale Systemtheorie, entwickelt von Talcott Parsons, fragt nach den Aufgaben oder Funktionen von sozialen Phänomenen innerhalb der Gesellschaft. Es geht darum, wie soziale Handlungen zur Integration und Stabilisierung (oder Desintegration und Destabilisierung) des gesellschaftlichen Systems beitragen. Parsons versucht, die Verbindung zwischen Individuum (Mikroperspektive) und gesellschaftlichen Strukturen (Makroperspektive) zu erklären, um zu verstehen, wie Einheit und Ordnung in einer Gesellschaft entstehen und wie Normen und Werte an die nächste Generation weitergegeben werden.
Was versteht Parsons unter sozialem Handeln und welche Systeme gibt es?
Soziales Handeln ist das Medium, durch das die Übernahme und Verinnerlichung gesellschaftlicher Normen und Werte geschieht. Parsons unterscheidet vier Handlungssysteme: das organische System (Bedürfnisse des Organismus), das psychische System (Bedürfnisdispositionen), das soziale System (Interaktion in der Familie) und das kulturelle System (Werte und Normen). Diese Systeme stehen in einer hierarchischen Beziehung zueinander, wobei das kulturelle System das soziale und das soziale das psychische System kontrolliert.
Was sind Systemfunktionen und das AGIL-Schema?
Systemfunktionen sind Aufgaben, die Systeme zur Bestands- und Grenzsicherung gegenüber Umweltveränderungen übernehmen müssen. Es gibt vier Systemfunktionen: Anpassungsfunktion (Adaption), Zielverwirklichungsfunktion (Goal Attainment), Integrationsfunktion (Integration) und Latenzfunktion (Latent Pattern Maintenance). Das AGIL-Schema (nach den Anfangsbuchstaben der Funktionen) repräsentiert diese Funktionen als Grundeigenschaften jedes Handlungssystems. Jedes System braucht alle Funktionen zum Bestehen.
Was ist die soziale Rolle in Parsons' Theorie?
Zu jeder Position, die ein Mensch in einer Gesellschaft einnimmt, gehören bestimmte Verhaltensweisen (Rollenerwartungen). Die Gesellschaft gibt der Person eine Rolle, die sie zu spielen hat, und schützt diese Rollenerwartungen durch Sanktionen. Entspricht die Person diesen Erwartungen, zeigt sich ein entsprechendes Rollenverhalten.
Wie ist das Rollensystem der Kernfamilie nach Parsons aufgebaut?
Die Kernfamilie ist die wichtigste Sozialisationsinstanz für das Kind. Die Rollenstruktur ist durch die Aufteilung in Generationsrollen (Eltern mit Macht/Autorität, Kinder mit Ohnmacht/Abhängigkeit) und Geschlechterrollen (Vater/Sohn mit instrumentellem Verhalten, Mutter/Tochter mit expressivem Verhalten) gekennzeichnet. Das Kind verinnerlicht sukzessive diese Rollenstruktur.
Was sind Mustervariablen (pattern variables) bzw. Wertorientierungen?
Mustervariablen sind Wertorientierungen, die das Kind im Sozialisationsprozess kennenlernt und zur Verfügung hat. Die fünf Wertorientierungen sind: Selbstorientierung vs. Kollektivorientierung, Spezifizierung vs. Diffusität, Affektivität vs. Neutralität, Partikularismus vs. Universalismus und Zuschreibung vs. Leistung. Sie dienen zur Kategorisierung von Objekten und zur Unterscheidung von Bedürfnisdispositionen. Diese Wertorientierungen werden nacheinander erworben und verinnerlicht und aus diesen Wertorientierungen muss der Handelnde in jeder Situation eine Auswahl treffen.
Wie verläuft der Sozialisationsprozess als Lernprozess?
Lernen ist bei Parsons die Antwort auf veränderte Situationsbedingungen. Nach Phasen der Frustration, Unterstützung, Verweigerung der Reziprozität und selektiver Belohnung lernt das Kind, erwünschte und unerwünschte Verhaltensweisen zu unterscheiden. Durch Konditionierung entsteht ein neues, angemessenes Verhaltensmuster. Der Sozialisationsprozess verläuft spiralförmig, wobei jeder neue Gleichgewichtszustand ein höheres Niveau einnimmt.
Welche Phasen des Sozialisationsprozesses gibt es?
Parsons orientiert sich an den psychosexuellen Entwicklungsphasen von Freud und Erikson: die Phase der oralen Abhängigkeit von der Mutter, die Phase der Liebesabhängigkeit von der Mutter, die ödipale Phase, die Latenzphase und die Adoleszenzphase. In jeder Phase erweitert der Heranwachsende seine Handlungskompetenzen und internalisiert bestimmte Wertorientierungen.
Welche Kritik wird an Parsons' strukturell-funktionaler Systemtheorie geübt?
Kritisiert wird vor allem die Annahme eines allgemeinen Norm- und Wertkonsenses, der in pluralistischen Gesellschaften fraglich ist. Die Theorie wird als zu stark auf die Anpassung des Individuums an die Gesellschaft ausgerichtet gesehen, ohne ausreichend Raum für individuelle Autonomie und Mitwirkung zu lassen. Weiterhin werden die Begriffskonstruktionen kritisiert und der Überprüfbarkeit entzogen.
- Quote paper
- Sonja Ganguin (Author), 2001, Die struktur-funktionale Systemtheorie von Talcott Parsons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100430