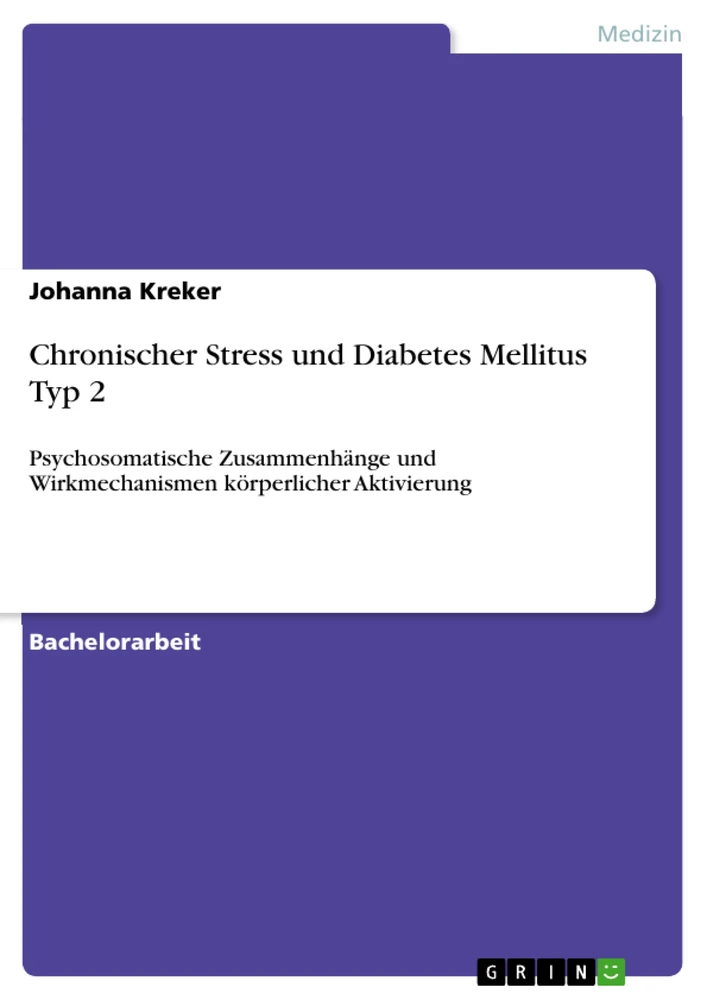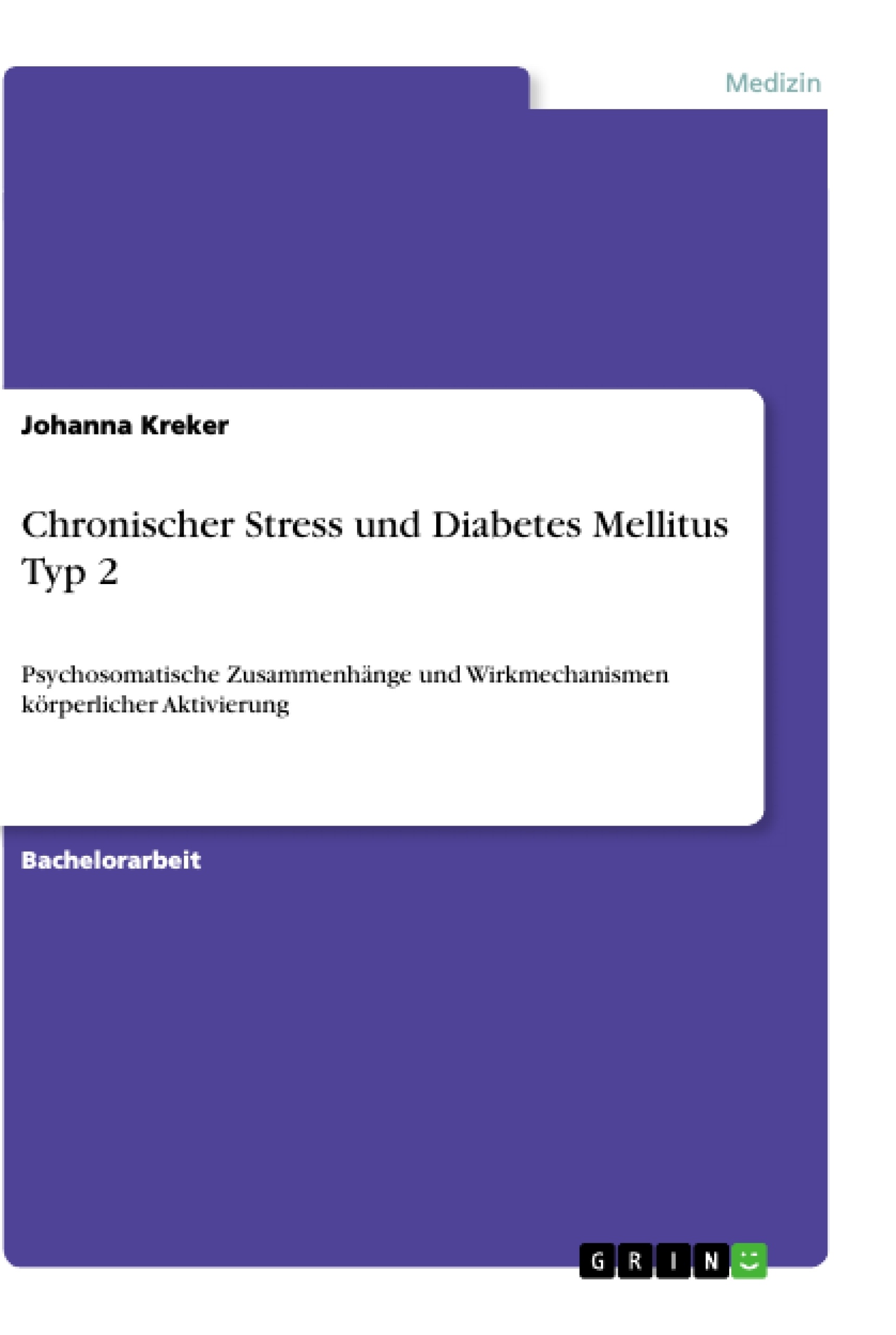Ziel dieser Arbeit ist die Darlegung des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstands bezüglich chronischen Stresses und dessen seelischer und körperlicher Auswirkungen anhand einer narrativen Übersichtsarbeit. Schwerpunktmäßig im Zusammenhang mit dem Auftreten von Depressionen, der Merkmale des Metabolischen Syndoms. In diesem Kontext sollte außerdem die gegenwärtige Studienlage zu den bio-psycho-sozialen Auswirkungen körperlicher Aktivierung, mit Schwerpunkt allgemeines aerobes Ausdauertraining sowie umfangs- und intensitätsorientierte Krafttrainingsmethoden dargestellt werden.
Auf Basis der aus der Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnisse soll anschließend die Ableitung eines praktikablen Handlungsansatzes im Sinne der Gesundheitsförderung und Prävention zur körperlichen Aktivierung erfolgen. Die Benennung weiterer, aus multimodaler Sicht erforderlicher Ergänzungen wird verlangt, um einem bio-pscho-sozialen Betreuungskonzept gerecht zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Problemstellung
- 2 Zielsetzung
- 3 Gegenwärtiger Kenntnisstand
- 3.1 Evolutionäre Entwicklung des Menschen bezüglich körperlicher Aktivität
- 3.2 Evolutionäre Mechanismen Stress
- 3.2.1 Stress
- 3.2.2 HPA-Achse
- 3.2.3 Hypercortisolismus
- 3.3 Definitionen/Ursachen/Symptome/Behandlungen
- 3.3.1 Metabolisches Syndrom
- 3.3.1.1 Definition
- 3.3.1.2 Ursachen
- 3.3.1.3 Symptome
- 3.3.1.4 Behandlung
- 3.3.2 Diabetes Typ-2
- 3.3.2.1 Definition
- 3.3.2.2 Entstehung
- 3.3.2.3 Hyperglykämie
- 3.3.2.4 Behandlung
- 3.3.2.5 Wirkwege körperlicher Aktivierung bei Diabetes Mellitus Typ-2
- 3.3.3 Chronischer Stress
- 3.3.3.1 Definition
- 3.3.3.2 Ursachen
- 3.3.3.3 Symptome
- 3.3.3.4 Behandlung
- 3.3.4 Depressionen
- 3.3.4.1 Definition/Symptome
- 3.3.4.2 Ursachen/Entstehung
- 3.3.4.3 Behandlung
- 3.3.4.4 Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS)
- 3.3.1 Metabolisches Syndrom
- 3.4 Wirkung von Kraft und Ausdauertraining
- 3.4.1 Krafttraining
- 3.4.1.1 Anpassung der Skelettmuskulatur
- 3.4.1.2 Anpassung auf neuromuskulärer Ebene
- 3.4.1.3 Anpassung auf hormoneller Ebene
- 3.4.2 Ausdauertraining
- 3.4.1 Krafttraining
- 4 Methodik
- 4.1 Suchbegriffe/Schlüsselwörter
- 4.2 Beispiel der Vorgehensweise bei der Literaturrecherche
- 4.3 Ausschlusskriterien
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Wirkwege und Auswirkungen körperlicher Aktivierung auf Depressionen, das Metabolische Syndrom und Stress
- 5.1.1 Wirkwege und Auswirkungen körperlicher Aktivierung auf Depressionen
- 5.1.2 Zusammenhänge Metabolisches Syndrom und Depressionen
- 5.1.3 Wirkwege körperlicher Aktivierung auf Stress
- 5.1 Wirkwege und Auswirkungen körperlicher Aktivierung auf Depressionen, das Metabolische Syndrom und Stress
- 6 Diskussion
- 6.1 Ableitung eines Handlungsansatzes aus dem Bereich der körperlichen Aktivierung
- 6.2 Ernährungsplan
- 6.2.1 Handlungsansatz Ernährung
- 6.3 Nahrungsergänzungsmittel
- 6.3.1 Vitamin D3
- 6.3.2 Omega-3 Fettsäuren
- 6.3.3 Apfelessig
- 6.4 Aktuelle Forschungen zum Thema körperliche Aktivierung und Stress
- 6.5 Mögliche körperliche und psychische Folgen der Corona-Pandemie
- 6.6 Kritische Würdigung der eigenen Leistung
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die psychosomatischen Zusammenhänge zwischen chronischem Stress und Diabetes Mellitus Typ 2. Ziel ist es, den Einfluss körperlicher Aktivierung auf diese Zusammenhänge zu beleuchten und mögliche Wirkmechanismen zu identifizieren.
- Chronischer Stress als Risikofaktor für Diabetes Typ 2
- Wirkmechanismen körperlicher Aktivität auf den Stoffwechsel
- Der Einfluss von Bewegung auf psychische Gesundheit (Depressionen)
- Zusammenhang zwischen metabolischem Syndrom, Depression und chronischem Stress
- Entwicklung eines Handlungsansatzes zur Prävention und Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Problemstellung: Die Einleitung beschreibt die hohe Prävalenz von Diabetes Typ 2 und Adipositas weltweit, die durch Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung verursacht werden. Sie hebt die gesellschaftliche Stigmatisierung Betroffener hervor und betont den Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit, ungesunder Ernährung (insbesondere hohem Kohlenhydratkonsum), Insulinresistenz und dem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes. Weiterhin wird der zunehmende Stress am Arbeitsplatz und die hohe Prävalenz von Depressionen thematisiert, mit dem Fokus auf den Bedarf an effektiven Interventionsmaßnahmen. Der Zusammenhang zwischen metabolischem Syndrom und Depression, sowie der positive Einfluss von Gewichtsabnahme auf kardiovaskuläre Risikofaktoren wird ebenfalls erwähnt. Die Bedeutung der Ernährung im Kontext von Diabetes und psychischer Gesundheit wird schließlich hervorgehoben.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Psychosomatische Zusammenhänge zwischen chronischem Stress und Diabetes Mellitus Typ 2
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die psychosomatischen Zusammenhänge zwischen chronischem Stress und Diabetes Mellitus Typ 2. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss körperlicher Aktivität auf diese Zusammenhänge und der Identifizierung möglicher Wirkmechanismen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, den Einfluss körperlicher Aktivierung auf die Zusammenhänge zwischen chronischem Stress und Diabetes Typ 2 zu beleuchten und mögliche Wirkmechanismen zu identifizieren. Es soll ein Handlungsansatz zur Prävention und Intervention entwickelt werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Chronischer Stress als Risikofaktor für Diabetes Typ 2; Wirkmechanismen körperlicher Aktivität auf den Stoffwechsel; Einfluss von Bewegung auf die psychische Gesundheit (Depressionen); Zusammenhang zwischen metabolischem Syndrom, Depression und chronischem Stress; Entwicklung eines Handlungsansatzes zur Prävention und Intervention.
Welche Aspekte des gegenwärtigen Kenntnisstands werden beleuchtet?
Der aktuelle Kenntnisstand umfasst die evolutionäre Entwicklung des Menschen bezüglich körperlicher Aktivität, evolutionäre Mechanismen von Stress (inkl. HPA-Achse und Hypercortisolismus), Definitionen, Ursachen, Symptome und Behandlungen von metabolischem Syndrom, Diabetes Typ 2, chronischem Stress und Depressionen. Weiterhin wird die Wirkung von Kraft- und Ausdauertraining auf den Körper behandelt.
Wie wurde die Methodik der Arbeit gestaltet?
Die Methodik beschreibt die verwendeten Suchbegriffe/Schlüsselwörter, ein Beispiel der Vorgehensweise bei der Literaturrecherche und die angewandten Ausschlusskriterien.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse präsentieren die Wirkwege und Auswirkungen körperlicher Aktivierung auf Depressionen, das Metabolische Syndrom und Stress. Es werden die Zusammenhänge zwischen metabolischem Syndrom und Depressionen sowie die Wirkwege körperlicher Aktivierung auf Stress beleuchtet.
Wie wird die Diskussion der Ergebnisse strukturiert?
Die Diskussion leitet einen Handlungsansatz aus dem Bereich der körperlichen Aktivierung ab, beinhaltet einen Ernährungsplan mit Handlungsansatz, betrachtet Nahrungsergänzungsmittel (Vitamin D3, Omega-3 Fettsäuren, Apfelessig), diskutiert aktuelle Forschungen zum Thema körperliche Aktivierung und Stress, analysiert mögliche körperliche und psychische Folgen der Corona-Pandemie und schließt mit einer kritischen Würdigung der eigenen Leistung.
Was beinhaltet die Zusammenfassung?
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit zusammen.
Welche konkreten Kapitel sind im Inhaltsverzeichnis enthalten?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst Kapitel zu Einleitung und Problemstellung, Zielsetzung, Gegenwärtigem Kenntnisstand (inkl. detaillierter Unterkapitel zu verschiedenen Erkrankungen und Trainingseffekten), Methodik, Ergebnissen, Diskussion (inkl. detaillierter Unterkapitel zu Handlungsansätzen, Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln und aktuellen Forschungsergebnissen) und Zusammenfassung.
- Quote paper
- Johanna Kreker (Author), 2020, Chronischer Stress und Diabetes Mellitus Typ 2, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1004267