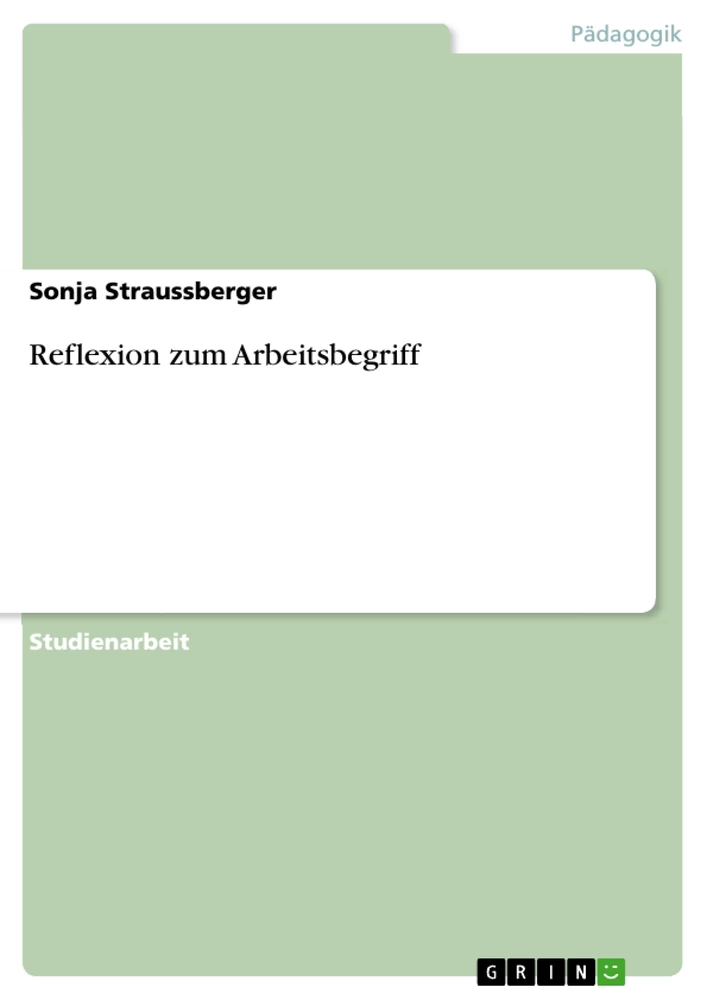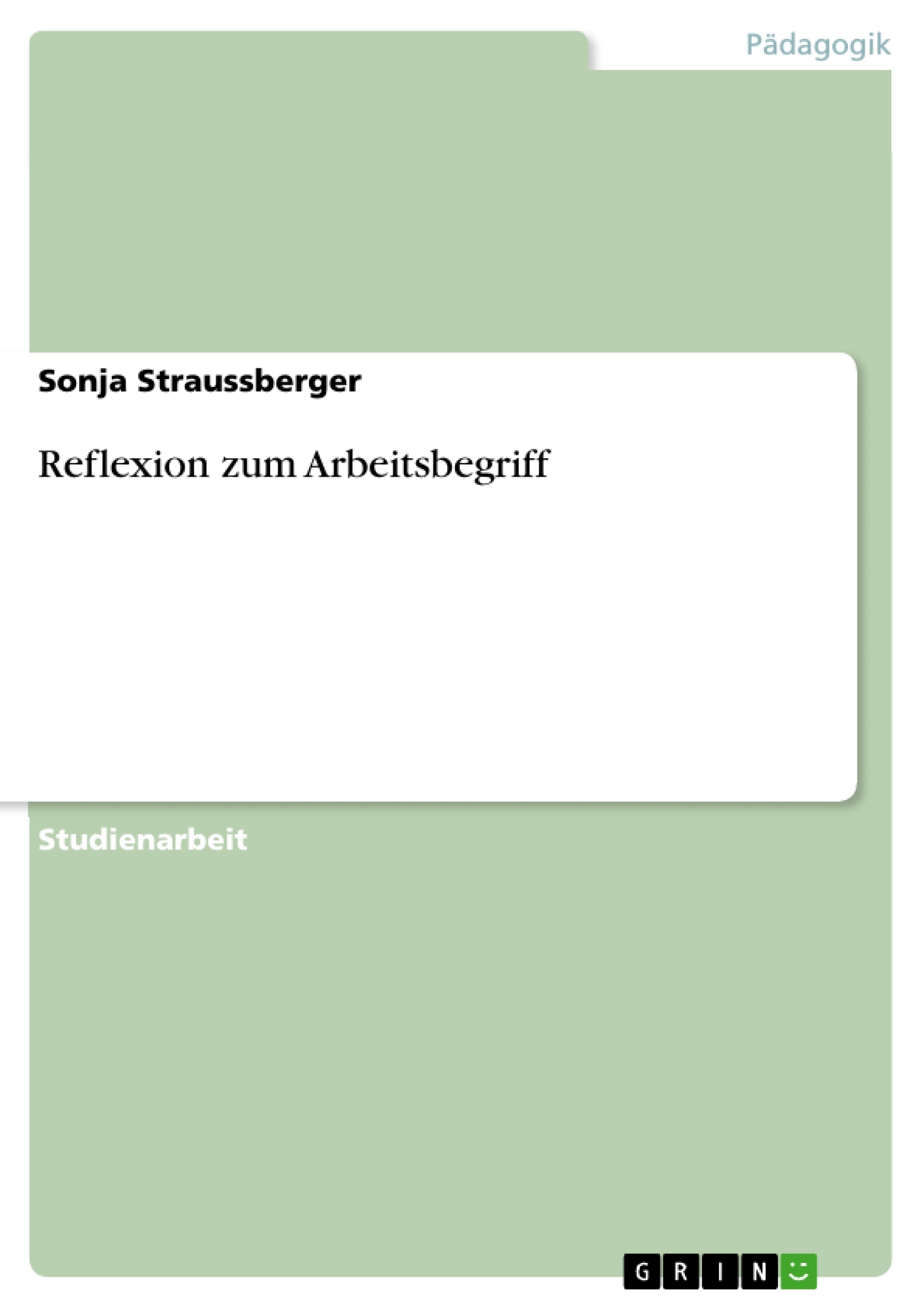Was bedeutet Arbeit wirklich in einer Welt, die sich rasant wandelt? Diese Frage durchdringt unser Leben, unsere Identität und unsere Gesellschaft. Jenseits von bloßer Erwerbstätigkeit offenbart sich Arbeit als ein vielschichtiges Konzept, das von historischen, sozialen und individuellen Perspektiven geprägt ist. Die vorliegende Reflexion ergründet die unterschiedlichen Facetten des Arbeitsbegriffs, von der Antike bis zur modernen Wissensgesellschaft. Sie beleuchtet, wie sich die Bedeutung von Arbeit im Laufe der Zeit gewandelt hat – von einer verachteten Tätigkeit zur Quelle der Selbstverwirklichung und Identitätsfindung. Dabei werden die Widersprüche und Spannungen unserer heutigen Arbeitswelt schonungslos aufgedeckt: die Suche nach Arbeitsplätzen bei gleichzeitiger Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, die Angst vor Arbeitslosigkeit und die Sehnsucht nach Freizeit. Im Fokus steht die Frage, wie Arbeit unsere Gesellschaft strukturiert und unser Selbstverständnis prägt. Welche Rolle spielt der Verdienst? Wie beeinflusst die Arbeit unsere Identität und unser Selbstwertgefühl? Welche Alternativen gibt es in einer Zeit, in der Arbeitslosigkeit ein weitverbreitetes Problem darstellt? Die Analyse betrachtet die Bedeutung von Arbeit für unterschiedliche Gruppen, von Arbeitern und Hausfrauen bis hin zu Studenten und Arbeitslosen. Sie zeigt auf, wie Milieu, Umfeld und technologische Fortschritte unsere Arbeitsdefinition beeinflussen. Abschließend wird die These aufgestellt, dass die Arbeitsgesellschaft zunehmend von einer Wissensgesellschaft abgelöst wird, in der lebenslanges Lernen an die Stelle des traditionellen Arbeitens tritt. Diese Transformation eröffnet neue Möglichkeiten der Identitätsbildung und stellt das Konzept der Leistung in einem veränderten Kontext dar. Eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit einem Begriff, der unser Leben maßgeblich bestimmt und dessen Verständnis entscheidend für die Gestaltung unserer Zukunft ist. Diese Arbeit regt dazu an, die eigene Einstellung zur Arbeit zu hinterfragen und neue Perspektiven für eine erfüllende und sinnstiftende Tätigkeit zu entwickeln. Ein unverzichtbarer Beitrag zur aktuellen Debatte über Arbeit, Gesellschaft und Identität im 21. Jahrhundert, der sowohl für Wissenschaftler als auch für all jene von Interesse ist, die sich mit den grundlegenden Fragen unserer Zeit auseinandersetzen möchten.
Reflexion zum Arbeitsbegriff
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich mit dem Verständnis des Begriffes der ,,Arbeit" auseinandersetzen. Folgendes Zitat bringt zahlreiche Widersprüche dieses Thema betreffend zum Ausdruck:
,,Wir suchen die Arbeit, wir verrichten sie, wir sind gleichermaßen bestrebt, sie zu erhalten und zu verringern (,Arbeitsplatzsicherung` und ,Arbeitszeitverkürzung`), wir scheuen die Arbeitslosigkeit und kämpfen um jede zusätzliche Minute Freizeit (=Nicht-Arbeitszeit), wir verabscheuen die Arbeitsscheuen und scheuen doch vor mancher Arbeit zurück, die wir an Hilfsarbeiter, Fremdarbeiter, Gastarbeiter abschieben. Zuweilen vergnügen wir uns in der Arbeitszeit, noch öfter jedoch arbeiten wir in der Freizeit. Kinderarbeit ist verboten, aber die Kinder schreiben Schularbeiten und Hausarbeiten. Der Mann sitzt im Büro und arbeitet, die Hausfrau werkt in Haus und Garten und arbeitet nicht. Oder doch? Was ist Arbeit wirklich?" (Swoboda, 1979, zit. n. Floiger, M., 1994)
Arbeit ist etwas, was sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Im Verlauf der Geschichte finden sich in verschiedenen Zeitabschnitten sehr unterschiedliche Darstellungen. Von der Nicht- Schätzung der Arbeit in der Antike über Arbeit als Sühne bis hin zur Arbeit als Produktionsmittel. Die Arbeiterbewegung sieht Arbeit als Quelle der Kultur, in der die Möglichkeit zur Menschwerdung besteht. In verschiedenen Zeitaltern waren unterschiedliche Auffassungen vorherrschend, die einen Bedeutungswandel von negativ zu positiv zum Ausdruck bringen. Welche ist die in der heutigen Zeit vorherrschende Auffassung? Je nachdem, an wen man die Frage nach Arbeit richtet, erhält man unterschiedliche Antworten.
Fragt man einen Arbeiter danach, könnte er Arbeit als etwas bezeichnen, was leider sein muss, da ,,man(n)" Geld verdienen muss, aber doch nicht so wirklich Spaß macht. Eine Hausfrau, die für ihre Familie sorgt, wird ihre Tätigkeit ebenfalls als Arbeit bezeichnen, auch wenn sie kein Geld dafür bekommt. Und auch Studieren und Lernen ist harte Arbeit, noch dazu wenn man nicht weiß, ob man nach Abschluss des Studiums je Geld damit verdienen kann. Aber es muss noch mehr Arbeit investiert werden, um die Wahrscheinlichkeit dessen zu erhöhen.
Arbeit als notwendiges Übel, Arbeit als Zeitvertreib, Arbeit als Vergnügen, Arbeit als Voraussetzung für etwas, aber auch ein Hindernis vor etwas.
Durch die Arbeit kann zum Ausdruck gebracht werden, dass man von anderen gebraucht wird, jedoch kann man genauso seine persönlichen Ziele erreichen, seine eigenen Grundbedürfnisse abdecken, zu persönlicher Erkenntnis gelangen.
Ein wesentliches Kriterium der Arbeit scheint der Verdienst zu sein. Damit verbunden ist die Problematik, dass an vieles erst das Attribut ,,-arbeit" angefügt werden muss, damit es etwas wert ist. Aber auch dieses scheint nicht mehr in jedem Fall ausreichend zu sein, wenn man an das Beispiel der ,,Hausarbeit" denkt, welches auch schon unter dem Begriff ,,Haushaltsmanagement" zu finden ist, um dessen Wertigkeit zu erhöhen. Für viele vorherrschend ist in dieser Beziehung die Verbindung zu Geld, es ist aber auch möglich, Erfolg auf anderen Ebenen zu haben, wenn man Arbeit geleistet hat. So sind die Anerkennung von anderen, das Gefühl, etwas Sinnvolles vollbracht zu haben, einen Schritt zu einem wichtigen Ziel weitergekommen zu sein, ebenfalls wichtige Konsequenzen von Arbeit. In Zeiten mangelnder Arbeitsplätze ist es notwendig, sich von der materiellen Verknüpfung der Arbeit mit Geld zu entfernen, da diese keine Selbstverständlichkeit mehr darstellt.
Arbeit ist Selbstverwirklichung und Identitätsfindung. Bevor sich der Taylorismus mit der Arbeitszerlegung in kleine Produktionsschritte durchgesetzt hat, war die Arbeit befriedigender, sinnvoller. Nach der Sinnhaftigkeit wird aber nicht gefragt, denn der Sinn der Arbeit besteht für viele darin, das dafür erhaltene Geld in Waren umzutauschen. Es ist oft der Wunsch nach einem größeren Einkommen, nach mehr Konsum und Luxus, der Druck der sozialen Umwelt, der den Erwerb von manchen Prestigegütern erzwingt, der über den Willen zur Selbstverwirklichung triumphiert. Wie wichtig die Arbeit für die Identität der Person ist, wird vielfach erst wahrgenommen, wenn keine Arbeit mehr da ist. Arbeit gibt dem Tag seine Struktur, um diese herum wird alles aufgebaut. Ein Mangel an dieser kann möglicherweise zu einem Gefühl der Hilflosigkeit führen. In Zeiten der Arbeitslosigkeit ist es nicht ausreichend, seine Identität über Arbeit zu bilden, da man sich ihrer nie sicher sein kann. Immerhin ist von der Arbeit, die jemand ausübt, seine gesellschaftliche Wertschätzung abhängig. Höhere Sprossen auf der Leiter der sozialen Schicht nach oben lassen sich durch die Wahl von bestimmten Arbeitsformen erreichen. Ein anderer Weg der Identitätsbildung ist aber auch über die Durchführung ehrenamtlicher Tätigkeiten oder durch ein bestimmtes Freizeitverhalten feststellbar.
Von Seiten der Wissenschaften gibt es zahlreiche Versuche, den Begriff ,,Arbeit" transparenter zu machen. Die Physik, die Psychologie, es gibt sogar eine eigene Arbeitswissenschaft, welche eine interdisziplinäre Wissenschaft darstellt, die sich damit beschäftigt, die Arbeitsprozesse zu analysieren, zu ordnen und zu gestalten, mit dem Ziel von schädigungsloser und beeinträchtigungsfreier Arbeit unter Einhaltung zeitgemäßer Standards, in der sich die Fähigkeiten des arbeitenden Menschen entfalten und weiterentwickeln können (Luzcak, 1997). Hingegen begnügt sich die Physik mit der Feststellung, dass Arbeit dann verrichtet wird, wenn eine Kraft auf einen Körper einwirkt und sich der Körper dabei um eine bestimmte Strecke verschiebt.
Damit unser Gesellschaftssystem funktioniert, ist es nötig, dass die Menschen Arbeit als höchste Pflicht für jedes anständige Gesellschaftsmitglied zu definieren. Es gab jedoch schon immer diejenigen, die nicht arbeiten mussten und andere für sich arbeiten lassen konnten. Dadurch werden Gefühle von Ungerechtigkeit geschaffen und das Entstehen von Vorurteilen unterstützt. Doch was würde passieren, wenn sich immer weniger dieser Meinung anschließen würden? Natürlich ist Arbeit für die meisten dazu notwendig, das Überleben zu sichern. Ob dies durch den Tausch von Geld oder Gütern geschieht, oder jeder für seine Verpflegung selbst die Nahrungsmitteln produziert, eine bestimmte Art von Aufwand bleibt jeweils dasselbe.
Arbeitslose haben eine andere Art, Arbeit zu definieren. Für sie wird dieser Begriff besonders wertvoll, da es etwas ist, was nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung steht. Wie ist es mit dem Recht auf und der Pflicht zur Arbeit in einer Zeit, in der die Arbeitslosigkeit ein Problem für viele darstellt? Die Einstellung zur finanziellen Unterstützung von Arbeitslosen seitens des Staates sowie das Aufrechterhalten von staatlichen Stellen, die diese finanzieren, ist davon abhängig. Oft scheint eher eine negative Sichtweise vorrangig zu sein. Aber so schädlich wie ein Zuwenig an Arbeit für die Betroffenen ist, ist es auch ein Zuviel an Arbeit. Auf die sogenannte Arbeitssucht ist man schon vor einiger Zeit aufmerksam geworden.
Das Milieu und das Umfeld beeinflussen die Arbeitsdefinition. Aber trotzdem wird das, was man gerade tut, vorrangig als ,,Arbeit" bezeichnet, um dadurch mehr Anerkennung zu bekommen, da dafür auch Mühen auf sich genommen werden. Herkömmlicherweise ist Arbeit immer auf körperliche Arbeit bezogen.
Sind die Forderungen nach Verkürzung der Arbeitszeit nicht überholt, da sie doch auf eine Zeit zurückgehen, als Arbeit noch Arbeitsleid war. Heute sind die Anstrengungen doch außerhalb der Arbeitszeit oft viel größer. Und es bestehen sogar Empfehlungen dahingehend, dass sportliches Training in der Freizeit die Arbeitsleistung verbessert.
Durch den technologischen Fortschritt haben sich die Arbeitsbedingungen für einen großen Teil verbessert und die körperliche Arbeit ist reduziert worden. Dies betrifft jedoch eher die westlichen Kulturen. Andererseits sind die Anforderungen an die Konzentration und die psychischen Belastungen gestiegen. Bestimmte Produktionsformen werden eher in andere Teile der Welt ausgelagert. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welchen Stellenwert die Arbeit in anderen Kulturen hat? In jeder Kultur werden hohe Positionen über die damit verbundene Arbeit bestimmt. Oft steht diese mit religiösen Tätigkeiten in Zusammenhang, und mit solchen, die mit Heilen zu tun haben, so etwa die Ärzte in unserer Kultur oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, der klassische Medizinmann.
Weiters ist es in diesem Zusammenhang auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Arbeit eine eigene Lebensphase darstellt. Die Zeit vor dieser Phase wird in unserer Gesellschaft wohl als Vorbereitung darauf gesehen, welches eine wesentliche Aufgabe von Bildungseinrichtungen ist. Und die Zeit danach soll als Erholung vom Arbeitsprozess dienen.
Aber die Arbeit wird weniger. Das, was Arbeit war, gibt es nicht mehr, deshalb ist es so schwer, eine einheitliche Definition zu finden. Es muss etwas dafür gefunden werden, was an die Stelle der Arbeit tritt und wieder für alle zugänglich sein kann. Und diesen Platz nehmen zunehmend die Informationen beziehungsweise das Wissen ein. Schon seit einiger Zeit wird vom Übergang der Arbeitsgesellschaft zur Informationsgesellschaft und zur Wissensgesellschaft gesprochen. An die Stelle des Arbeitens tritt Lernen. Man erwartet heute von über 20jährigen nicht mehr, auf eigenen Beinen zu stehen, sie brauchen sich nur weiterzubilden lassen. Bislang war es so, dass Studenten während der Ausbildung als von niedrigem Rang angesehen wurden, jedoch mit dem Abschluss des Studiums klettern sie an die oberste Stufe der Gesellschaftshierarchie. Mittlerweile wird ständige Weiterbildung als Grundlage für beruflichen Erfolg gesehen. Vielleicht hat dies auch Auswirkungen auf das Ansehen der Studenten. Der Slogan des ,,lebenslangen Lernens" findet sich in zahlreichen Organisationen. Wenn die Arbeit weniger wird, kann ,,lebenslanges Arbeiten" in ,,lebenslanges Lernen" übergehen. Dieser Prozess könnte auch neue Formen der Identitätsbildung anbieten. In Zukunft zählt vielleicht nicht mehr die Arbeitsleistung, sondern die Wissensleistung, die sich in unterschiedlichen Bedingungen jeweils flexibel einbringen lässt und ständigen Veränderungen unterliegt. Das Konzept der Leistung wird vielleicht weiterhin ein Bestimmendes sein, nur wird es unter anderen Bedingungen vollzogen.
Literatur
Floinger, M. (1994). Arbeit, Arbeitszeit und Freizeit. Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag GmbH.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Fokus der Reflexion zum Arbeitsbegriff?
Der Text setzt sich mit dem vielschichtigen Verständnis des Begriffs "Arbeit" auseinander und beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen im Laufe der Geschichte, von der Antike bis zur modernen Gesellschaft.
Wie wird Arbeit im Text definiert?
Der Text zeigt, dass Arbeit sehr unterschiedlich ausgelegt wird und verschiedene Bedeutungen haben kann, wie z.B. notwendiges Übel, Zeitvertreib, Vergnügen, Voraussetzung für etwas oder Hindernis vor etwas.
Welche Rolle spielt der Verdienst bei der Definition von Arbeit?
Ein wesentliches Kriterium der Arbeit scheint der Verdienst zu sein, wobei die Problematik besteht, dass an vieles erst das Attribut "Arbeit" angefügt werden muss, damit es etwas wert ist. Der Text hebt aber auch die Bedeutung von Anerkennung, Sinnhaftigkeit und persönlicher Zielerreichung als wichtige Konsequenzen von Arbeit hervor.
Wie beeinflusst Arbeit die Identität einer Person?
Arbeit ist Selbstverwirklichung und Identitätsfindung. Der Text betont, dass Arbeit dem Tag eine Struktur gibt und die gesellschaftliche Wertschätzung einer Person oft von der ausgeübten Arbeit abhängt. Allerdings wird auch die Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Freizeitverhalten für die Identitätsbildung angesprochen.
Welche wissenschaftlichen Ansätze gibt es zur Erforschung von Arbeit?
Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Versuche, den Begriff "Arbeit" transparenter zu machen, z.B. durch die Physik, die Psychologie und die Arbeitswissenschaft, die sich mit der Analyse, Ordnung und Gestaltung von Arbeitsprozessen beschäftigt.
Welche Bedeutung hat Arbeit für die Gesellschaft?
Für das Funktionieren unseres Gesellschaftssystems ist es nötig, dass die Menschen Arbeit als höchste Pflicht für jedes anständige Gesellschaftsmitglied definieren. Arbeitslosigkeit wird als Problem thematisiert, und es wird auf die Problematik der finanziellen Unterstützung von Arbeitslosen sowie die Gefahr von Arbeitssucht hingewiesen.
Wie beeinflussen Milieu und Umfeld die Arbeitsdefinition?
Milieu und Umfeld beeinflussen die Arbeitsdefinition. Traditionell wird Arbeit oft auf körperliche Arbeit bezogen. Der Text stellt die Frage, ob die Forderungen nach Verkürzung der Arbeitszeit überholt sind, da die Anstrengungen oft außerhalb der Arbeitszeit größer sind.
Welchen Einfluss hat der technologische Fortschritt auf die Arbeitsbedingungen?
Durch den technologischen Fortschritt haben sich die Arbeitsbedingungen für einen großen Teil verbessert und die körperliche Arbeit ist reduziert worden. Andererseits sind die Anforderungen an die Konzentration und die psychischen Belastungen gestiegen. Bestimmte Produktionsformen werden eher in andere Teile der Welt ausgelagert.
Welche Rolle spielt Arbeit in anderen Kulturen?
In jeder Kultur werden hohe Positionen über die damit verbundene Arbeit bestimmt. Oft steht diese mit religiösen Tätigkeiten in Zusammenhang, und mit solchen, die mit Heilen zu tun haben.
Wie verändert sich die Bedeutung von Arbeit in der heutigen Zeit?
Die Arbeit wird weniger. An die Stelle des Arbeitens tritt Lernen. Es wird vom Übergang der Arbeitsgesellschaft zur Informationsgesellschaft und zur Wissensgesellschaft gesprochen. "Lebenslanges Lernen" kann an die Stelle von "lebenslangem Arbeiten" treten und neue Formen der Identitätsbildung anbieten.
Welche Zukunftsperspektiven werden im Text für die Arbeit aufgezeigt?
In Zukunft zählt vielleicht nicht mehr die Arbeitsleistung, sondern die Wissensleistung, die sich in unterschiedlichen Bedingungen jeweils flexibel einbringen lässt und ständigen Veränderungen unterliegt. Das Konzept der Leistung wird vielleicht weiterhin ein Bestimmendes sein, nur wird es unter anderen Bedingungen vollzogen.
- Citation du texte
- Sonja Straussberger (Auteur), 2001, Reflexion zum Arbeitsbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100407