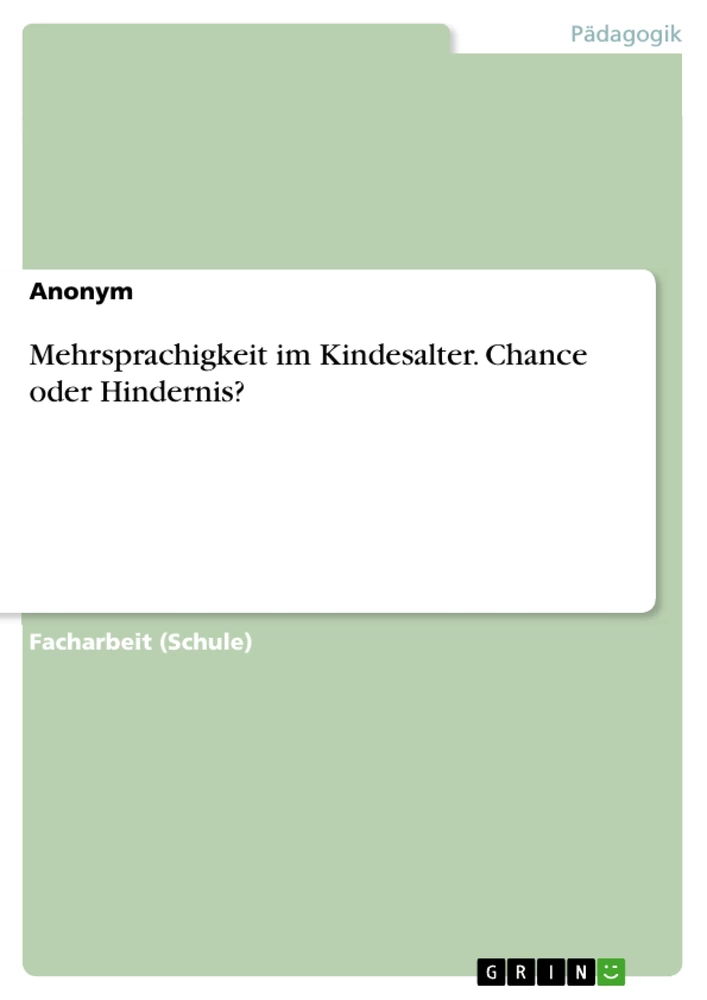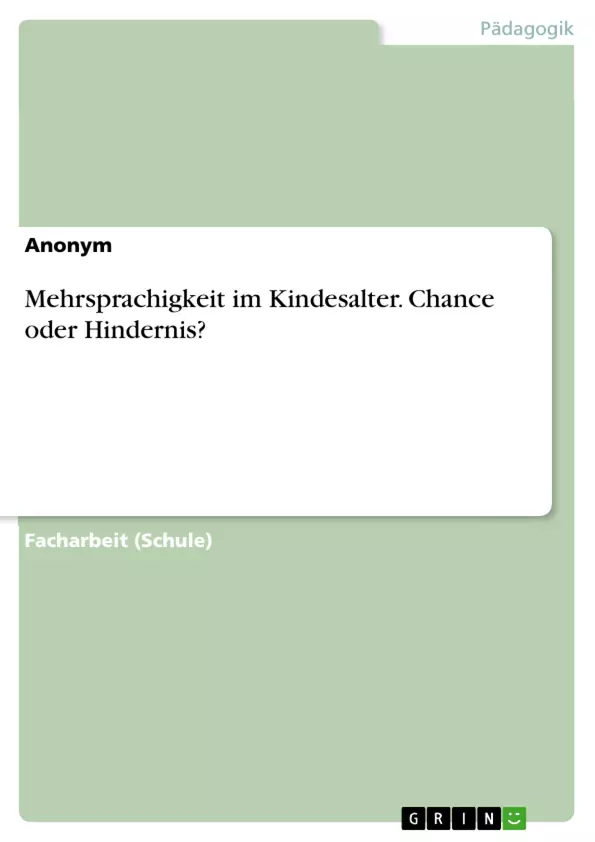Als zentrale Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden soll, fungiert die Frage, ob die negativen und positiven Vermutungen und Vorurteile, die viele gegenüber Mehrsprachigkeit im Kindesalter hegen, in Wirklichkeit vielmehr eine Chance oder ein Hindernis für die Entwicklung des Kindes bedeuten. Diese zentrale Forschungsfrage erfordert Antworten auf weitere Fragen, die im Laufe der Arbeit ausführlich beantwortet und erläutert werden.
Zur Beantwortung der aufgeworfenen Forschungsfrage wird in dieser Arbeit wie folgt vorgegangen: Die Arbeit umfasst vier Kapitel. Das erste Kapitel widmet sich der Begriffserklärung und Definition von Mehrsprachigkeit. Darauf aufbauend wird der Begriff Mehrsprachigkeit weitergehend untersucht, da das zweite Kapitel sich mit der Typunterscheidung und den verschiedenen Arten von Mehrsprachigkeit befasst. Im Fokus des dritten Kapitels stehen die Vorurteile und Klischees, die eine Menge Eltern, Pädagogen und Sprachwissenschaftler haben. Diese Arbeit möchte genau diese Vorbehalte kritisch beleuchten und konzentriert sich darauf mögliche Chancen oder Hindernisse von multilingualer Erziehung in der frühen Kindheit zu diskutieren.
Als Grundlage für eine der erarbeiteten Thesen, ist eine eigenhändig durchgeführte Umfrage ebenfalls ein Teil des Kapitels. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, persönlichen Erfahrungen mit mehrsprachiger Erziehung und einem kurzen Ausblick auf die zusammengetragenen Vorurteile und deren Wirklichkeit ab. Insbesondere ist das Ziel der vorliegenden Arbeit zu untersuchen, ob durch den Einsatz von mehrsprachiger Erziehung ein Kind in seiner persönlichen, sprachlichen und geistigen Entwicklung gefördert oder eher beeinträchtigt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung (Fragestellung, Zielsetzung und methodisches Vorgehen)
- 2. Definition: Mehrsprachigkeit
- 2.1. Unterschied zwischen Zweit- und Fremdsprache
- 2.2. Mehrsprachigkeit als der Normalfall
- 3. Arten von Mehrsprachigkeit
- 3.1. Art des Spracherwerbs
- 3.2. Gesellschaftliche Bedingungen
- 3.3. Formen der Kompetenz
- 4. Vorurteile von Mehrsprachigkeit im Kindesalter
- 4.1. Hindernis
- 4.1.1. Mythos der doppelten Halbsprachigkeit
- 4.1.2. Je früher, desto besser?
- 4.2. Chance
- 4.2.1. Kognitive und geistige Leistungsfähigkeit
- 4.2.2. Mythos der Sprachverwirrung
- 4.2.3. Sprachentwicklungsstörungen
- 4.2.4. Berufschancen
- 4.1. Hindernis
- 5. Fazit (Eigene Meinung zum Thema, persönliche Erfahrung, Rückblick auf meine Vorgehensweise)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile mehrsprachiger Erziehung im Kindesalter. Sie beleuchtet die verschiedenen Arten von Mehrsprachigkeit und die damit verbundenen Vorurteile. Das Hauptziel ist es, die Frage zu beantworten, ob mehrsprachige Erziehung eher ein Hindernis oder eine Chance für die Entwicklung des Kindes darstellt.
- Definition und Arten von Mehrsprachigkeit
- Unterschied zwischen simultanem und sukzessivem Spracherwerb
- Gesellschaftliche Bedingungen und ihre Auswirkungen auf Mehrsprachigkeit
- Vorurteile und Mythen über mehrsprachige Kinder
- Positive und negative Aspekte mehrsprachiger Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung (Fragestellung, Zielsetzung und methodisches Vorgehen): Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Chancen und Hindernissen mehrsprachiger Erziehung im Kindesalter. Sie begründet die Relevanz des Themas im Kontext von Globalisierung und Migration und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition von Mehrsprachigkeit, verschiedene Arten von Mehrsprachigkeit, gängige Vorurteile und ein abschließendes Fazit umfasst. Die Arbeit untersucht, ob mehrsprachige Erziehung die persönliche, sprachliche und geistige Entwicklung eines Kindes fördert oder beeinträchtigt.
2. Definition: Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Mehrsprachigkeit“ und differenziert ihn von anderen Begriffen wie Zweit- und Fremdsprache. Es betont, dass Mehrsprachigkeit mehr als nur das Sprechen mehrerer Sprachen umfasst, sondern auch das Verstehen, Lesen und Schreiben einschließt. Es wird auf verschiedene Definitionen eingegangen und der Unterschied zwischen dem Erwerb einer Zweit- und einer Fremdsprache herausgearbeitet, wobei der Fokus auf dem Kontext des Spracherwerbs liegt (automatisch vs. gesteuert).
3. Arten von Mehrsprachigkeit: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Aspekte, die zur Typisierung von Mehrsprachigkeit beitragen. Es differenziert zwischen simultanem und sukzessivem Spracherwerb, wobei der simultane Erwerb in den ersten drei Lebensjahren stattfindet, und dem sukzessiven Erwerb, der später, etwa im Kindergartenalter oder sogar noch später, stattfindet. Des Weiteren werden die gesellschaftlichen Bedingungen (individuelle, institutionelle, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit) und verschiedene Kompetenzformen von Mehrsprachigkeit betrachtet und deren Zusammenhänge erläutert.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Multilingualität, Spracherwerb, Zweitsprache, Fremdsprache, simultaner Spracherwerb, sukzessiver Spracherwerb, gesellschaftliche Bedingungen, Vorurteile, Mythen, kognitive Entwicklung, Sprachentwicklungsstörungen, Chancen, Hindernisse, individuelle Mehrsprachigkeit, institutionelle Mehrsprachigkeit, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit, Code-Switching.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mehrsprachige Erziehung im Kindesalter
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile mehrsprachiger Erziehung im Kindesalter. Sie beleuchtet verschiedene Arten von Mehrsprachigkeit und die damit verbundenen Vorurteile. Das Hauptziel ist es, zu klären, ob mehrsprachige Erziehung eher ein Hindernis oder eine Chance für die Entwicklung des Kindes darstellt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Arten von Mehrsprachigkeit, den Unterschied zwischen simultanem und sukzessivem Spracherwerb, gesellschaftliche Bedingungen und deren Auswirkungen auf Mehrsprachigkeit, Vorurteile und Mythen über mehrsprachige Kinder sowie positive und negative Aspekte mehrsprachiger Erziehung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Fragestellung, Zielsetzung und methodisches Vorgehen), Definition von Mehrsprachigkeit, Arten von Mehrsprachigkeit, Vorurteile von Mehrsprachigkeit im Kindesalter und ein Fazit. Jedes Kapitel wird detailliert in der Inhaltsangabe erläutert.
Wie wird Mehrsprachigkeit definiert?
Der Begriff "Mehrsprachigkeit" wird definiert und von Begriffen wie Zweit- und Fremdsprache abgegrenzt. Es wird betont, dass Mehrsprachigkeit mehr als nur das Sprechen mehrerer Sprachen umfasst, sondern auch das Verstehen, Lesen und Schreiben einschließt. Der Unterschied zwischen dem Erwerb einer Zweit- und einer Fremdsprache wird anhand des Kontextes des Spracherwerbs (automatisch vs. gesteuert) herausgearbeitet.
Welche Arten von Mehrsprachigkeit werden unterschieden?
Es wird zwischen simultanem (in den ersten drei Lebensjahren) und sukzessivem Spracherwerb (später) unterschieden. Zusätzlich werden gesellschaftliche Bedingungen (individuelle, institutionelle, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit) und verschiedene Kompetenzformen von Mehrsprachigkeit betrachtet.
Welche Vorurteile gegenüber mehrsprachiger Erziehung werden behandelt?
Die Arbeit widmet sich gängigen Vorurteilen und Mythen über mehrsprachige Kinder, wie dem Mythos der doppelten Halbsprachigkeit und der Sprachverwirrung. Sie untersucht aber auch die Chancen mehrsprachiger Erziehung, wie die positive Beeinflussung der kognitiven und geistigen Leistungsfähigkeit und die Verbesserung der Berufschancen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt eine persönliche Meinung zum Thema ab. Es wird ein Rückblick auf die Vorgehensweise gegeben. Die Arbeit soll die Frage beantworten, inwieweit mehrsprachige Erziehung die persönliche, sprachliche und geistige Entwicklung eines Kindes fördert oder beeinträchtigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Mehrsprachigkeit, Multilingualität, Spracherwerb, Zweitsprache, Fremdsprache, simultaner Spracherwerb, sukzessiver Spracherwerb, gesellschaftliche Bedingungen, Vorurteile, Mythen, kognitive Entwicklung, Sprachentwicklungsstörungen, Chancen, Hindernisse, individuelle Mehrsprachigkeit, institutionelle Mehrsprachigkeit, gesellschaftliche Mehrsprachigkeit, Code-Switching.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Mehrsprachigkeit im Kindesalter. Chance oder Hindernis?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1003784