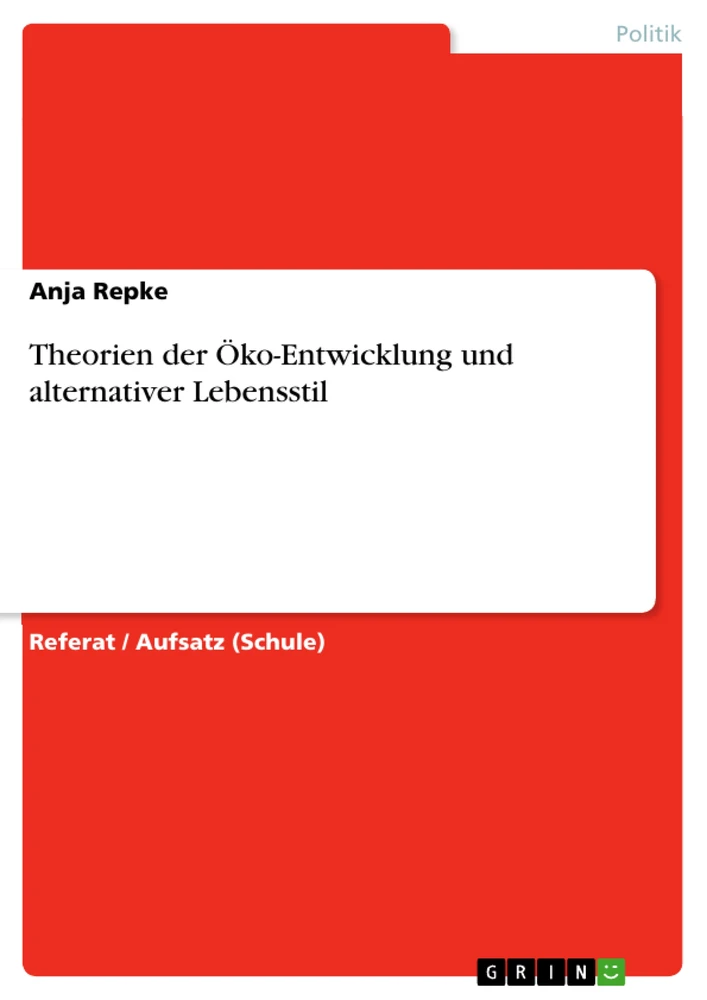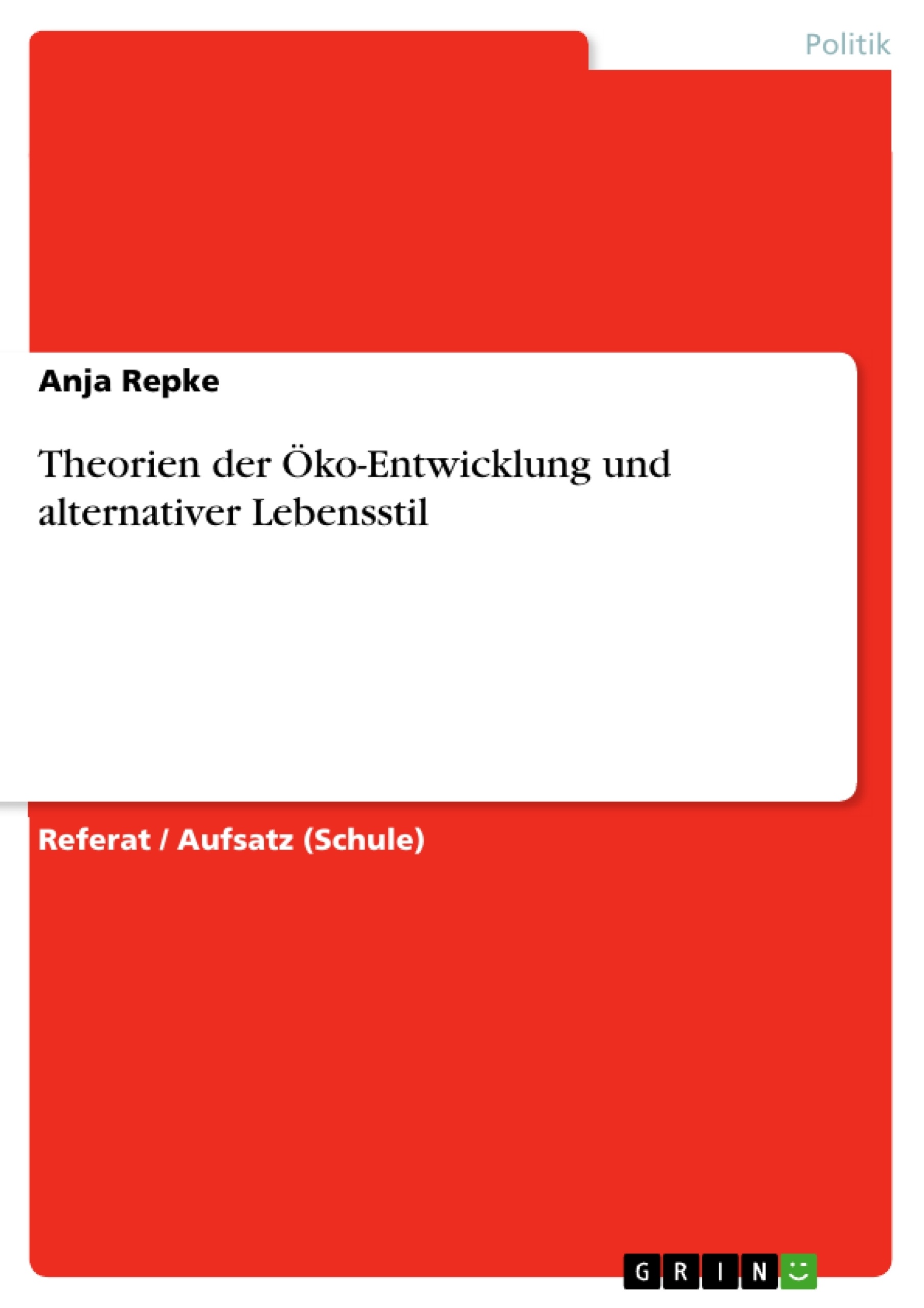Der Text beleuchtet die Komplexität und die vielschichtigen Ursachen der Unterentwicklung zu beleuchten, indem er traditionelle Ansätze hinterfragt und alternative Perspektiven, wie Öko-Entwicklung und alternative Lebensstile, in den Vordergrund stellt. Weder endogene Mängel noch externe Ausbeutung können alleinige Erklärungen bieten und daher plädiert der Text für eine differenzierte Betrachtung der Entwicklungsthematik, die ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit einschließt.
Es wird argumentiert, dass die Problematik der Unterentwicklung nicht ausschließlich durch endogene Mängel oder externe Ausbeutung erklärbar ist. Vielmehr bedarf es einer umfassenden Betrachtung, die sowohl ökologische Nachhaltigkeit als auch soziale Gerechtigkeit berücksichtigt. Der Text kritisiert den vorherrschenden Wachstumsoptimismus und die Imitationsstrategie, die Entwicklung mit quantitativem Wachstum gleichsetzen und plädiert für eine Neuorientierung hin zu einer Entwicklung, die die spezifischen Bedürfnisse und Potenziale der Dritten Welt in den Mittelpunkt stellt.
Montag, 12. Juni 2000
Theorien der Öko-Entwicklung und alternativer Lebensstil
Unterentwicklung ist nicht einfach zu definieren und vor allem zu erklären. Eine umfassende Theorie der Unterentwicklung kann sich weder mit einem endogenen1 Mangel an Modernität noch mit neokolonialistischer Ausbeutung als Erklärungsmuster begnügen.
Wer Unterentwicklung ausschließlich endogen erklären will, stößt auf die Frage, warum weite Teile der Dritten Welt sich in einer bestimmten historischen Phase nicht mehr fort- sondern zum Teil sogar rückentwickelt haben.
Wer hingegen Unterentwicklung ausschließlich auf die Ausbeutung durch imperiale Mächte zurückführt, kann sich dazu verleiten lassen, die Basis von Überwindungsstrategien nicht dort zu suchen, wo sie vermutlich primär ansetzen müssen: In der Dritten Welt selbst.
Die konventionellen Theorien ‚bürgerlicher’ und marxistischer Provenienz2 beruhen offen oder versteckt auf zwei Annahmen:
- Sie sehen dem ökonomisch-technischen Fortschritt der Dritten Welt keine prinzipiellen Grenzen gesetzt ( Wachstumsoptimismus ).
- Sie reduzieren Entwicklung auf quantitatives Wachstum und propagieren eine Nachahmung der kapitalistischen bzw. kommunistischen Wachstumsmodelle des Nordens ( Imitationsstrategie ), etwa nach dem berühmten Satz von Karl Marx, dass „das industriell entwickeltere Land... dem minder entwickelten nur das Bild der eigenen Zukunft zeigt.“
Beide Annahmen werden neuerdings von den Theorien derÖko-Entwicklung ( Eco- Development ) radikal in Frage gestellt.
Diese Theorie-Ansätze gehen von folgenden Überlegungen aus:
(1) Unendliches Wachstum – sei es im Norden oder im Süden – ist in einer Welt mitendlichen Ressourcen weder möglich noch wünschenswert.
(2) Die orthodoxe Sicht, dass unbegrenztes Wachstum eine Art ewiges Gesetz sei, muss historisch relativiert werden. Wachstum ist ein konkreter sozialer Prozess, der bestimmte geschichtliche Gründe und Voraussetzungen hat, die sich ändern oder sogar wegfallen können.
(3) Auf der anderen Seite ist eine generelle Wachstumsfeindlichkeit – um das ökologische Gleichgewicht zu bewahren – auch nicht angezeigt, da es nicht sinnvoll ist, einen Mythos durch einen anderen zu ersetzen.
(4) Folglich basiert Öko-Entwicklung auf einem Begriff des Fortschritts, der sich auf diespezifischeSituation einerRegionbezieht und in dem die Anpassung an die jeweiligen Umweltbedingungen eine besondere Rolle spielt. Auf keinen Fall kann die kritiklose Imitation der Wertmuster und Wachstumsmodelle der ‚nördlichen’ Industriegesellschaften – Säkularisierung, wissenschaftlich- technische Realität, Wirtschaftswachstum, Industrialisierung und Bürokratisierung das Ziel alternativer Entwicklung sein.
(5) ( Überlebens- ) notwendig ist die Formulierung einereigenständigenEntwicklung, die der jeweiligen Kultur, Geschichte und Ökologie einer bestimmten Entwicklungsregion bzw. eines bestimmten Entwicklungslandes angepasst sein muss. Entwicklung bedeutet dann die effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen, so dass dasökologische System( die äußere Grenze ) erhalten und dieGrundbedürfnisse der Menschen ( die innere Grenze ) befriedigt werden.
Entwicklungsstrategie:
- Die Theorie der Öko-Entwicklung beruht auf spezifischen Faktoren: Eine bestimmte Gruppe von Menschen mit besonderen kulturellen Werten lebt in einer spezifischen Region mit bestimmten wirtschaftlichen Ressourcen.
- Ziel der Öko-Entwicklung ist es, diese spezifische Situation zu verbessern, nicht hingegen abstrakte und universelle Ziffern ( BSP; Investitionsrate... ) zu steigern.
- Das Rahmenkonzept hat drei Hauptelemente: Alternative Entwicklung muß auf dieBfriedigung der Grundbedürfnisseaausgerichtet werden; sie mußebdogenundselbsständig( self – reliant ) sein, d.h. aus dem Inneren einer jeden Gesellschaft heraus erfolgen; und sie mussökologisch gesund sein.
Ein umfassendes und in sich geschlossenes Konzept Alternativer Entwicklung liegt bislang nicht vor. Für seine Verfechter handelt es sich jedoch um ein globales Konzept, dass auch in den Industriegesellschaften alternative Entwicklungsmuster und einen neuen Lebensstil für erstrebenswert hält.
Als Pioniere dieses Konzepts können u.a. gelten: Mahatma Gandie ( Lehre von der Gewaltlosigkeit ); Ivan Illich ( Technologiekritik und Forderung nach sozialer Selbstbegrenzung ) und E. F. Schumacher ( angepasste und sanfte Theorie bzw.
‚Rückkehr zum menschlichen Maß’ ).
Die Bewegung ‚Neuer Lebensstil’ wird in jeweils unterschiedlichen Ausrichtungen verfolgt, von christlich-kirchlichen Gruppen beider Konfessionen, von vielen subkulturellen Gruppen der Alternativszene und auch von Teilen der Entwicklungs- und Friedensbewegung.
Fünf Elemente kennzeichnen dabei den neuen oder auch alternativen Lebensstil:
- Einfachheit als Lebensprinzip aus internationaler und zukunftgerichteter Solidarität.
- Äußere und innere Befreiung aus den Zwängen der Konsumgesellschaft.
- Solidarische Beziehungen im zwischenmenschlichen Zusammenleben, qualitativ neue Formen mitmenschlichen Umgangs auch im weltweiten Rahmen; ein Ethos der Brüderlichkeit.
- Leben im Einklang mit der Natur, auf biologisch gesunde und umweltschonend ‚sanfte’ Weise.
- Selbstorganisation und Partizipation in dezentralisierten, teilautonomen Strukturen. Selbsthilfe, Selbstversorgung und Selbstverantwortlichkeit als Lebensprinzipien.
Kritik: Kritik an den Theorien der Öko-Entwicklung und des alternativen Lebensstils ist nicht ausgeblieben. Sie konzentriert sich:
(1) Auf die gesellschaftliche Machbarkeit dieser Ansätze in den reichen Ländern
(2) Auf die Wünschbarkeit eines alternativen Lebensstils in den armen Ländern. Angesichts der materiellen Armut in weiten Teilen der Dritten Welt sei nicht Begrenzung, sondern die Begrenzung der Produktion überlebensnotwendig.
[...]
1 inneren, in der 3. Welt selbst begründeten
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptaussagen des Textes "Theorien der Öko-Entwicklung und alternativer Lebensstil"?
Der Text untersucht Theorien zur Öko-Entwicklung und alternativen Lebensstilen und kritisiert konventionelle Entwicklungsansätze, die auf Wachstumsoptimismus und Imitationsstrategien basieren. Er argumentiert für eine Öko-Entwicklung, die auf endlichen Ressourcen basiert, die spezifische Situation einer Region berücksichtigt und eine eigenständige Entwicklung basierend auf Kultur, Geschichte und Ökologie fördert. Der Text betont die Notwendigkeit, Grundbedürfnisse zu befriedigen und das ökologische System zu erhalten.
Welche Kritik wird an konventionellen Entwicklungstheorien geübt?
Konventionelle "bürgerliche" und marxistische Entwicklungstheorien werden kritisiert, weil sie auf den Annahmen des unbegrenzten ökonomisch-technischen Fortschritts und der Nachahmung kapitalistischer oder kommunistischer Wachstumsmodelle basieren. Diese Ansätze werden als Wachstumsoptimismus und Imitationsstrategie bezeichnet und von den Theorien der Öko-Entwicklung in Frage gestellt.
Was sind die zentralen Überlegungen der Theorien der Öko-Entwicklung?
Die Theorien der Öko-Entwicklung basieren auf folgenden Überlegungen: unendliches Wachstum ist in einer Welt mit endlichen Ressourcen weder möglich noch wünschenswert; Wachstum ist ein sozialer Prozess mit geschichtlichen Gründen und Voraussetzungen, die sich ändern können; eine generelle Wachstumsfeindlichkeit ist nicht angezeigt; Öko-Entwicklung basiert auf einem Fortschrittsbegriff, der sich auf die spezifische Situation einer Region bezieht und die Anpassung an die Umweltbedingungen berücksichtigt; und notwendig ist die Formulierung einer eigenständigen Entwicklung, die an Kultur, Geschichte und Ökologie angepasst ist.
Was sind die Hauptelemente einer alternativen Entwicklungsstrategie im Sinne der Öko-Entwicklung?
Eine alternative Entwicklungsstrategie im Sinne der Öko-Entwicklung muss auf die Befriedigung der Grundbedürfnisse ausgerichtet sein, endogen und selbstständig sein, d.h. aus dem Inneren einer jeden Gesellschaft heraus erfolgen, und ökologisch gesund sein.
Wer sind einige Pioniere des Konzepts der Öko-Entwicklung und alternativen Lebensstile?
Zu den Pionieren dieses Konzepts zählen Mahatma Gandhi (Lehre von der Gewaltlosigkeit), Ivan Illich (Technologiekritik und Forderung nach sozialer Selbstbegrenzung) und E. F. Schumacher (angepasste und sanfte Technologie bzw. "Rückkehr zum menschlichen Maß").
Welche Elemente kennzeichnen einen alternativen Lebensstil?
Ein alternativer Lebensstil wird durch Einfachheit als Lebensprinzip, äußere und innere Befreiung aus den Zwängen der Konsumgesellschaft, solidarische Beziehungen, Leben im Einklang mit der Natur und Selbstorganisation und Partizipation in dezentralisierten Strukturen gekennzeichnet.
Welche Kritik wird an den Theorien der Öko-Entwicklung und des alternativen Lebensstils geübt?
Die Kritik konzentriert sich auf die gesellschaftliche Machbarkeit dieser Ansätze in den reichen Ländern und auf die Wünschbarkeit eines alternativen Lebensstils in den armen Ländern, wo angesichts der materiellen Armut nicht Begrenzung, sondern die Steigerung der Produktion überlebensnotwendig sei.
- Quote paper
- Anja Repke (Author), 2000, Theorien der Öko-Entwicklung und alternativer Lebensstil, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100366