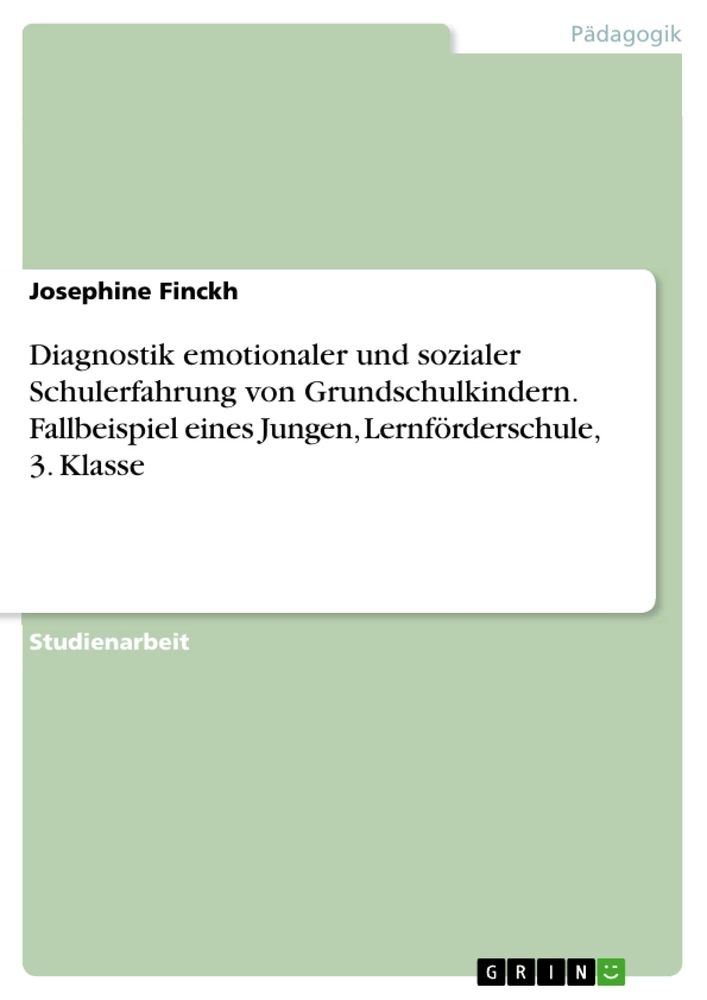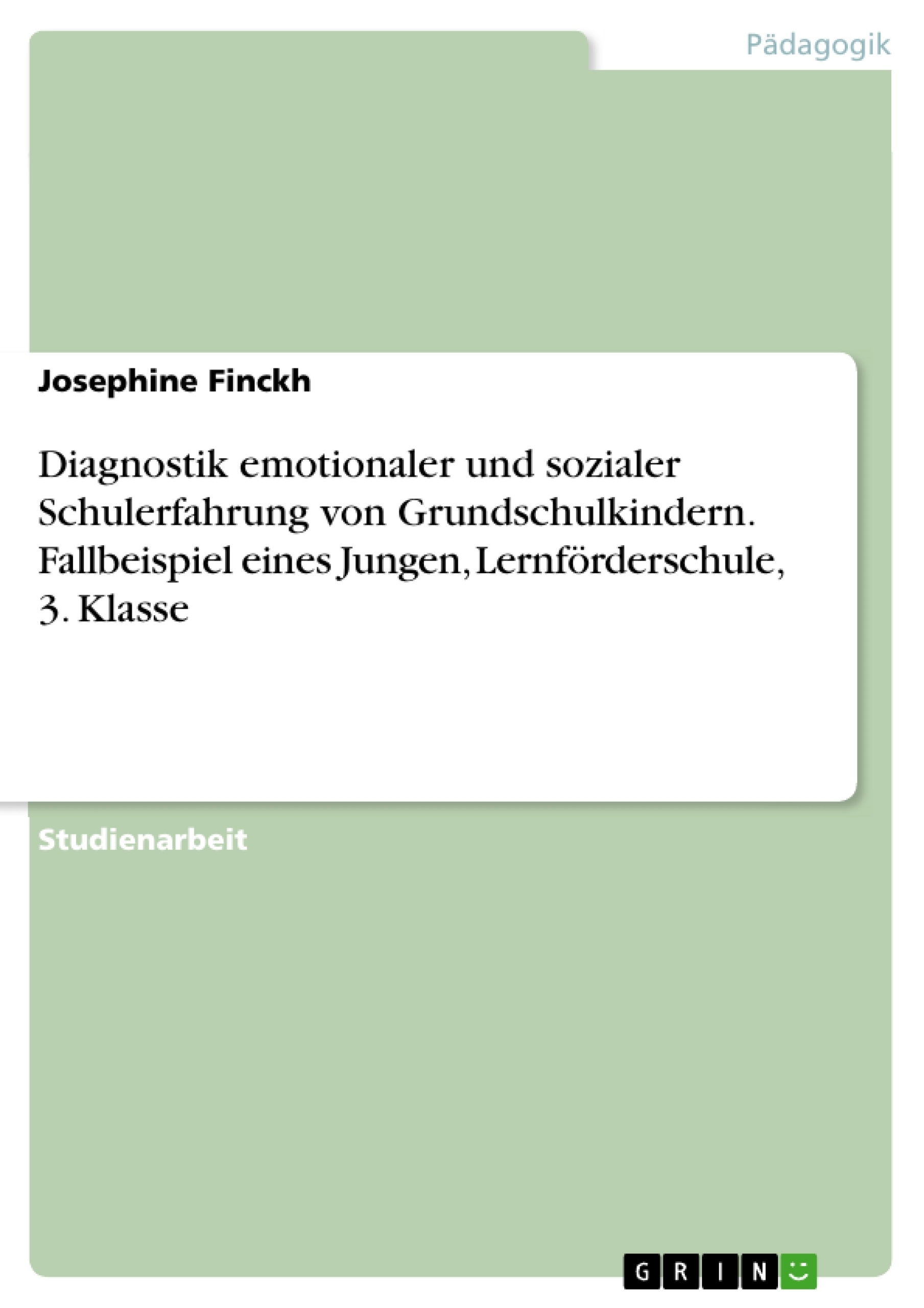Die Hausarbeit umfasst die Fallbeschreibung des zu diagnostizierenden Jungen, sowie die ausführliche Testbeschreibung des Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrung von Grundschulkindern dritter und vierter Klasse (FEESS 3+4). Gütekriterien werden für das entsprechende Vorhaben kritisch beurteilt. Abschließend steht eine ausführliche Beschreibung der Testsituation.
Das Untersuchungskind soll im Folgenden F genannt werden. Ich kenne F schon seit mehreren Monaten, denn ich gebe F Nachhilfe in den Fächern Deutsch und Mathematik. So hatte ich schon vor dem Gespräch Informationen über F, die ich in Gesprächen mit ihm selbst und seinen Eltern erhalten habe. Daher finden Basisinformationen wie Alter, Geschlecht und Familiensituation im Erstgespräch keine Beachtung. Alle Angaben diesbezüglich stammen aus Gesprächen mit F und seinen Eltern vor der Untersuchung. F ist männlich und zehn Jahre alt. Er besucht die dritte Klasse einer Lernförderschule. Er hat zwei jüngere Geschwister und lebt mit seinen Eltern in einer Wohnung. Morgens wird er von einem Fahrdienst zur Schule gebracht und nachmittags wieder abgeholt. F geht sehr gerne in die Schule und erzählt oft und gerne davon.
Inhaltsverzeichnis
- A) Anonymisierte Personenbeschreibung
- B) Ableitung einer diagnostischen Fragestellung und Untersuchungshypothesen
- C) Hypothetische Auswahl und Begründung von diagnostischen Methoden
- D) Untersuchungsbericht
- E) Fördervorschläge
- F) Kritische Reflexion aller Schritte der Fallarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die schulischen Leistungen eines zehnjährigen Schülers, F., in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ziel ist die Identifizierung von Faktoren, die seine unterdurchschnittlichen Leistungen beeinflussen. Die Arbeit basiert auf einem Fallbeispiel und beinhaltet die Ableitung einer diagnostischen Fragestellung, die Formulierung von Hypothesen und die Auswahl geeigneter diagnostischer Methoden.
- Analyse der schulischen Leistungen von F. in Deutsch und Mathematik
- Identifizierung proximaler und distaler Faktoren, die die Leistungen beeinflussen
- Bewertung des Fähigkeitsselbstkonzepts von F.
- Untersuchung der Rolle der Konzentrationsfähigkeit
- Analyse des Einflusses des häuslichen Umfelds
Zusammenfassung der Kapitel
A) Anonymisierte Personenbeschreibung: Dieses Kapitel bietet eine Einleitung zu F., einem zehnjährigen Jungen, der die dritte Klasse einer Lernförderschule besucht. Es werden allgemeine Informationen über F.s Leben und seine positive Einstellung zur Schule gegeben, basierend auf Gesprächen mit F. und seinen Eltern sowie den Erfahrungen der Autorin als Nachhilfelehrerin. F.s positive Selbstwahrnehmung in Mathematik wird hervorgehoben, im Gegensatz zu seinen tatsächlich unterdurchschnittlichen Leistungen in diesem und dem Fach Deutsch.
B) Ableitung einer diagnostischen Fragestellung und Untersuchungshypothesen: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage: Welche Faktoren beeinflussen F.s schulische Leistungen in den Hauptfächern? Es werden drei Erklärungshypothesen aufgestellt: 1) F.s Selbstkonzept ist nicht positiv ausgeprägt; 2) F.s mangelnde Konzentrationsfähigkeit behindert ihn; 3) F.s häusliches Umfeld wirkt sich negativ auf seine Leistungen aus. Diese Hypothesen basieren auf dem Schichtenmodell des Lernens und berücksichtigen proximale und distale Einflussfaktoren. Die Autorin betont, dass diese Hypothesen nicht alle relevanten Aspekte abdecken.
C) Hypothetische Auswahl und Begründung von diagnostischen Methoden: Dieses Kapitel schlägt diagnostische Methoden zur Überprüfung der in Kapitel B formulierten Hypothesen vor. Es werden standardisierte Testverfahren, wie der FEESS 3-4 (Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen) zur Erfassung des Selbstkonzepts, und der SESSKO-Test (Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzeptes) erwähnt. Die Autorin diskutiert die Eignung der Tests im Bezug auf F.s Lese-Kompetenz.
Schlüsselwörter
Diagnostik, Schulleistung, Lernförderschule, Fähigkeitsselbstkonzept, Konzentrationsfähigkeit, proximale Lernfaktoren, distale Lernfaktoren, Mathematik, Deutsch, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen zur Fallstudie: Schulische Leistungen von F.
Was ist der Gegenstand dieser Fallstudie?
Die Fallstudie untersucht die schulischen Leistungen eines zehnjährigen Schülers (F.) in den Fächern Deutsch und Mathematik. Ziel ist die Identifizierung der Faktoren, die seine unterdurchschnittlichen Leistungen beeinflussen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: A) Anonymisierte Personenbeschreibung, B) Ableitung einer diagnostischen Fragestellung und Untersuchungshypothesen, C) Hypothetische Auswahl und Begründung von diagnostischen Methoden, D) Untersuchungsbericht (nicht im Preview enthalten), E) Fördervorschläge (nicht im Preview enthalten), und F) Kritische Reflexion aller Schritte der Fallarbeit (nicht im Preview enthalten).
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, die Faktoren zu identifizieren, die F.'s Leistungen in Deutsch und Mathematik beeinflussen. Es werden proximale und distale Einflussfaktoren untersucht, darunter F.'s Fähigkeitsselbstkonzept, seine Konzentrationsfähigkeit und sein häusliches Umfeld.
Welche Hypothesen werden aufgestellt?
Die Studie formuliert drei Hypothesen: 1) F.'s Selbstkonzept ist nicht positiv ausgeprägt; 2) F.'s mangelnde Konzentrationsfähigkeit behindert ihn; 3) F.'s häusliches Umfeld wirkt sich negativ auf seine Leistungen aus. Diese basieren auf dem Schichtenmodell des Lernens.
Welche diagnostischen Methoden werden vorgeschlagen?
Zur Überprüfung der Hypothesen werden standardisierte Testverfahren vorgeschlagen, wie z.B. der FEESS 3-4 (Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen) und der SESSKO-Test (Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzeptes). Die Eignung der Tests im Bezug auf F.'s Lese-Kompetenz wird diskutiert.
Welche Informationen enthält die Personenbeschreibung?
Kapitel A bietet eine allgemeine Beschreibung von F., einem zehnjährigen Jungen in der dritten Klasse einer Lernförderschule. Es werden Informationen über sein Leben, seine positive Einstellung zur Schule und seine Selbstwahrnehmung (positiv in Mathematik, trotz unterdurchschnittlicher Leistungen) gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Diagnostik, Schulleistung, Lernförderschule, Fähigkeitsselbstkonzept, Konzentrationsfähigkeit, proximale Lernfaktoren, distale Lernfaktoren, Mathematik, Deutsch, Fallstudie.
Welche Informationen fehlen im Preview?
Der Preview enthält keine Informationen zu Kapitel D (Untersuchungsbericht), E (Fördervorschläge) und F (Kritische Reflexion).
- Quote paper
- Josephine Finckh (Author), 2017, Diagnostik emotionaler und sozialer Schulerfahrung von Grundschulkindern. Fallbeispiel eines Jungen, Lernförderschule, 3. Klasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1003660