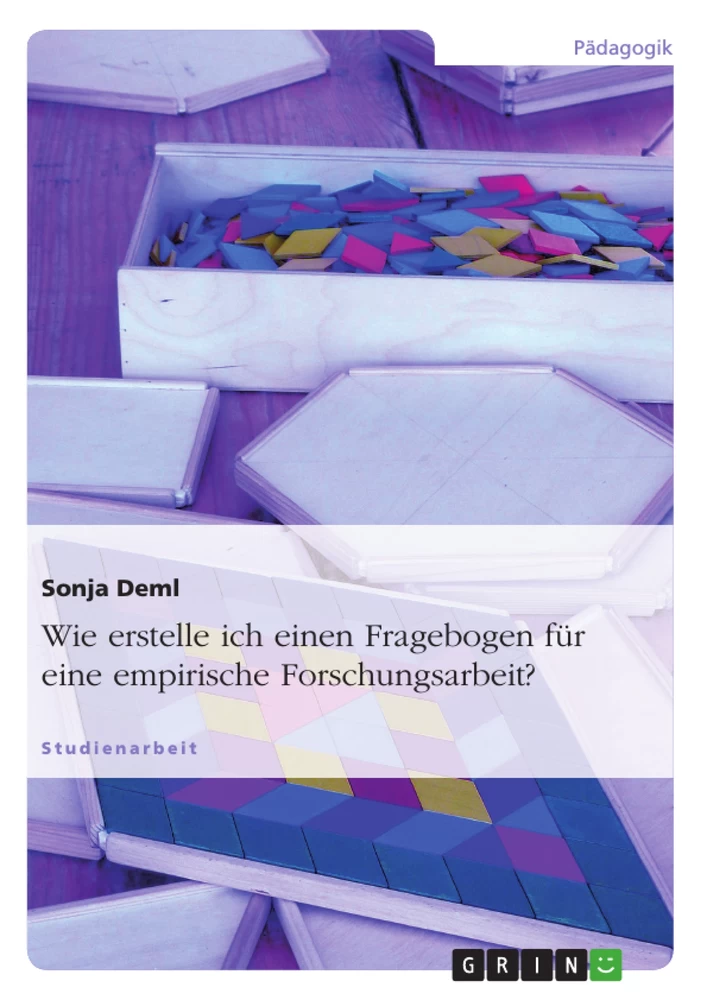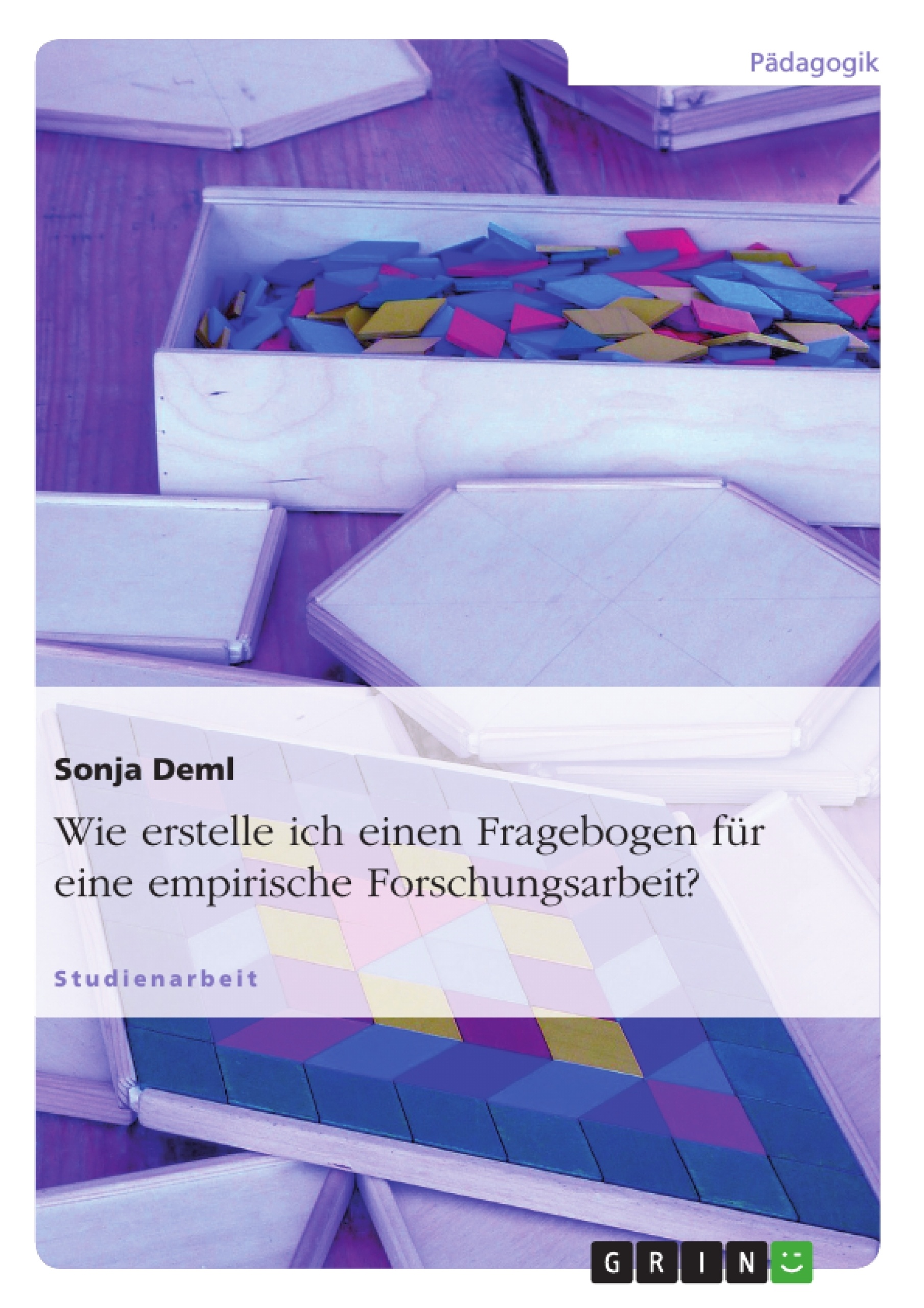Die schriftliche Befragung ist neben der mündlichen Befragung, dem Test und dem Beobachten ein wichtiges Instrument zur Erstellung einer empirischen Forschungsarbeit.
In diesem Buch steht die Konzeption eines Fragebogens im Vordergrund, wobei vor allem auf die Auswahl, die Formulierung der Fragen sowie auf den Aufbau des Fragebogens eingegangen wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Vorüberlegungen und Begriffsklärungen
- 2.1 Grundannahmen
- 2.2 Hypothesengenerierung
- 2.3 Variablen
- 2.4 Testgütekriterien
- 2.4.1 Objektivität
- 2.4.2 Reliabilität
- 2.4.3 Validität
- 3 Die schriftliche Befragung
- 3.1 Fragebogenkonstruktion
- 3.1.1 Fragearten
- 3.1.2 Formulierung der Fragen
- 3.1.3 Aufbau des Fragebogens
- 3.2 Die computervermittelte Befragung
- 3.3 Die Delphi-Methode
- 4 Die schriftliche Befragung anhand eines Beispiels
- 5 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Konstruktion und Konzeption von Fragebögen für empirische Forschungsarbeiten. Der Fokus liegt auf der Auswahl, Formulierung und dem Aufbau der Fragen. Ein konkretes Beispiel eines Fragebogens, der im Wintersemester 2000/2001 erstellt wurde, wird zur Veranschaulichung verwendet.
- Fragebogenkonstruktion für empirische Forschung
- Auswahl und Formulierung von Fragen
- Aufbau und Struktur von Fragebögen
- Hypothesengenerierung und Variablen
- Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der schriftlichen Befragung als wichtiges Instrument empirischer Forschung ein. Sie hebt die Bedeutung der Fragebogenkonstruktion hervor und kündigt den Fokus auf Fragenauswahl, -formulierung und -aufbau an. Die Arbeit nutzt ein im Wintersemester 2000/2001 entstandenes Beispiel als Veranschaulichung, welches im Kontext der empirischen Forschungsarbeit „Wissenstransfer bei Studierenden der (Sozial-)Pädagogik - Eine Untersuchung zur Wissensanwendung“ eingesetzt wurde. Die Notwendigkeit von Vorüberlegungen und Begriffsklärungen wird betont.
2 Vorüberlegungen und Begriffsklärungen: Dieses Kapitel betont die grundlegende Bedeutung von Vorüberlegungen für die erfolgreiche Konzeption eines Fragebogens. Es erläutert den Kontext des Beispiel-Fragebogens aus dem Seminar „Empirische Forschungsmethoden für Pädagoginnen und Pädagogen im Hauptstudium“. Die Kapitel behandeln die Schritte zur Hypothesengenerierung (beginnend mit einer Stoffsammlung und Literaturrecherche), die Definition von Variablen (unabhängige und abhängige Variablen) und die wichtigen Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität). Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen einseitiger und zweiseitiger Hypothesenprüfung wird ebenfalls erläutert. Das Kapitel legt die Basis für ein fundiertes Verständnis des Fragebogen-Designs.
3 Die schriftliche Befragung: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit der Konstruktion schriftlicher Befragungen. Es geht detailliert auf die verschiedenen Aspekte der Fragebogenkonstruktion ein, darunter die verschiedenen Fragearten, die korrekte Formulierung der Fragen, um Verzerrungen zu vermeiden, und den optimalen Aufbau des Fragebogens zur Maximierung der Antwortqualität. Darüber hinaus werden auch alternative Befragungsmethoden wie computervermittelte Befragungen und die Delphi-Methode kurz vorgestellt. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der theoretischen Grundlagen der vorhergehenden Kapitel.
4 Die schriftliche Befragung anhand eines Beispiels: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Beispiel für einen Fragebogen, der in einer empirischen Forschungsarbeit zum Wissenstransfer bei Studierenden der (Sozial-)Pädagogik verwendet wurde. Durch die Darstellung dieses Beispiels werden die in den vorhergehenden Kapiteln erläuterten Konzepte und Methoden praktisch veranschaulicht. Es dient als Illustration der theoretischen Ansätze und ermöglicht ein tiefergehendes Verständnis der praktischen Anwendung.
Schlüsselwörter
Fragebogenkonstruktion, Empirische Forschungsarbeit, Hypothesengenerierung, Variablen, Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität), schriftliche Befragung, Wissensanwendung, Studierende, (Sozial-)Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit "Fragebogenkonstruktion für empirische Forschungsarbeiten"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Konstruktion und Konzeption von Fragebögen für empirische Forschungsarbeiten. Der Schwerpunkt liegt auf der Auswahl, Formulierung und dem Aufbau der Fragen. Ein konkretes Beispiel eines Fragebogens aus dem Wintersemester 2000/2001 wird zur Veranschaulichung verwendet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Fragebogenkonstruktion für empirische Forschung, die Auswahl und Formulierung von Fragen, den Aufbau und die Struktur von Fragebögen, die Hypothesengenerierung und Variablen sowie die Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität). Zusätzlich werden verschiedene Befragungsmethoden, wie computervermittelte Befragungen und die Delphi-Methode, kurz vorgestellt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Vorüberlegungen und Begriffsklärungen (inkl. Grundannahmen, Hypothesengenerierung, Variablen und Testgütekriterien), Die schriftliche Befragung (inkl. Fragebogenkonstruktion, computervermittelte Befragung und Delphi-Methode), Die schriftliche Befragung anhand eines Beispiels und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel fasst seine Inhalte zusammen und verweist auf den Zusammenhang mit den anderen Kapiteln.
Welches Beispiel wird verwendet?
Die Arbeit verwendet als Beispiel einen Fragebogen, der im Wintersemester 2000/2001 im Kontext der empirischen Forschungsarbeit „Wissenstransfer bei Studierenden der (Sozial-)Pädagogik - Eine Untersuchung zur Wissensanwendung“ erstellt wurde. Dieses Beispiel veranschaulicht die theoretischen Konzepte und Methoden der Fragebogenkonstruktion.
Welche Aspekte der Fragebogenkonstruktion werden detailliert behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert verschiedene Fragearten, die korrekte Formulierung von Fragen zur Vermeidung von Verzerrungen und den optimalen Aufbau des Fragebogens zur Maximierung der Antwortqualität. Die Bedeutung der Hypothesengenerierung, der Definition von Variablen (unabhängige und abhängige Variablen) und der Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität und Validität) wird ebenfalls ausführlich erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Fragebogenkonstruktion, Empirische Forschungsarbeit, Hypothesengenerierung, Variablen, Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität), schriftliche Befragung, Wissensanwendung, Studierende, (Sozial-)Pädagogik.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende und Wissenschaftler, die sich mit empirischen Forschungsmethoden und insbesondere mit der Konstruktion von Fragebögen auseinandersetzen. Sie bietet eine umfassende Einführung in die relevanten theoretischen Konzepte und deren praktische Anwendung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die Arbeit enthält ein Literaturverzeichnis, das weitere Informationen und Quellen zu den behandelten Themen bietet.
- Quote paper
- Sonja Deml (Author), 2001, Wie erstelle ich einen Fragebogen für eine empirische Forschungsarbeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10028