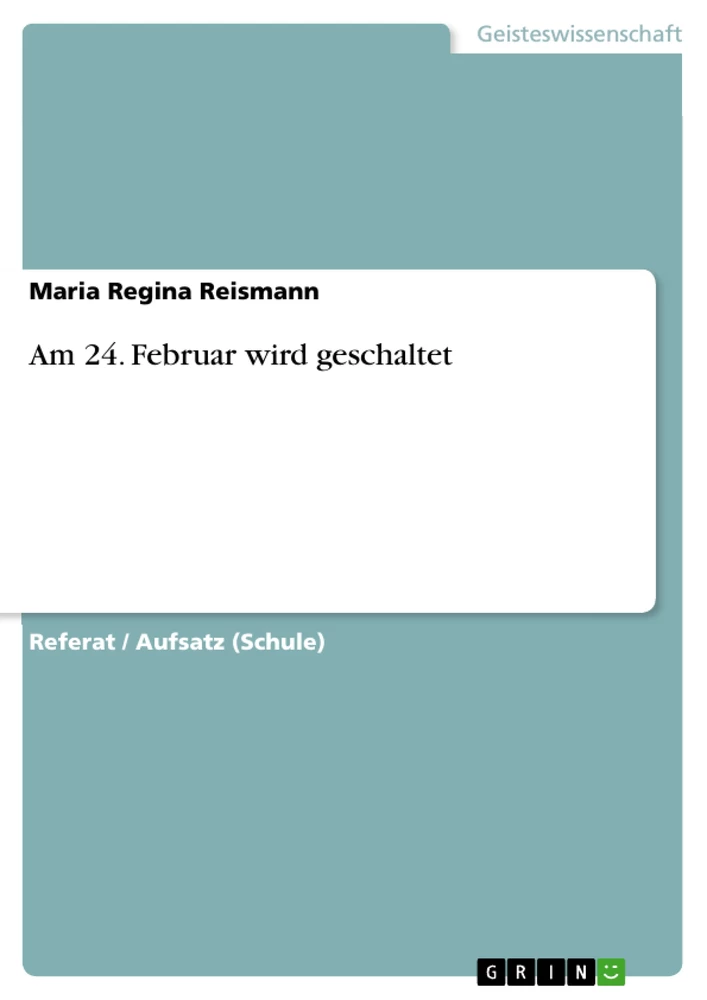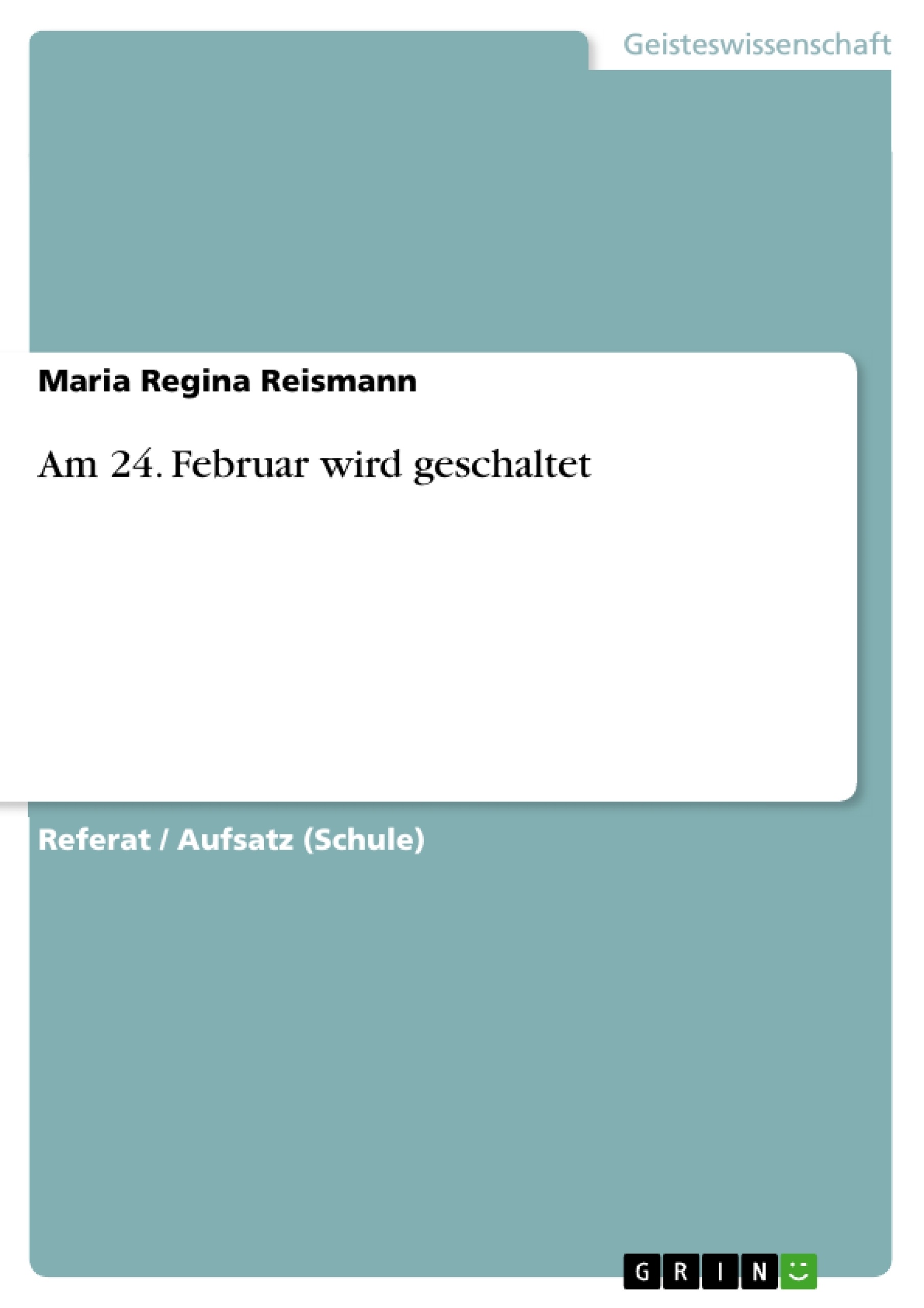AM 24. FEBRUAR WIRD GESCHALTET -
Das Schaltjahr im Römischen und im Gregorianischen Kalender
Was ein Schaltajhr ist, wissen wir natürlich alle von der Schule her. Das sind die Jahre, deren beide Endziffern durch 4 zu teilen sind, Jahre, in denen die Olympischen Spiele stattfinden. 1988 war ein Schaltjahr, dann wieder 1992, dann 1996 und so weiter... Halt! Denn gleich wird es schwierig. Ist das 20. Jahrhundert mit einem Schaltjahr begonnen worden? Nein, 1900 war kein Schaltjahr, erst 2000 war wieder ein Schaltjahr. Die Kalenderreform des Papstes, dem wir den "Gregorianischen Kalender" verdanken, ist für diese Besonderheit verantwortlich.
Schon im Spätmittelalter stellten gelehrte Männer wie Roger Bacon und Nicolaus Cusanus fest, daß der damalige Kalender nicht mehr mit den Konstellationen am Himmel übereinstimmte. Alle Versuche, den Kalender wieder richtigzustellen, scheiterten. Weil der Frühlingsanfang im 16. Jahrhundert auf den 11. März fiel, witzelte man schon, daß die Zeit käme, in der Ostern im Dezember gefeiert würde.
Endlich unternahm es Papst Gregor XIII - man schrieb das Jahr 1582 - den Kalender zu reformieren. Der Papst setzte eine Kommission ein, deren Kalenderkorrekturen er durch eine päpstliche Bulle autorisierte: zehn durch die Schaltjahre zu viel gewordene Tage mußte man ausfallen lassen. So folgte in diesem Jahr auf den 4. Oktober nicht der 5., sondern der 15. Oktober. Alle katholischen Länder folgten im Laufe der nächsten Jahre, während die protestantischen Landesfürsten erst um 1700 nachzogen.
Der Julianische Kalender, nach dem damals gerechnet wurde, nahm an, das Sonnenjahr betrage 365 Tage und 6 Stunden. So hatten es schon die alten Ägypter berechnet, und diese Einschätzung kommt auch der tatsächlichen "Revolution" der Erde um die Sonne erstaunlich nahe: diese beträgt nur 11 Minuten und 14 Sekunden weniger. Diese unscheinbare Differenz wächst allerdings in 400 Jahren auf 3 Tage an.
Gaius Julius Cäsar hat diesem Kalender seinen Namen gegeben. Er erkannte, daß der altrömische Kalender , der mondgebunden war und nur 355 Tage zählte, für ein geordnetes Staatswesen, wie es ihm vorschwebte, ungeeignet war. So beauftragte er den ägyptischen Gelehrten Sosignes mit der Umgestaltung des Kalenders. Weil das von diesem festgelegte Sonnenjahr von 365 Tagen um einen Vierteltag zu kurz war, wurde jedes vierte Jahr als Schaltjahr mit 366 Tagen begangen. Dadurch erhielt Cäsar einen Kalender, der zu Beginn unserer römisch-christlichen Zeitrechnung mit dem Kosmos übereinstimmte und erst im folgenden Jahrtausend wegen der erwähnten Minutendifferenz zu Verschiebungen führen sollte.
Der Altrömische Kalender war wie schon gesagt an die Mondumlaufbahnen gebunden. Das Jahr und die nachfolgenden Monate begannen immer mit dem Neumond. Alle zwei Jahre mußte ein eingeschobener Schaltmonat von 22 Tagen, der "mercedonius", das zu kurze Mondjahr verlängern , damit die Jahreszeiten mit dem Geschehen am Firmament in Übereinstimmung waren. Jene Schaltmonate wurden im Februar, der der letzte Monat des Jahres war, eingefügt. - und zwar nach dem 23. Februar, (ante diem VI. Kalendis Martii). Denn an den Iden des Februar (Mitte Februar) begannen die Festtage der Reinigungsriten, auch Lupercalien genannt. Die Feiern hielten etwa 8 Tage an, so daß nach deren Ende auf den 23. Februar der Schaltmonat folgen konnte.
Diese Orientierung des Kalenders am Jahresbrauchtum hat Cäsar beibehalten. Folglich erhielt auch im Julianischen Kalender, der den Januar als ersten Jahresmonat einführte und ansonsten die alte Zählung der Monate nicht veränderte, der alle vier Jahre notwendige Schalttag seinen Platz hinter dem 23. Februar, also am 24. Februar, und nicht - wie allgemein angenommen wird - am 29. Februar. Diese Tatsache war noch bis zur Neuordnung des kirchlichen Festkalenders 1969 daran erkenntlich, daß das Fest des Hl. Matthias , welches stets am 24. Februar gefeiert wurde, im Schaltjahr auf den 25. Februar verschoben wurde. Wer hätte das gedacht? Eng damit verbunden ist die Tatsache, daß das Weihnachtsfest am 25. Dezember gefeiert wird. In der römischen Kaiserzeit wurde, begünstigt durch den Verfall der altrömischen Religion, die Sonne immer mehr als Staatsgottheit kultisch verehrt. Kaiser Aurelian legte 276 n. Chr. den Tag der Wintersonnenwende, den 25. Dezember, als den Tag des unbesiegten Sonnengottes (sol invictus) fest. Bei der Einführung des Julianischen Kalenders gehörte nämlich der Winteranfang tatsächlich auf den 25. Dezember, so wie der Frühlingsbeginn auf den 24. März.
Als jedoch das Konzil von Nicäa 325 zusammentrat, um den Termin des Osterfestes festzulegen, waren seit Cäsar fast 400 Jahre vergangen. Inzwischen hatte sich der Beginn der Jahreszeiten um ganze drei Tage zurückverschoben; die Wintersonnenwende fiel auf den 22. Dezember, die Frühlingstagundnachtgleiche war auf den 21. März vorgerückt. Das Konzil kannte die Ursachen nicht und beschloß, die damaligen Aequinoctalien und Solstitien für immer im Julianischen Kalender beizubehalten. - Das Osterfest wurde auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gelegt, wo es heute noch gefeiert wird. Das Weihnachtsfest feierte die junge, gerade von der Verfolgung befreite Christenheit auf dem Festtag des "sol invictus". Christus sollte als "die aufgehende Sonne der Gerechtigkeit" gewürdigt werden.
In Schweden ist das Fest der Hl. Lucia, der Lichterkönigin, das flammende Wärme in die Winternacht bringen soll, von der Kalenderverbesserung eigenartig berührt worden. Der schwedische Kalender rechnete bis 1712 wie der Julianische Kalender. Noch 1700 hatte man ein Schaltjahr begangen, was nach dem Gregorianischen Kalender nicht der Fall sein durfte. So mußte man in einem Jahr elf Tage ausfallen lassen, und man setzte das Luciafest vom 13. Dezember mit dem 24. , dem Heiligabend, auf einen Tag. Die Kalenderreform Papst Gregors XIII wurde nach und nach anerkannt: in England um 1752, in der Sowjetunion 1918 und in der griechisch orthodoxen Kirche wie auch in der Türkei 1923. Die Ungenauigkeiten in den mathematischen Grundlagen des Julianischen Kalenders korrigiert der neue Kalender, indem er in 400 Jahren drei Schalttage ausfallen läßt - und zwar mit Beginn der durch 400 nicht teilbaren Jahrhunderte (wie 1700, 1800, 1900). Der Gleichlauf mit dem tropischen Jahr ist nun fast exakt. Erst im Jahr 4500 n. Chr. wird die Abweichung ein Tag betragen.
Der Kalender, der an altrömisches Schaltbrauchtum anknüpft, was der Hinweis auf den 24. Februar als dem vergessenen Schalttag verdeutlichen möchte, hat mit dazu beigetragen, die geschichtliche Neuzeit zu unserer modernen Zeit zu gestalten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Schaltjahr gemäß dem Römischen und Gregorianischen Kalender?
Ein Schaltjahr ist ein Jahr, das einen zusätzlichen Tag (den 29. Februar) enthält, um den Kalender mit der Erdumlaufbahn um die Sonne synchron zu halten. Im Julianischen Kalender war jedes vierte Jahr ein Schaltjahr. Der Gregorianische Kalender, den wir heute verwenden, hat komplexere Regeln: Jahre, die durch 4 teilbar sind, sind Schaltjahre, es sei denn, sie sind auch durch 100 teilbar. Jahre, die durch 400 teilbar sind, sind jedoch wieder Schaltjahre.
Warum wurde der Gregorianische Kalender eingeführt?
Der Julianische Kalender ging von einem Sonnenjahr von 365,25 Tagen aus. Die tatsächliche Dauer des Sonnenjahres ist jedoch etwas kürzer. Über Jahrhunderte hinweg führte dieser kleine Unterschied zu einer Verschiebung der Jahreszeiten im Kalender. Papst Gregor XIII. reformierte den Kalender im Jahr 1582, um diese Verschiebung zu korrigieren und den Frühlingsanfang wieder auf den 21. März zu legen, was für die Berechnung des Osterfestes wichtig war.
Was waren die wichtigsten Änderungen, die durch die Gregorianische Kalenderreform eingeführt wurden?
Die Gregorianische Reform beseitigte zehn Tage, um die angesammelte Verschiebung zu korrigieren (auf den 4. Oktober 1582 folgte der 15. Oktober 1582). Außerdem wurden die Regeln für Schaltjahre geändert, um die Genauigkeit des Kalenders zu verbessern. Nur noch durch 400 teilbare Jahrhundertjahre sind Schaltjahre.
Wer war Gaius Julius Cäsar und welche Rolle spielte er bei der Kalenderreform?
Gaius Julius Cäsar beauftragte den ägyptischen Gelehrten Sosigenes mit der Umgestaltung des altrömischen Kalenders. Cäsar führte den Julianischen Kalender ein, der ein Sonnenjahr von 365,25 Tagen vorsah und alle vier Jahre einen Schalttag hinzufügte.
Warum war der altrömische Kalender ungeeignet?
Der altrömische Kalender war an die Mondumlaufbahnen gebunden und hatte nur 355 Tage. Um mit den Jahreszeiten übereinzustimmen, musste alle zwei Jahre ein Schaltmonat (mercedonius) eingefügt werden, was zu Unregelmäßigkeiten führte.
Welche Bedeutung hat der 24. Februar im Zusammenhang mit Schaltjahren?
Im Julianischen Kalender wurde der Schalttag nicht am 29. Februar hinzugefügt, sondern hinter dem 23. Februar, also am 24. Februar. Dies war noch bis zur Neuordnung des kirchlichen Festkalenders 1969 daran zu erkennen, dass das Fest des Hl. Matthias, welches stets am 24. Februar gefeiert wurde, im Schaltjahr auf den 25. Februar verschoben wurde.
Welchen Einfluss hatte der Julianische Kalender auf die Festlegung des Weihnachtsfestes?
Die frühe Christenheit feierte das Weihnachtsfest am 25. Dezember, dem Tag des unbesiegten Sonnengottes (sol invictus), der in der römischen Kaiserzeit als Staatsgottheit verehrt wurde. Bei der Einführung des Julianischen Kalenders fiel der Winteranfang tatsächlich auf den 25. Dezember.
Wie beeinflusste die Kalenderreform das Datum des Luciafestes in Schweden?
Schweden folgte bis 1712 dem Julianischen Kalender. Als sie zum Gregorianischen Kalender wechselten, mussten sie elf Tage auslassen, was dazu führte, dass das Luciafest vom 13. Dezember mit dem 24., dem Heiligabend, auf einen Tag fiel.
Wann wurde der Gregorianische Kalender in verschiedenen Ländern eingeführt?
Die katholischen Länder folgten der Gregorianischen Reform bald nach 1582. Die protestantischen Landesfürsten zogen erst um 1700 nach. England folgte um 1752, die Sowjetunion 1918 und die griechisch-orthodoxe Kirche sowie die Türkei 1923.
Wie genau ist der Gregorianische Kalender?
Der Gregorianische Kalender ist sehr genau. Er lässt in 400 Jahren drei Schalttage ausfallen, indem er die durch 400 nicht teilbaren Jahrhundertjahre (wie 1700, 1800, 1900) nicht als Schaltjahre behandelt. Erst im Jahr 4500 n. Chr. wird die Abweichung ein Tag betragen.
- Quote paper
- Maria Regina Reismann (Author), 2001, Am 24. Februar wird geschaltet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100274