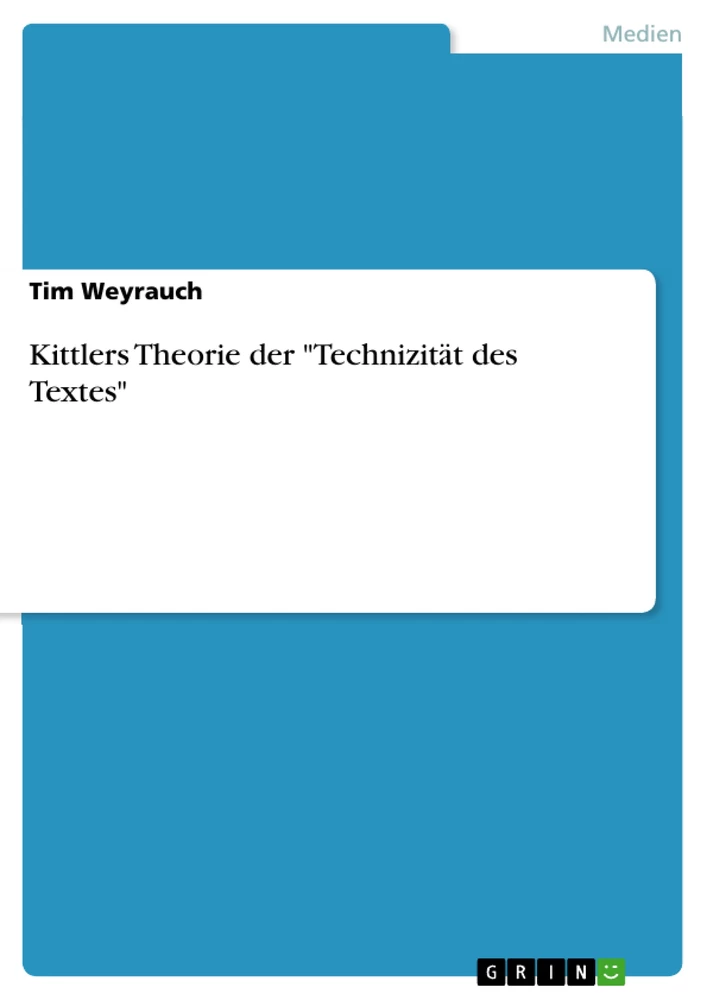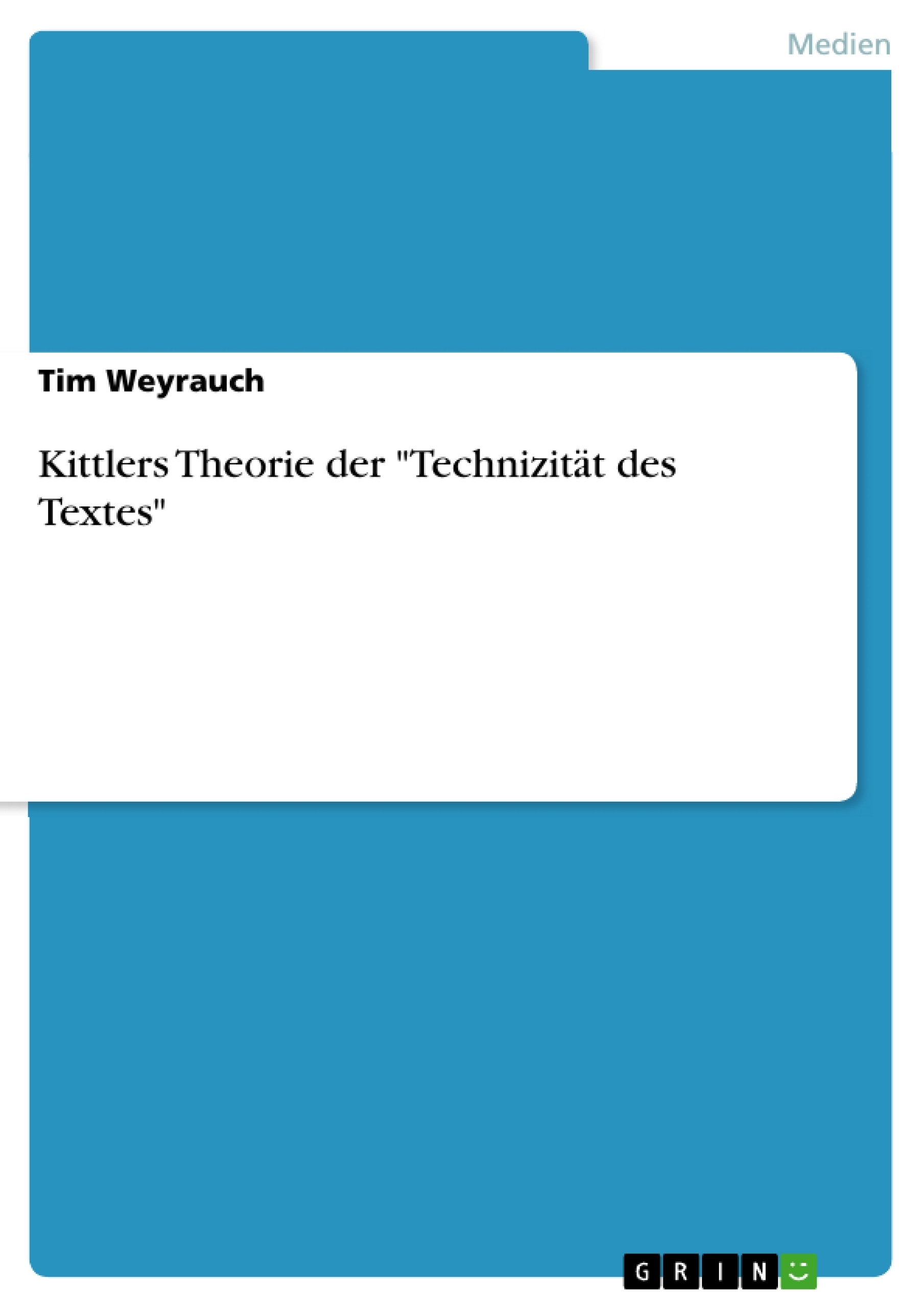Kittlers Theorie der „Technizität des Textes“
Einleitung
Kittlers Texttheorie speist sich im wesentlichen aus folgenden Quellen:
- der Freudschen Psychoanalyse, die begann die menschliche Psyche als Apparat zu betrachten
- den Seminaren von J. Lacan, der sich unter anderem damit befasste, dass Subjekt zu de-konstruieren, es zwischen Reellem und Symbol als Produkt von maschinellen Tätigkeiten und Funktionen anzusehen
- und der Entwicklung von Rechenmaschinen -theorien zwischen Alan Turing und Claude Shannon sowie Theorien diverser Mathematiker wie zum Beispiel Markow´s (Markow Kette), die aufzeigen, dass Maschinen in der Lage sind, selbst- und fremd- referentiell Strukturen zu bilden, die früher nur Menschen mögliche Texte generieren können
Daraus zieht Kittler folgende Schlüsse für seine „Literaturtheorie“ der Technizität der Texte.
Das Verhältnis Produzent - Medium - Botschaft (Text) hat sich seit dem 18. Jahrhundert völlig verändert, zum einem ist deswegen Literaturwissenschaft nicht mehr als Verstehenstheorie (Hermeneutik) oder Sozialtheorie(Literatursoziologie) möglich, andererseits hat sich die Bedeutung der drei oben genannten Elemente radikal geändert.
Weder ist der Produzent das allein sinnverbürgende Element von Texten, noch ist bloß dass Medium die Botschaft (siehe auch Marshall Mc Luhan), sondern das Medium ist Produzent und Botschaft des Textes und bestimmt so zumindest teilweise das produzierende Subjekt.1
Die historische Entwicklung nach Kittler
Die historische Entwicklung der Medien und der Gesellschaft ist in Kittler´s Buch „Aufschreibesysteme“ behandelt, einer Art theoretischem Rahmen auf das sich andere Werke von Kittler beziehen2. „Das Wort Aufschreibesystem (...) kann auch das Netzwerk von Techniken und Institutionen bezeichnen, die einer gegebenen Kultur die Adressierung, Speicherung und Verarbeitung relevanter Daten erlauben.“3 Er behandelt darin die „Theorien der Informationsnetzwerke“ der jeweiligen Epoche. Er unterteilt die untersuchten Epochen in Zeiträume die jeweils einen neuen Diskursursprung haben.
Kittler orientiert sich bei der Untersuchung der Entstehungsverhältnisse von Information an Foucault, dessen Methode der Diskursanalyse als Instrument geeignet ist um die Regeln die eine gesellschaftliche Weltanschauung konstituieren aus Texten herauszufiltern.
Diese Informationsnetzwerke formieren und regulieren Informationen; sind die Regeln der Netzwerke gefunden, sind die Bedingungen des Denkens aufgedeckt. In der Definition des Netzwerkbegriffs bezieht sich Kittler auf Claude Elwood Shannon bei dem das Netzwerk aus fünf Stationen (Quelle, Sender, Kanal, Empfänger und Senke) besteht.4 Jede Station moduliert die Information in bestimmter Weise, zusammen produzieren Sie Information (Ordnung), das geschieht zwar nicht durch die Materie selbst da Materie nur Rauschen (Chaos) ist aber die Materialität der Medien spielt eine wesentliche Rolle.5
1800
Die Materialität des Gerätes und natürlich das Verständnis desselben. Das Verständnis des Mediums Schrift hat sich um 1800 radikal gewandelt und zwar mit dem Beginn der allgemeinen Alphabetisierung. War das Lesenlernen bis dahin noch ein recht schwieriger Prozess,6 erleichterte die Lautiermethode, bei der die Mutter dem Kind vorsprach den Lernprozess und ersetzte so das Lehrmedium Buch. Damit wurden die Mütter an den Diskursursprung gesetzt da sie den Zugang zur Schrift lehrten.7 Da das Lesen jetzt eine routiniertere Tätigkeit wurde tritt der Signifikant (das Bezeichnende) hinter dem Signifikat (dem Bezeichnetem) zurück.8 Das Verstehen von Texten bezieht sich nicht mehr auf die Sprache selbst, sondern auf den hinter ihr liegenden Sinn. So wurde zum Beispiel Dichtung als frei von Materialität angenommen. Sie galt als das Mittel überhaupt um Kunst zu schaffen, zu unterhalten, und um Wissen zu vermitteln. Somit wurde Dichtung zum wichtigsten Kulturträger in Deutschland in dieser Zeit.
Dem Individuum als Quelle von Wissen kam dadurch eine neue Position zu, in der es als Schöpfer den Platz des überlieferten Wissens einnahm die dafür notwendige. „Akademische Freiheit und dichterische Freiheit (...) werden beide vom Staat garantiert.“9 Universitäten und Schulen wurden zur staatlichen Angelegenheit. Der Rechtsstaat bedurfte zur Durchsetzung seiner Prinzipien gebildeter Bürger, insofern wurden Staats- und Bildungsidee als Einheit aufgefasst, Menschsein mit Alphabetisiertsein identifiziert.10
Die wichtigsten Schaltstellen des Aufschreibesystems 1800 sind damit der Staat, Universität, Dichtung und Familie, sie produzieren jene Diskurse, welche die Epoche formieren. Auf der Sprache als immateriellem Kanal11 dieses Systems beruht der kulturelle Austausch und damit bestimmt Sprache das Gewicht der Dichtung und des Individuums als Dichter und Denker.
1900
„Kittler stellt das Aufschreibesystem, das um 1900 entsteht, als ein System des Zerfalls dar. Das Weltbild von 1800, seine Ideen zerfallen, ohne dass sich die Bruchstücke zu einer neuen Einheit zusammenfügen.“12
Als Trennungslinie zum Aufschreibesystem 1800 definiert er den Beginn der „technischen Datenspeicherung“, die Film, Phonograph und Grammophon um die Jahrhundertwende möglich machen.13 Weiteres Indiz für diese neue Epoche ist nach Kittler die Entwicklung der Psychophysik und der Psychoanalyse als neue Wissenschaften.
Die technische Datenspeicherung und die naturwissenschaftliche Herangehensweise an den Menschen erfassen den Körper und die Seele als funktionalen Apparat14, machen ihn medial erfassbar und machen ihn damit identifizierbar.15 Da Speichermedien Ordnung von Chaos nicht unterscheiden und weder die Psychophysik noch die Psychoanalyse zwischen sinnvoll und sinnlos unterscheiden stirbt das Individuum dadurch das es zur Summe test-, mess- und speicherbarer physiologischen Abläufe geworden ist.16 Damit wird der Mensch als funktionales Wesen aus seinem Individualstatus gehebelt, da alles Gesagte, Erforschte und Gemessene gespeichert wird.
„Was Mensch sein heißt, bestimmen keine Attribute, die Philosophen den Leuten zur Selbstverständigung bei- oder nahe legen, sondern technische Standards. Jede Psychologie oder Anthropologie buchstabiert vermutlich nur nach, welche Funktionen der allgemeinen Datenverarbeitung jeweils von Maschinen geschaltet, im Reellen also implementiert sind.“17 Während die Stellung der Schrift als Hauptmedium 1800 noch unangefochten war okkupieren 1900 neue Codes der Datenspeicherung das Imaginäre und das Reale, der Schrift bleibt nur das symbolische. Lacan´s Begriffstrias des Imaginären, Symbolischem und des Realen adaptiert Kittler auf eigensinnige Weise.18 Während Lacan darunter die stufenweise Entdeckung von Realität bei Kindern versteht, bezieht Kittler diese Kategorien, in seinem Buch „Grammophon Film Typewriter“ direkt auf die im Titel behandelten Medien.
- Das Imaginäre entsteht nach Lacan im „Spiegelstadium“, wenn sich das Kind im Spiegel erblickt und sein imaginäres Spiegelbild als imaginäres Selbst in sein Selbstbewusstsein adaptiert. Bei Kittler ist das imaginäre Medium der Film, in dem er eine Parallele zum Spiegelstadium sieht.
- Die Ebene des Symbolischen eröffnet sich nach Lacan mit dem Spracherwerb. Der Zugang zur Wirklichkeit wird bestimmt durch die systemimmanente Logik der Sprache die ein geschlossenes System bildet. Bei Kittler entsteht das symbolische als eigener Bereich indem sich die Schreibmaschine zwischen Schrift und Autor stellt. Schrift ist nicht mehr nur der Kanal, die Maschine tilgt individuelle Handschrift und den persönlichen Ausdruck.
-Die Ebene des Realen bleibt bei Lacan undeutlich, das Reale ist negativ dadurch zu definieren das aus den Ordnungen des Imaginären und Symbolischen herausfällt. Es ist nicht greif- oder fassbar und lediglich an seinen Wirkungen zu erkennen.
Kittler bezeichnet das Reale mit dem Grammophon, ohne Filter der Bedeutsamkeit zeichnet dieses Medium Sinn und Unsinn gleichermaßen auf und gibt damit die Realität wieder.
Den Computer beschreibt Kittler als Universalmedium in dem diese drei Ebenen multimedial aufgehen. Wie die Schrift wird er ein Medienmonopol haben indem er alle Ebenen belegt. Mit der Tilgung aller anderen Medien wird auch der Begriff „Medium“ selbst getilgt, der nach Kittler überhaupt erst durch die Entstehung anderer Medien neben der Schrift entstanden ist.19 Da Kittler Medien sowieso als anthropologische Aprioris auffasst ist diese Tatsache für ihn nicht weiter bedenklich, weil sich mit dem Computer nur eine technische Entwicklung vollzieht nicht jedoch eine kulturelle. Da es das autonom schöpfende Subjekt nach Kittler sowieso nie gegeben hat ist die einzige Neuerung dass der Computer ein Maschinensubjekt ist, der Information nicht wie alle bisherigen (Analog-) Medien nur speichert und überträgt sondern als Neuerung auch noch verarbeitet. Für Kittler ist also die Verselbstständigung der Maschinen gegenüber dem Menschen nicht das Problem, er meint man solle eher die Machtfrage stellen, da durch die Benutzung oder Nichtbenutzung der Maschinen gesellschaftliche Machtverhältnisse eingepflanzt werden.
Verwunderlich ist, dass Kittler den Zerfall des Subjekts als natürlichen Prozess ansieht, den er in keine Weise bewertet da das Subjekt für lange Zeit (etwa seit der Renaissance) die Sinnproduktion verbürgte.20 Im Gegensatz dazu steht Kittlers übertriebene und oft wiederholte Warnung, das die menschliche Gesellschaft durch Maschinen (z.B. Computer) zum Produkt militärischen Denkens werde und so das zivile Leben insgesamt von militärischen Produkten beeinflusst sei. Aber auch eine Maschine unterwirft sich der Funktion, die ihr gegeben wird so das militärisch Maschinen in zivilen Funktionen nicht mehr die selben bleiben.21
Auf der einen Seite verlangt er angesichts der Computerentwicklung die den Menschen unterwirft seinen Lesern „ein wenig wissenschaftlichen Humor ab“22, auf der anderen Seite beschreibt er eine natürliche technische Entwicklung als Unternehmen, die den Anwender dumm und abhängig macht.23
Fazit.
Bei der Lektüre von Texten und der Arbeit in und mit Medien muss der technische Aspekt, die „Technizität des Textes“ beachtet werden, da sonst, so Kittler Texte nicht mehr angemessen beurteilt und verstanden werden können Dies leuchtet ein und wird von Kittler ausführlich begründet.
Literaturverzeichnis
Kittler, A. Friederich (1986): Grammophon Film Typewriter, Berlin
Kittler, A. Friederich (1993): Draculas Vermächnis. Technische Schriften, Leipzig
Kittler, A. Friederich (1995): Aufschreibesysteme 1800 1900 (3. überarbeitete Auflage), München
Kloock Daniela / Angela Spahr (2000): Medientheorien: eine Einführung (2. überarbeitete Auflage), München
[...]
1 Kittler, 1986, S. 5, 6, 145
2 Kloock/ Spahr 2000, S. 187
3 Kittler 1995, S. 519
4 Kittler 1995, S. 520
5 Kittler 1993, S. 161
6 Kittler 1995, S. 45
7 Kittler 1995, S. 38
8 Kittler 1995, S. 89
9 Kittler 1995, S. 27
10 Kittler 1995, S. 77
11 Kittler 1995, S. 93, 145
12 Kloock/ Spahr 2000, S. 179
13 Kittler 1995, S. 520
14 Kittler 1995, S. 269
15 Kloock/ Spahr 2000, S. 181
16 Kloock/ Spahr 2000, S. 180
17 Kittler 1993, S. 61
18 Kloock/ Spahr 2000, S. 189-191
19 Kittler 1986, S. 8
20 Kloock/ Spahr 2000, S. 200
21 Kloock/ Spahr 2000, S. 195
22 Kloock/ Spahr 2000, S. 200 / 1993, S. 181
Häufig gestellte Fragen
Was ist Kittlers Theorie der „Technizität des Textes“?
Kittlers Theorie untersucht, wie sich die Rolle von Produzent, Medium und Botschaft (Text) seit dem 18. Jahrhundert verändert hat. Er argumentiert, dass die Literaturwissenschaft nicht mehr nur als Verstehenstheorie (Hermeneutik) oder Sozialtheorie (Literatursoziologie) möglich ist, da sich die Bedeutung dieser drei Elemente radikal geändert hat. Das Medium ist Produzent und Botschaft des Textes und bestimmt so zumindest teilweise das produzierende Subjekt.
Welche Quellen speisen Kittlers Texttheorie?
Kittlers Texttheorie basiert auf der Freudschen Psychoanalyse, den Seminaren von Jacques Lacan und der Entwicklung von Rechenmaschinen-Theorien (Alan Turing, Claude Shannon, Markow-Kette). Diese Quellen zeigen, dass Maschinen in der Lage sind, selbst- und fremd-referentielle Strukturen zu bilden und Texte zu generieren, was früher nur Menschen möglich war.
Wie beschreibt Kittler die historische Entwicklung der Medien und der Gesellschaft?
In seinem Buch „Aufschreibesysteme“ behandelt Kittler die historische Entwicklung der Medien und der Gesellschaft. Er unterteilt die Epochen in Zeiträume mit jeweils neuen Diskursursprüngen und orientiert sich bei der Untersuchung der Entstehungsverhältnisse von Information an Michel Foucaults Diskursanalyse. Er definiert „Aufschreibesysteme“ als das Netzwerk von Techniken und Institutionen, die einer gegebenen Kultur die Adressierung, Speicherung und Verarbeitung relevanter Daten erlauben. Dabei bezieht sich Kittler auf Claude Elwood Shannons Netzwerkmodell mit den Stationen Quelle, Sender, Kanal, Empfänger und Senke.
Was sind die wichtigsten Schaltstellen des Aufschreibesystems um 1800 nach Kittler?
Die wichtigsten Schaltstellen um 1800 sind der Staat, die Universität, die Dichtung und die Familie. Sie produzieren die Diskurse, die diese Epoche formieren. Die Sprache als immaterieller Kanal dieses Systems ist die Grundlage des kulturellen Austauschs und bestimmt somit das Gewicht der Dichtung und des Individuums als Dichter und Denker.
Wie beschreibt Kittler das Aufschreibesystem um 1900?
Kittler stellt das Aufschreibesystem um 1900 als ein System des Zerfalls dar. Das Weltbild von 1800 zerfällt, ohne dass sich die Bruchstücke zu einer neuen Einheit zusammenfügen. Die Trennungslinie ist der Beginn der „technischen Datenspeicherung“ durch Film, Phonograph und Grammophon sowie die Entwicklung der Psychophysik und Psychoanalyse.
Welche Rolle spielen Film, Grammophon und Typewriter (Schreibmaschine) in Kittlers Theorie?
Kittler verwendet Lacans Trias des Imaginären, Symbolischen und Realen, um die Medien Film, Schreibmaschine und Grammophon zu beschreiben. Der Film repräsentiert das Imaginäre, die Schreibmaschine das Symbolische und das Grammophon das Reale. Der Computer vereint diese drei Ebenen multimedial.
Wie bewertet Kittler die Rolle des Computers?
Kittler sieht den Computer als Universalmedium, das alle Ebenen (Imaginäres, Symbolisches, Reales) belegt. Er prognostiziert, dass der Computer ein Medienmonopol haben wird und den Begriff "Medium" selbst tilgen wird. Er betont die Verselbstständigung der Maschinen gegenüber dem Menschen und fordert, die Machtfrage zu stellen, da durch die Benutzung oder Nichtbenutzung der Maschinen gesellschaftliche Machtverhältnisse entstehen.
Was kritisiert Kittler im Zusammenhang mit der Computerentwicklung?
Kittler kritisiert, dass die Computerentwicklung den Menschen unterwirft und dass die menschliche Gesellschaft durch Maschinen zum Produkt militärischen Denkens wird. Er sieht eine Gefahr darin, dass das zivile Leben insgesamt von militärischen Produkten beeinflusst wird.
Was ist die Kernaussage von Kittlers Theorie der Technizität des Textes?
Bei der Lektüre von Texten und der Arbeit mit Medien muss der technische Aspekt, die „Technizität des Textes“ beachtet werden, da sonst Texte nicht mehr angemessen beurteilt und verstanden werden können.
- Arbeit zitieren
- Tim Weyrauch (Autor:in), 2000, Kittlers Theorie der "Technizität des Textes", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100261