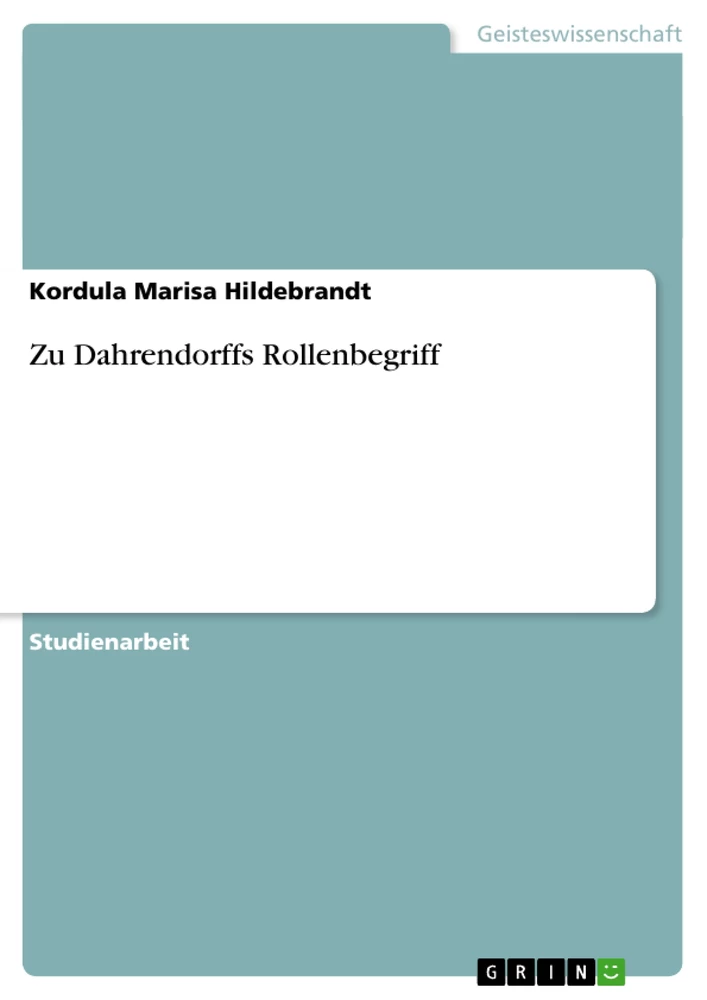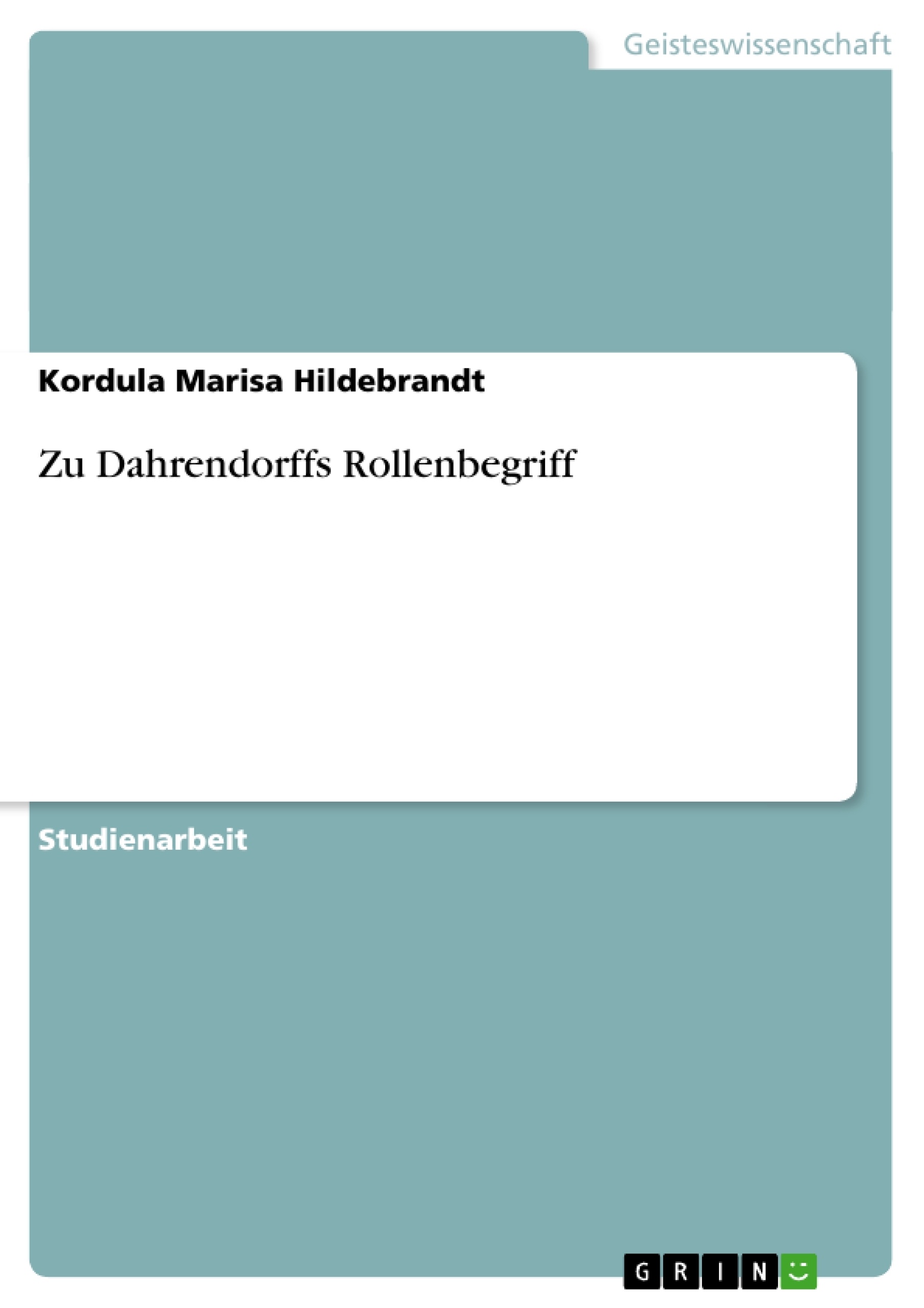Erst Lord Ralf Dahrendorff hat 1958 die Diskussion über den Rollenbegriff mit seinem Essay <homo sociologicus> in Deutschland ins Rollen gebracht. Die Begleitthemen wie Identifikation mit den eigenen Rollen, die Sozialisation und die Frage nach dem Individuellen überhaupt beschäftigen uns heute genauso wie damals; vor allem in den Disziplinen Soziologie, Psychologie, Philosophie, Anthropologie, Theologie, Pädagogik, Literaturwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Rechtswissenschaft. Der Rollenbegriff wird meist eindimensional gebraucht, aber er hat Allgemeingültigkeit, damit er so komplizierte Formen und Prozesse wie soziales Handeln, Konflikte und Interaktionen erfassen und erklären kann. 1
1 Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Dahrendorfs Rollenbegriff
Die Rollen und das Selbst
„Expertenmeinungen“
Geschichtliche Entwicklung des Rollenbegriffs
Schlussbemerkungen
Literaturverzeichnis
Einleitung
Erst Lord Ralf Dahrendorf hat 1958 die Diskussion über den Rollenbegriff mit seinem Essay <homo sociologicus> in Deutschland ins rollen gebracht.
Die Begleitthemen wie Identifikation mit den eigenen Rollen, die Sozialisation und die Frage nach dem Individuellen überhaupt beschäftigen uns heute genauso wie damals; vor allem in den Disziplinen Soziologie, Psychologie, Philosophie, Anthropologie, Theologie, Pädagogik, Literaturwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Rechtswissenschaft.
Der Rollenbegriff wird meist eindimensional gebraucht, aber er hat Allgemeingültigkeit, damit er so komplizierte Formen und Prozesse wie soziales Handeln, Konflikte und Interaktionen erfassen und erklären kann.[1]
Dahrendorfs Rollenbegriff
Ralf Dahrendorf definiert die soziale Rolle als Bündel von Erwartungen, die sich in einer gegebenen Gesellschaft an das Verhalten der Träger von Positionen knüpfen. Wie die Positionen, sind die Sozialen Rollen vom Einzelnen unabhängig und wie ihr Inhalt zu füllen ist wird durch die Gesellschaft festgelegt. Diese Rollenerwartungen, z.B. Ansprüche an das Aussehen und den `Charakter´(= Rollenattribute), werden durch eine Bezugsgruppe mit Sanktionen kontrolliert, die nicht statisch, sondern kulturellen Entwicklungen der Gesellschaft unterworfen sind, „soziale Rollen sind ein Zwang“ (S.36).
Durch Positionen erwirbt eine Person „verschiedene Stellungen“ (S.30) und einen „sozialen Status“ (S.68). Die Bezugsgruppe stellt an den Besitzer multipler Positionen „Kann-, Soll- und Muss-Erwartungen“ (S.36) - folglich sind auch Sanktionen unterschiedlich gewichtig. Dahrendorf unterscheidet zwischen „zugeschriebenen und erworbenen Positionen“ (S.54f): Geschlechts-, Alters-, Familien-, National- und Berufspositionen sind zugeschriebene Positionen und z.B. Autofahrer, Hotelbesitzer und Vereinsvorsitzender sind erworbene Positionen. Allerdings können Positionen von zugeschriebenen zu erworbenen werden und umgekehrt.
Der Mensch wird zum <homo sociologicus>, wenn er diese sozial vorgeformten Rollen und Positionen annimmt.
Durch die Sozialisation lernt der Rollenspieler seine Rollen kennen und verinnerlicht die entsprechenden Verhaltensmuster und wird dann ein Mitglied der Gesellschaft. Das Rollenbewusstsein bildet sich erst durch die Distanz von einer Rolle und deren Reflexion, wenn eine Störung erfahren wird.[2] Da eben jeder Mensch mehrere Rollen und Positionen hat, also einen ganzen Rollensatz, kann es natürlich auch mal zu Problemen zwischen den einzelnen Rollen kommen (= inter-role-conflict), so dass z.B. jemand als Elter seinem Kind keine schlechte Schulnote geben möchte aber als dessen Lehrer dies seine Pflicht ist, denn dies wäre auch gerecht gegenüber den Mitschülern. Wenn dieser Lehrer nun jeglicher Kritik gerecht werden möchte, also den Vorstellungen der Schulordnung und den Wünschen seiner Schüler nachzukommen, muss er dieses Problem innerhalb seiner Rolle (= intra-role-conflict) versuchen zu lösen, wenn diese heterogen sind.
Die Sozialisation ist ein Prozess gegenseitiger Beeinflussung zwischen einer Person und ihren Mitmenschen, sie ist von Annahme und Anpassung begleitet. Die gesamte Gesellschaft ist Träger der Sozialisation, jeder Mensch ist, indem er zu Gruppen gehört, beteiligt.[3]
Die soziale Rolle liegt im Schnittpunkt zwischen Individuum und Gesellschaft (S.57).
Die Soziologie sieht die Sozialisierung als Entpersönlichungsprozess, in dem die absolute Individualität und Freiheit des Einzelnen zugunsten der sanktionierbaren und an Erwartungen gebundenen sozialen Rolle aufgegeben werden.
Dass sich eine Person stets rollengemäß verhalten würde ist jedoch eine empirisch falsche Aussage (S.102).
Der Mensch wird zum Individuum, wenn er das Gelernte von seinem persönlichen Standpunkt aus interpretiert.[4]
D.h. wie der Mensch seine Rollen gestaltet ist frei und darf individuell sein, so lange er nicht sanktioniert werden muss. Individualisierung heißt aber auch, dass kein Paar und keine Gruppe von Individuen jemals völlige Identität zueinander erreichen kann, nicht einmal Zwillinge, und bei keinem Individuum ist das soziale Verhalten absolut voraussagbar. Dr. Herlinde Maindok[5] sieht in der Vermittlung oder der Balance, die zwischen dem Eigenen und dem Fremden und zwischen dem Innern und dem Äußeren hergestellt wird, die eigentliche Leistung der Identität. Individualität besagt, dass jeder Mensch eine einzigartige Persönlichkeit hat und andere soziale Erfahrungen als seine Mitmenschen.[6]
Weder in der Psychologie noch in der Soziologie geht man davon aus, dass der rollenlose Mensch existiert. Er hätte zu viel Freiheit und kann Befriedigung nur aus seinen Rollen, die er nicht erschaffen hat, ziehen. Allerdings beschäftigt sich die Sozialpsychologie mit dem anderen Verständnis des Rollenbegriffs, dem tatsächlichen Verhalten des Individuums gegenüber den Erwartungen.
Dahrendorfs <homo sociologicus> ist ein Konstrukt – „(er) kann weder lieben noch hassen weder lachen noch weinen (...) er bleibt ein künstlicher Mensch“ (S.82) – Wodurch sich menschliches soziales Verhalten berechnen lässt.
Die Soziologen betrachten den Menschen durch seine Rollen und nicht als Individuum und freien Menschen. Er ist ersetzbar, da seine Positionen und sozialen Rollen von ihm unabhängig sind.
Doch Dahrendorf sieht den Menschen nicht nur als Summe seiner Charaktere, sondern glaubt, dass er zusätzlich einen inneren Kern, bzw. „zehnten Charakter“ (S.81) hat, der von allen Bindungen an die Gesellschaft befreit ist. Der zehnte Charakter stirbt mit dem Individuum und gehört nur ihm allein; er kann aber nicht abgesondert von seinen Rollen existieren.
Die Rollen und das Selbst
Kann das Selbst losgelöst von seinen Rollen stehen ?
Ist die soziale Rolle das tatsächliche Verhalten des Rollenträgers oder nur die Verhaltenserwartungen der Gesellschaft ?
Existiert der rollenlose Mensch überhaupt (vgl. S.57f) ?
Wenn sich jemand bewusst gegen seine, durch das Umfeld vorgegebenen Rollen entscheidet, übernimmt er dann nicht „nur“ die Rolle des Revolutionär, des „Neinsagers“ ?
Will ich nicht durch meine Wahl der Rollenkombination Individualität darstellen, indem ich z.B. Künstler werde, oder indem ich betone was ich nicht bin, z.B. kein „Mitläufer – Typ“ ?
Sind nicht die Gedanken das Selbst ?
oder ist nicht der Wille frei ?
Wer bin ich?
Was will ich?
Sind das Fragen, die an die eigene Wahl von Rollen gestellt werden, in Hinblick darauf, ob ich die an sie gerichteten Positionen ändern soll ?
Dahrendorf erhält auf solche Fragen von der Soziologie und der philosophischen Kritik keine Antworten (vgl. S.79; S.80),
beziehungsweise erklärt, dass sie „uns an die Grenzen der Soziologie und der philosophischen Kritik (führen).“ (S.80)
< Auch Hermann Hesse weist 1927 auf die Ungenauigkeit des mit Schauer bewunderten Faustischen Spruchs: << Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust! >> und beschreibt, dass „der Mensch eine aus hundert Schalen bestehende Zwiebel, ein aus vielen Fäden bestehendes Gewebe (ist)“ und „als Körper jeder Mensch eins (ist), als Seele nie.“). Man müsste nur „den Wahn der Persönlichkeitseinheit durchbrechen und sich als mehrteilig, als ein Bündel aus vielen Ichs empfinden.“ >[7]
„Expertenmeinungen“
Der Lyriker Durs Grünbein und der Neurowissenschaftler Ernst Pöppel unterhalten sich in einem Gespräch der Zeitschrift „Der Spiegel“ über die Frage wie neue Gedanken (und Kreativität) entstehen.
Durs Grünbein würde ja statt Kommunikation lieber Hirnvergleich sagen, da „das Hirn jedes Menschen seine eigene Welt repräsentiert. Wir haben jetzt etwa sechs Milliarden Welten. Jeder von diesen sechs Milliarden pflegt seine Allmachtphantasien .“[8]
„Die Grundstruktur, nach der wir funktionieren, beruht auf Sinnesinformationen().
Wenn wir ganz andere neuronale Adaptionsprozesse durchlaufen hätten – wie etwa der Oktopus – hätten wir auch ein anderes Weltbild, sagt der Neurowissenschaftler Ernst Pöppel.“[9]
Der Hirnforscher Professor Wolf Singer, Max-Planck-Institut für Hirnforschung „(hält) die Idee des freien Willens für ein kulturelles Konstrukt.“[10]
Er erklärt, dass „Erfahrungen der Individualität und Freiheit also erst entstanden sein (können), als Dialoge zwischen Gehirnen möglich wurden wie „Ich weiß, dass du weißt, was ich weiß“, und als sich diese entwickelten, schlug die biologische Evolution in die kulturelle um.[11]
Geschichtliche Entwicklung des Rollenbegriffs
Seit Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigen sich Philosophen, als auch Psychologen, Anthropologen und Soziologen mit dem Begriff der Rolle. Sie verwarfen die konträre Meinung, dass sich Person und Gesellschaft als zwei Alternativen gegenüberstehen und gelangen zu der Erkenntnis, dass beide, Individuum und Gesellschaft, zueinander komplementär sind. Ebenso wenig wie Gesellschaft ohne Individuen, die sie bilden, zu existieren vermag, kann auch das konkrete menschliche Individuum sich nicht ohne gesellschaftlichen Wechselbezug zu seiner Persönlichkeit entfalten, bedachten William James und James Mark Baldwin. Der moderne Soziologe definiert die Gesellschaft als eine organisierte Gesamtheit von Menschen, die in einem gemeinsamen Gebiet zusammenleben, zur Befriedigung ihrer sozialen Grundbedürfnisse in Gruppen zusammen arbeiten, sich zu einer gemeinsamen Kultur bekennen und als eigenständige soziale Einheit funktionieren.
John Dewey sieht die soziale Person als Summe aus Individualität und Erfahrung, die biologische Einheit Mensch bildet sich zunächst als Sozialwesen und danach die Individualität.[12]
„Mein Selbstbewusstsein ist die Reflexion der Vorstellungen, die der andere von mir hat“[13] bemerkt daraufhin H. Cooley mit seinem „looking glass self“, was bedeutet, dass die andere Person zu der man spricht für einen selber wie ein Spiegel fungiert. Um wieder ein Beispiel aus der Literatur zu nennen, würde hier Max Frisch mit <Andorra> gut passen, in dem der „Nicht – Jude“ Andri durch sein Umfeld zum Juden gemacht wurde.
In Deutschland taucht der Rollenbegriff bei Georg Simmel als erstes auf. Er hält die Rolle als die besondere Form des „Vergesellschaftet-Seins“ des einzelnen neben seinem individuellen <Für – sich – seins>; (individuelles Verhalten wird in eine vorgeformte Form integriert).[14] Dies würde heißen, dass eine Rolle nicht weiter viel mit der Person zu tun hat und folglich wie eine Maske nach Belieben auf- und wieder abgesetzt werden könnte. Emile Durkheim prägt den Begriff „conscience collective“ (= Kollektivbewusstsein), das den Menschen als ein Bündel unregulierter Triebe, durch sozialen Zwang = „contrainte social“ gesellschaftsfähig macht.
Erst durch die Arbeiten von Georg Herbert Mead, Jacob L. Moreno und Ralph Linton ist der Rollenbegriff in der amerikanischen Soziologie geläufig geworden.
Für Mead bezieht sich die Rolle mehr auf das Verhalten als auf eine Position, so dass man eine Rolle darstellen, sie aber nicht besetzen kann.[15] Mit seinem <role – taking> bezeichnet er den Prozess der Rollenübernahme, mit seinem Begriff <role – playing> versteht er das Spielen der Rolle und sein <playing – at a role> beschreibt das Verhalten des Einzelnen -in seiner Rolle- mit Bezug auf seine Mitmenschen. Das <generalized other> entspräche Durkheims “conscience collective”.
Moreno (1934) kategorisiert zwischen drei Rollentypen:
(1) psychosomatischen Rollen
(2) psychodramatische Rollen
(3) soziale Rollen
(1) bedeutet, dass die psychosomatische Störung von der Person als ein Teil von ihr übernommen wird, sie muss aber keinen sozialen Rollencharakter haben
(2) Z.B. Autoritätspersonen, Erzieher oder Personen aus dem öffentlichen Leben sind Rollen, die eine psychodramatische Bedeutung haben und so geführt werden
(3) Ist die Vorstellung von der Rolle und wie sie ´gespielt` wird.
Linton (1936) unterscheidet zwischen Status und Rolle:
Der Status ist ein Bündel von Rechten und Pflichten und eine Rolle repräsentiert dagegen den dynamischen Aspekt eines Status. Rolle und Status sind völlig untrennbar voneinander und bedingen sich gegenseitig.[16] Richtiger Wäre es wohl, so meint Dahrendorf die Rolle als den Inhalt der leeren Form (sozialer Positionen zu beschreiben (S.99). Der Terminus „Status“ wurde in der folgenden Literatur durch Theodore M. Newcombs Begriff „Position“ abgelöst,[17] da er nach neuerem Verständnis den Rang einer Person beschreibt.
Es beschäftigten sich später noch Robert Merton, Talcott Parsons, Ervin Goffman und S.F. Nadel mit dem Rollenbegriff.
Merton ergänzt Lintons Rollenvorstellung mit seinem Begriff <role-set>, der erläutern soll, dass zu jeder Position eine Reihe von Rollen gehört und bringt den Terminus <multiple roles> ein.[18] Talcott Parsons sieht durch die Rolle verschiedene Pflichten auf den Rollenträger zukommen; diesen Gedanken hat Dahrendorf später übernommen (siehe Dahrendorfs Rollenbegriff). Mit den Einteilungen <orientation-role> und <object-role> erklärt Parsons, „dass in einer Interaktionssituation jeder Handelnde eine Orientierung zum anderen hat und selber ein Objekt dieser Orientierung ist; beides sind Teile seiner Rolle“.[19] 1949 haben C.E. Shannon und W. Weaver ein Basismodell der sprachlichen Kommunikation entworfen und durch den Gedanken der Rückkopplung und Reversibilität beschreiben sie das gleiche wie Parson, bezogen auf die deskriptive Sprachwissenschaft .[20] Goffman erkennt in der sozialen Rolle nicht nur Pflichten, wie Parsons, sondern auch Rechte. Er bezieht den Begriff der Rolle analog zum Schauspieler. Doch Dahrendorf erwähnt mit Vorsicht, dass der Rollenbegriff aus der Theatersprache entstammt, weil man den Rollenträger nicht als „rollen - spielenden (Maskenträger)“ (S.28) verstehen darf der gleich einem Schauspieler seine „eigentliche (Identität)“ (S.28) hinter der Maske trägt. Goffman geht davon aus, dass der Rollenträger von dem Individuum scharf abgetrennt ist und nennt es „Rollendistanz“; ähnlich Georg Simmels Annahme.
S.F. Nadel bezieht sich auf das Rollenverhalten in Bezug zu anderen „sozialen Phänomenen“[21], vergleichbar mit Georg Herbert Meads Ansicht.
Die Diskussion über den Rollenbegriff begann in Deutschland erst 1958 mit Ralf Dahrendorfs Abhandlung <homo sociologicus>.
Hauptsächlich wurde er in drei Behauptungen kritisiert:
(1) die soziale Rolle ist ein Elementarbegriff für die Analyse sozialen Handelns; sie ist menschliches Verhalten =
(2) der Mensch verhält sich rollenkonform - aber natürlich nicht stets rollengemäß, wie Dahrendorf sagt(vgl.S.102)
(3) der Prozess der Sozialisierung ist stets ein Prozess der Entpersönlichung (vgl.S.58)
Rollendefinitionen und Rollenkonzepte wurden natürlich abgesehen von den hier genannten Soziologen weiter entwickelt.
Schlussbemerkungen
Der umstrittene Essay „homo sociologicus“ von Ralf Dahrendorf beinhaltet dennoch wichtige Aspekte bezüglich des Rollenbegriffs, wie z.B. den Intra- und Interrollenkonflikt. Dahrendorf versucht den Begriff der Soziologie neu zu definieren, er möchte die Soziologie von der philosophischen Anthropologie trennen (vgl. S.105ff) und kritisiert in seinem Anhang die Vorstellungen anderer bezüglich der Soziologie, denn er findet, dass der Soziologiebegriff wie ihn die Soziologen nennen, ein bunter Strauß von sehr unterschiedlichen Problemen, Aussageweisen und Erkenntnisansprüchen ist- ganz zu schweigen von dem, was unter Nichtsoziologen als Soziologie gilt (vgl. S.98).
Allerdings haben sich einige Standpunkte innerhalb seines Textes wiederholt, z.B. die Definition des <homo sociologicus>: Seite 20, 32, 71 und 80, der Begriff von den Positionen: Seite 54ff, 29ff, 74 und im Anhang, die Definition der sozialen Rolle: Seite 33, 35 und im Anhang, und die Bezeichnungen des „sämtlichen Rollen entkleideten Menschen ...“ Seite 42 und dem „rollenlosen Menschen ...“ Seite 57, die das gleiche besagen.
Dahrendorf hätte seinen Essay auf seine Kernaussagen kürzen können, er zitiert z.B. auf Seite 24 ein Shakespeare Gedicht und spricht auch von Cicero, was für seinen Essay jedoch nicht so relevant ist.
Sehr anschaulich erläutert Dahrendorf seine Vorstellungen durch seinen konstruierten Herrn Prof. Hans Schmidt.
Literaturverzeichnis
Bodzenta, Erich (Hg.). Grundbegriffe Der Soziologie von Fichter, H.Joseph (1970). 3.Aufl. Wien/New York: Springer- Verlag
Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
Dahrendorf, Ralf (1977) Homo Sociologius: Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. 15.Aufl. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH
Grolle, Johann/Traufetter, Gerald (2001) Spiegel-Gespräch Das Falsche Rot der Rose. In: Der Spiegel 1/2001
Herrlitz, Wolfgang (1973) Aufbau eines Modells der sprachlichen Kommunikation. In: Funk-Kolleg, Bd.1, 38-45
Hesse, Hermann (1974) Der Steppenwolf. Franfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag
Mohr, Arno (Hg.). Lehr- und Handbücher der Soziologie. Einführung in die Soziologie: Leitthemen, Theorien, Grundbegriffe von Maindok, Herlinde (1998). München/Wien: R. Oldenburg Verlag
Thimm, Katja/Traufetter, Gerald (2000) Die Welt im 21.Jahrhundert Schauder des Schaffens. In: Der Spiegel 51/2000
[...]
[1] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[2] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[3] Bodzenta, Erich (Hg.). Grundbegriffe Der Soziologie von Fichter, H.Joseph (1970). 3.Aufl. Wien/New York: Springer- Verlag
[4] Bodzenta, Erich (Hg.). Grundbegriffe Der Soziologie von Fichter, H.Joseph (1970). 3.Aufl. Wien/New York: Springer- Verlag
[5] Mohr, Arno (Hg.). Lehr- und Handbücher der Soziologie. Einführung in die Soziologie: Leitthemen, Theorien, Grundbegriffe von Maindok, Herlinde (1998). München/Wien: R. Oldenburg Verlag
[6] Bodzenta, Erich (Hg.). Grundbegriffe Der Soziologie von Fichter, H.Joseph (1970). 3.Aufl. Wien/New York: Springer- Verlag
[7] Hesse, Hermann (1974) Der Steppenwolf. Franfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag
[8] Thimm, Katja/Traufetter, Gerald (2000) Die Welt im 21.Jahrhundert Schauder des Schaffens. In: Der Spiegel 51/2000
[9] Thimm, Katja/Traufetter, Gerald (2000) Die Welt im 21.Jahrhundert Schauder des Schaffens. In: Der Spiegel 51/2000
[10] Grolle, Johann/Traufetter, Gerald (2001) Spiegel-Gespräch Das Falsche Rot der Rose. In: Der Spiegel 1/2001
[11] Grolle, Johann/Traufetter, Gerald (2001) Spiegel-Gespräch Das Falsche Rot der Rose. In: Der Spiegel 1/2001
[12] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[13] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[14] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[15] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[16] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[17] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[18] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[19] Coburn-Staege, Ursula (1973) Der Rollenbegriff Ein Versuch der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum. Heidelberg: Quelle & Meyer
[20] Herrlitz, Wolfgang (1973) Aufbau eines Modells der sprachlichen Kommunikation. In: Funk-Kolleg, Bd.1, 38-45
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Rollenbegriff nach Ralf Dahrendorf?
Ralf Dahrendorf definiert die soziale Rolle als ein Bündel von Erwartungen, die in einer Gesellschaft an das Verhalten von Trägern bestimmter Positionen geknüpft sind. Diese Rollen sind unabhängig vom Einzelnen und werden von der Gesellschaft festgelegt.
Was sind die Kann-, Soll- und Muss-Erwartungen im Kontext von Dahrendorfs Rollenbegriff?
Die Bezugsgruppe stellt an den Inhaber multipler Positionen "Kann-, Soll- und Muss-Erwartungen". Diese Erwartungen sind unterschiedlich gewichtig, und die entsprechenden Sanktionen variieren dementsprechend.
Was unterscheidet zugeschriebene und erworbene Positionen?
Zugaschriebene Positionen sind beispielsweise Geschlecht, Alter, Familie und Nationalität. Erworbene Positionen können Autofahrer, Hotelbesitzer oder Vereinsvorsitzende sein. Positionen können sich von zugeschrieben zu erworben und umgekehrt entwickeln.
Was ist der <homo sociologicus> nach Dahrendorf?
Der Mensch wird zum <homo sociologicus>, wenn er die sozial vorgeformten Rollen und Positionen annimmt. Dies geschieht durch Sozialisation, in der er die Verhaltensmuster verinnerlicht.
Was sind Intra- und Inter-Rollenkonflikte?
Ein Inter-Rollenkonflikt entsteht, wenn verschiedene Rollen einer Person in Konflikt geraten. Ein Intra-Rollenkonflikt entsteht innerhalb einer einzelnen Rolle, wenn heterogene Erwartungen erfüllt werden müssen.
Wie unterscheidet sich Dahrendorfs Sichtweise von der des "freien Menschen"?
Dahrendorf glaubt, dass der Mensch neben seinen Rollen auch einen inneren Kern, den "zehnten Charakter", besitzt, der frei von gesellschaftlichen Bindungen ist. Dieser Kern ist jedoch nicht isoliert von den Rollen existent.
Welche Fragen bleiben unbeantwortet, wenn man versucht, Rollen zu interpretieren?
Fragen, die an die eigene Wahl von Rollen gestellt werden, in Hinblick darauf, ob ich die an sie gerichteten Positionen ändern soll, bleiben unbeantwortet oder führen "uns an die Grenzen der Soziologie und der philosophischen Kritik."
Wie entstand die Idee des freien Willens nach Wolf Singer?
Laut Hirnforscher Wolf Singer ist "die Idee des freien Willens für ein kulturelles Konstrukt".
Wie hat sich der Rollenbegriff historisch entwickelt?
Seit Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigten sich Philosophen, Psychologen, Anthropologen und Soziologen mit dem Begriff der Rolle und die Erkenntnis, dass beide, Individuum und Gesellschaft, zueinander komplementär sind.
Was besagt Cooleys "looking glass self"?
Cooleys "looking glass self" besagt, dass die andere Person, zu der man spricht, für einen selbst wie ein Spiegel fungiert. Das Selbstbewusstsein ist eine Reflexion der Vorstellungen, die andere von einem haben.
Was ist der Unterschied zwischen Status und Rolle nach Linton?
Der Status ist ein Bündel von Rechten und Pflichten, während die Rolle den dynamischen Aspekt eines Status repräsentiert. Rolle und Status sind untrennbar miteinander verbunden.
Welche Kritik gab es an Dahrendorfs "homo sociologicus"?
Die Kritik umfasste die Annahme, dass die soziale Rolle ein Elementarbegriff für die Analyse sozialen Handelns sei, dass sich der Mensch rollenkonform verhält (aber nicht immer), und dass Sozialisierung ein Prozess der Entpersönlichung ist.
Welche wichtigen Aspekte beinhaltet Dahrendorfs Essay "homo sociologicus"?
Wichtige Aspekte sind der Intra- und Interrollenkonflikt, der Versuch einer Neudefinition der Soziologie und die Abgrenzung zur philosophischen Anthropologie.
- Quote paper
- Kordula Marisa Hildebrandt (Author), 2000, Zu Dahrendorffs Rollenbegriff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100241