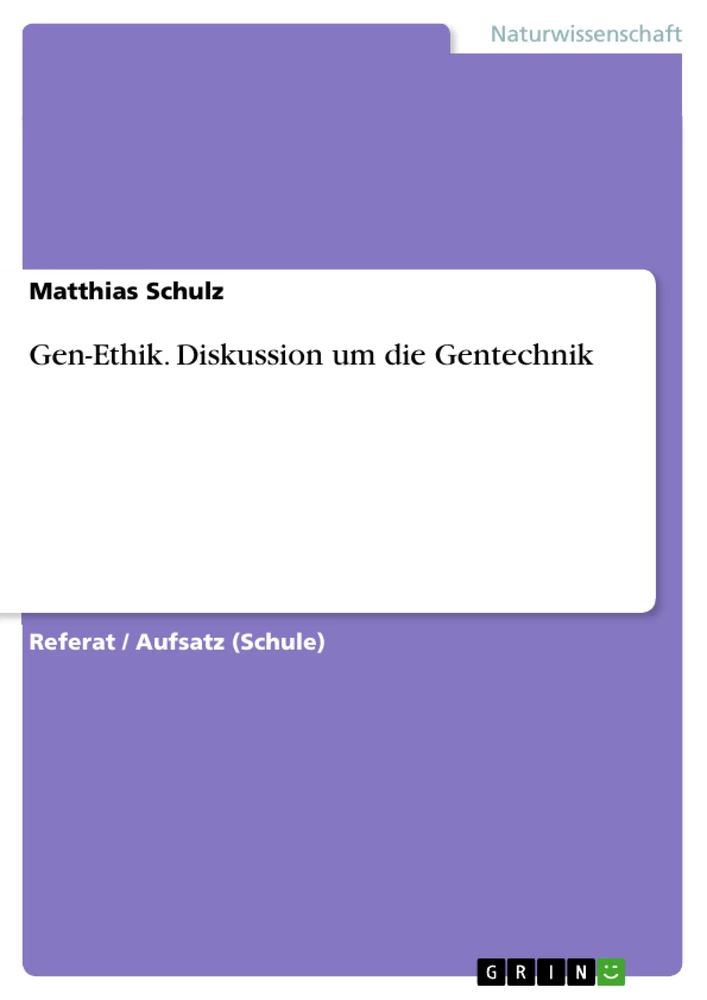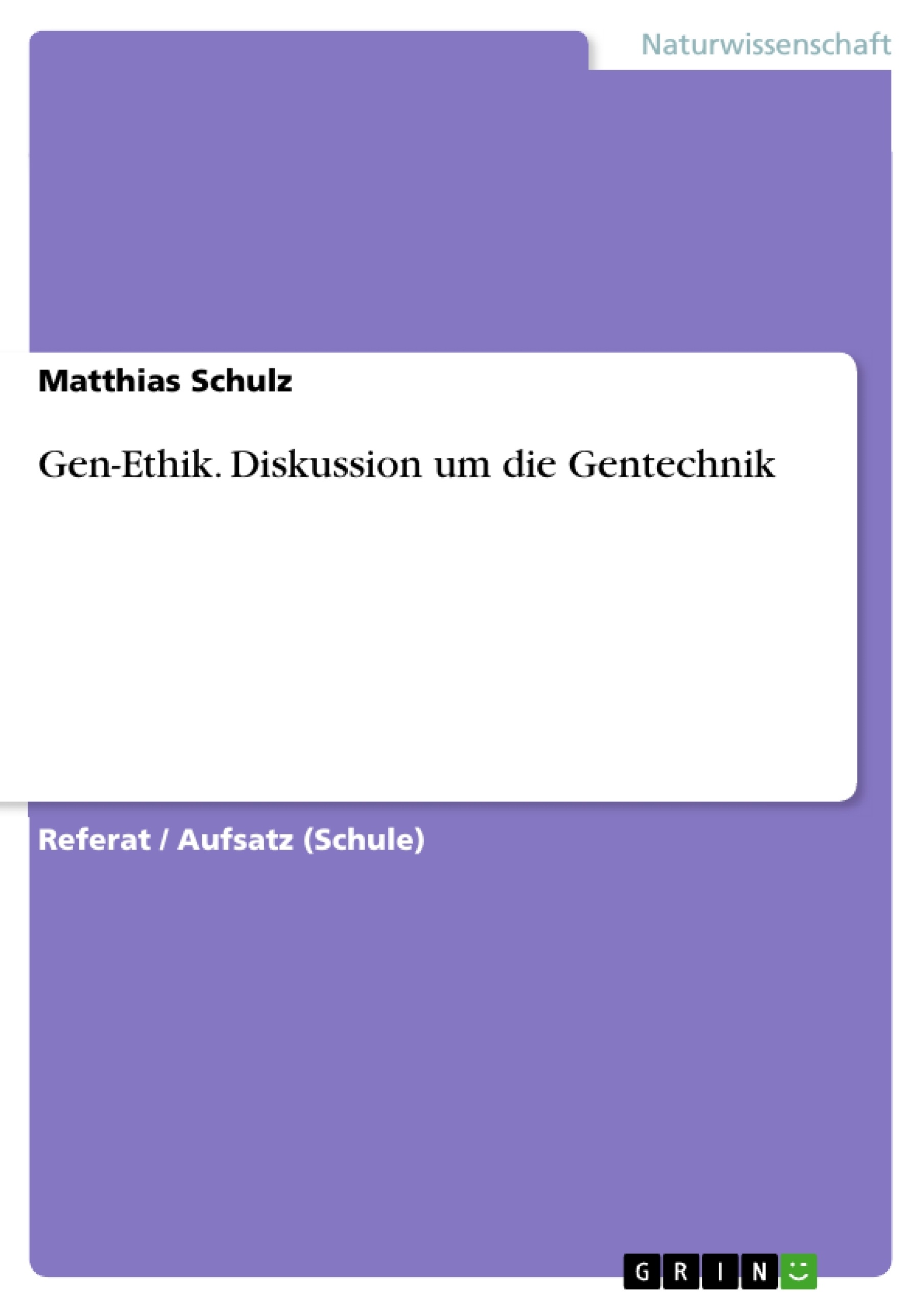Gen Ethik
Gentechnologie ermöglicht die gezielte Veränderung des Erbgutes von Organismen durch die Addition bzw. Subtraktion synthetischer oder artfremder Gene. Man erhofft sich davon eine Lösung zahlreicher Probleme im Bereich der Medizin, der Landwirtschaft, der Umwelttechnik und der Ernährung.
Diskussion um die Gentechnik
Wie jede neue Technik eröffnet Gentechnologie dem Menschen neue Verhaltensoptionen. In der Vergangenheit haben technologische Durchbrüche nicht nur positive Ergebnisse gezeigt. Technologie wurde und wird nicht nur zum Nutzen, sondern auch zum Schaden von Menschen eingesetzt. Besonders zwiespältig wurde in jüngerer Zeit die Entwicklung der Atomtechnik erlebt. Nicht zu reden von der Bombe, auch die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie wird heute von vielen mit gewichtigen Argumenten abgelehnt. Verwundern kann es deshalb nicht, dass der Gentechnik viel Skepsis (gesundes Misstrauen) entgegengebracht wird.
Bei der Frage nach der Verantwortbarkeit der Gentechnologie dürfen die Chancen und Risiken ihrer Anwendungen nicht pauschal (ideologisch), sondern nur einzeln und projektgebunden abgewogen werden.
Deshalb müssen die Wissenschaftler, vor allem aber die anwendende Industrie ihre Karten offen auf den Tisch legen, um den Ängsten mit Aufklärung und Information zu begegnen. Sie müssen erklären, welche Ziele sie verfolgen und warum Gentechnik hierfür besser als andere Alternativen geeignet ist. Trotz aller Hoffnungen, kann die Gentechnik jedoch allein - ohne zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung des ökologischen Gleichgewichts auf dieser Erde - die Zukunft des Menschen nicht sichern.
Prinz Charles, der britische Thronfolger plädiert für klare Auszeichnungspflicht: Jeder sei aufgerufen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Deshalb sei eine klare Kennzeichnungspflicht gentechnisch veränderter Produkte nötig, damit sich die Verbraucher bewusst entscheiden könnten.
Abgesehen davon müsse man aber die Frage stellen, ,,ob wir das Recht haben, mit den Bausteinen des Lebens zu experimentieren und daraus wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen". Als eine Warnung Gentechnologie nicht bloß als ein weiteres Mittel zu sehen, mit dem man billig Nahrungsmittel produzieren könne, wies Charles auf die Folgen des Skandals um den sogenannten Rinderwahnsinn (BSE) hin, der zum Exportverbot für britisches Rindfleisch in der EU führte. ,,Die Lektion von BSE und anderen vom Menschen gemachten Katastrophen auf der Suche nach 'billigen Lebensmitteln' ist sicherlich, dass die nicht vorhergesehenen Folgen den größten Anlass zur Sorge geben", schrieb Charles.
Die Nordelbische Kirche sagt zum Beispiel: ,,Der Mensch ist Teil der Schöpfung, nicht ihr Beherrscher. [...] Zum christlichen Glauben gehört Ehrfurcht und Respekt vor der guten Schöpfung Gottes. Wo aber das Geschöpf die Rolle des Schöpfers einzunehmen versucht, findet eine Grenzüberschreitung statt".
Darin werden Eingriffe an menschliche Embryonen, um unerwünschte Erbanlagen auszuschalten, strikt abgelehnt. Die Kirche sieht darin eine Missachtung des einmaligen, unverwechselbaren Lebens.
Jedoch befindet die Nordelbische Kirche die Heilung bestimmter Krankheiten mit Hilfe der Gentechnik (Produktion von Medikamenten und Impfstoffen, Gentherapie) als verantwortbar.
Die Meinungen bezüglich der Gentherapie (die aktive Veränderung von Erbsubstanz) gehen auch bei den Wissenschaftlern weit aus einander.
Der Experte Albert Teich aus Washington: ,,In kürze werden wir menschliche Keimzellen manipulieren können. [...] Wir werden Körpergröße und sogar die Intelligenz der Menschen erhöhen."
Der Britische Gentechnologe Brenner sagt beim Expertentreffen in Washington: ,,Ihr kommt mir vor wie Raketeningenieure, die den interstellaren Reiseverkehr planen. [...]Die Aufgabe ist unglaublich komplex", warnt Brenner, ,,und wenn wir gesunde Menschen verbessern wollen, sollten wir absolut sicher sein, dass wir sie nicht schlechter machen." Dazu sollte man sich vielleicht an Dürrenmatts Komödie ,,Die Physiker" erinnern. Es ist vielleicht manchmal besser bestimmte ,,Errungenschaften" nicht preiszugeben, weil sie für die Menschheit mehr zum Nachteil als zum Vorteil würden.
Daher müssen die Methoden, die sich auf die Therapie von Körperzellen beziehen, ganz scharf von denjenigen unterschieden werden, welche die Keimbahnzellen des Menschen angreifen. Bei der Therapie von Körperzellen geht es um die Heilung eines Individuums, bei Eingriffen in die Keimbahn sind zukünftige Generationen betroffen. Die Nobelpreisträgerin Christine Nüsslein-Volhard vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen nennt die Eingriffe in die Keimbahn ,,Unfug" und ,,Größenwahn".
Es gibt bereits einen Konsens, gentechnologische Manipulation an der menschlichen Keimbahn auf dem Stand des heutigen Wissens zu tabuisieren. Die Enquete-Kommission des 10. Deutschen Bundestages zu den "Chancen und Risiken der Gentechnologie" empfahl dem Deutschen Bundestag "gentechnische Eingriffe in menschliche Keimbahnzellen strafrechtlich zu verbieten". Dies ist geschehen.
Gentechnologische Eingriffe in Körperzellen zum Zwecke der individuellen Therapie sind jedoch grundsätzlich anders zu bewerten. Wenn gentechnische Methoden zur Therapie von Körperzellen existieren, ist die Unterlassung der möglichen Heilung einer Krankheit am betroffenen Individuum nicht zu rechtfertigen. In den USA wird die Gentherapie bereits erfolgreich angewendet, in Deutschland sind erste Versuche gestartet worden.
Definition Gentechnologie
Gentechnologie beschreibt die Summe aller Methoden, die sich mit der Isolierung, Charakterisierung, Vermehrung und Neukombination von Genen auch über Artgrenzen hinweg beschäftigen. Ihre wichtigste Grundlage ist die Universalität des genetischen Codes, d.h. alle Organismen verwenden die gleiche genetische Sprache. Entgegen der landläufigen Ansicht wird auch in der Natur genetische Information zwischen verschiedenen Arten ausgetauscht. Die Gentechnologen benutzen diese Möglichkeit der Natur bei ihrer Arbeit.
Tierzucht
Dennoch wird Gentechnologen von Kritikern vorgeworfen, hierdurch in unerlaubter Weise in die Natur einzugreifen.
Der Mensch hat jedoch seit Urzeiten in Form der Tier- und Pflanzenzüchtung (zunächst unbewusst, später gezielt) angewandte Genetik betrieben, d.h. in das Erbgut von Nutzorganismen eingegriffen. Der züchtende Mensch ist bemüht, die seiner Meinung nach günstigsten Erbanlagen verschiedener Rassen oder Arten in seinen Nutztieren oder Nutzpflanzen zu vereinigen. Bei jeder herkömmlichen Kreuzung werden schlagartig Tausende von Genen hin und her geschoben - das gesamte Erbgut wird neu zusammengestellt. Dabei werden verschiedene Gensequenzen ein- oder ausgeschaltet, vorher intakte Stoffwechselwege enden plötzlich im nichts, neue biochemische Reaktionsketten entstehen.
Die Resultate dieser Bemühungen sind uns allen bekannt, wenn auch vielleicht nicht allen bewusst. Viele Haustiere, aber auch Nutzpflanzen wären ohne die schützende Hand des Menschen in freier Wildbahn nicht mehr lebensfähig.
Höhere Organismen wie Pflanzen oder Tiere sind für landwirtschaftliche Anwendungen gedacht, finden aber teilweise immer mehr Anwendung als "Biofabriken", in denen eine Vielzahl fremder pharmazeutisch oder medizinisch nutzbarer Substanzen produziert werden kann. Das Züchten von Nutztieren hat jedoch eine lange Tradition und wird auch in Zukunft mit Sicherheit nicht eingestellt werden. Es werden auch zunehmend gentechnische Methoden hierbei eingesetzt.
In der Presse wurden ausgiebig transgene Schweine diskutiert, die über ein zusätzliches Gen für ein Wachstumshormon verfügen. Dieser unausgewogene Eingriff in den Schweineorganismus bedingte neben einer Vergrößerung der Körpergröße auch Arthritis. Wir würden die Fortsetzung dieser speziellen Zuchtlinie als unverantwortlich bezeichnen. Die Herstellung unglücklicher Geschöpfe gelingt dem Menschen jedoch nicht erst mit Hilfe der Gentechnik. Nirgends sonst wird das so deutlich wie bei einigen, mit klassischer Kreuzungsgenetik erzeugten, Hunderassen.
Das Argument von unkontrollierbaren, unvorhersehbaren Risiken und von unglücklichen Geschöpfen spricht daher nicht gegen die Gentechnik an sich, sondern generell gegen eine solche Nutzung der Natur für die eigenen Zwecke und ist daher ein Thema für sich. Denn die moderne, molekulare Gentechnologie hat die Zielsetzungen genetischer Manipulationen nicht verändert; sie stellt jedoch einen methodischen Durchbruch dar, der die Effizienz der Züchter in Zukunft gewaltig steigern wird.
Durch diesen (bisher allerdings weitgehend hypothetischen) Machbarkeitszuwachs rückt die Tätigkeit der Züchter in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ist es legitim, dass der Mensch Pflanzen und Tiere nach seinen Vorstellungen und zu seinem Nutzen umbaut? Ja, besteht vielleicht sogar die Gefahr, dass der Mensch beginnt, sich selbst genetisch umzuprogrammieren?
Im folgenden werden zunächst die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Gentechnologie besprochen. Die Frage nach der Verantwortbarkeit dieser Technologie muss dann mit der Frage nach den Chancen und Risiken ihrer möglichen Anwendungen erwogen werden.
Pflanzenzucht
DNA wird beim Tod von Zellen freigesetzt. Unter bestimmten Bedingungen können lebende Zellen diese DNA-Moleküle aufnehmen und in ihr Genom integrieren. Dies gelang erst Cohen und Mitarbeitern 1972. Sie nutzten die Transformation, um ein Darmbakterium durch die Addition manipulierter DNA gegen bestimmte Antibiotika resistent zu machen. Damit war die Gentechnologie im engeren Sinne geboren.
Aus dem Pflanzenreich ist ein eindrucksvolles Beispiel für natürliche Gentechnologie bekannt. Das Bodenbakterium Agrobacter tumefaciens erzeugt in zweikeimblättrigen Pflanzen sogenannte Wurzelhalsgallentumore. Diese Bakterien besitzen zusätzlich zur eigenen Erbinformation ein kleines ringförmiges DNA-Molekül (Ti-Plasmid) und die Fähigkeit, ein bestimmtes Stück dieser DNA in Pflanzenzellen einzuschleusen. Die infizierten Pflanzenzellen bilden dann den Gallentumor und beginnen mit der Synthese seltener Verbindungen, Opine genannt, die das Bakterium zum Wachstum benötigt, aber nicht selbst herstellen kann. Agrobacter betreibt also Gentechnologie, um sein Überleben zu sichern. Der Gentechnologe kann sich die Tricks des Bakteriums aneignen, dessen DNA Übertragungsmechanismus einsetzen und so Pflanzen dem Menschen nutzbar machen.
Die Ziele der Zucht von Nutzpflanzen sind seit alters her Qualitätsverbesserung, Ertragssteigerung und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit. Die Gentechnologie stellt Methoden bereit, um diese Ziele effektiver als bisher zu erreichen. Sie wird die bisherige Pflanzenzüchtung in wichtigen Punkten ergänzen, aber nicht verdrängen.
Euphoriker der Biotechnik versprechen unablässig, mit Genpflanzen den Welthunger zu stillen, der darauf beruhe, dass nicht genug Nahrungsmittel für alle vorhanden wären. Es ist trügerisch die Gentechnologie mit dieser scheinbar sozialen Notwendigkeit rechtfertigen zu wollen, zumal erstens genug Nahrungsmittel vorhanden sind, deren gleichmäßige Verteilung Hungernöte beseitigen würde (Per Pinstrup-Andersen, Generaldirektor des Internationalen Forschungsinstituts für Ernährungspolitik in Washington) und zweitens könnte man als Endlösung des Hungerproblems die Armut und damit einhergehend die Überbevölkerung beseitigen mit den Milliarden, die in die Gentechnologie investiert werden.
Man darf nicht vergessen nach Ursachen zu suchen, bevor man die Gentechnik als Allheilmittel anpreist.
Eine ganz andere Dringlichkeit, die in den nächsten Jahrzehnten unser Leben beeinträchtigen wird, ist das Schmelzen der Polarkappen und der dadurch ansteigende Meeresspiegel. Als Folge dieser Salzwasser-Überschwemmung gehen uns viele Nutzflächen verloren. Um sie dennoch nutzen zu können, gibt es derzeit ein Projekt zweier Gymnasiasten aus Bayern, die sich damit befassen eine Tomate zu entwickeln, die unter Extrembedingungen wie Salzwasser und Temperaturen unter 0° C wächst und dennoch größer ist, mehr Nährwerte hat und dazu noch gut schmeckt. Dazu bedienen sie sich zum Beispiel Genen von Mangroven, die in Brackwasser wachsen.
Das Projekt ist zwar noch in seinen Anfängen, sein Gelingen hieße jedoch einen Durchbruch in der Landwirtschaft. Damit könnten einige Nutzflächen auf das Wasser verlagert und damit der ländlichen Natur mehr Freiheit eingeräumt werden. Außerdem könnten sogar ,,unfruchtbare" Gegenden, die stark auf Importe angewiesen sind, nun auch sich selbst versorgen.
Man darf allerdings auch nicht die Probleme verkennen, die mit solchen Veränderungen entstehen können.
Einerseits weiß man nicht, wie sich so etwas auf das Umweltgleichgewicht auswirkt.
Dennoch ist es zur Erforschung eventueller Nachwirkungen und Risiken notwendig das Verhalten der Pflanzen in ,,freier Wildbahn" zu erforschen. Das heißt, um zu wissen, ob die Laborexperimente sich auch in der Natur bestätigen, müssen genmanipulierte Pflanzen auf speziell angelegten Feldern untersucht werden. Diese Versuche sollen erste Einblicke in ökologische Zusammenhänge zwischen gentechnisch veränderten und freilebenden Pflanzen geben und andere Fragen im Rahmen einer biologischen Sicherheitsforschung klären. Daher ist der Ansatz der sogenannten Ökologen gegen diese Forschung falsch, wenn sie ihre Kritik darin äußern, indem sie die Forschungsflächen zerstören und damit weitere Erkenntnisse hemmen. Denn die Versuchspflanzen sind so konstruiert, dass sie nur auf bestimmten Nährböden wachsen und daher kontrollierbar sind. Sie sind zu schwach, um sich frei in der Natur zu entwickeln.
Andererseits sehen viele Kritiker eine besondere Problematik darin, dass durch die Genmanipulation mögliche Nebeneffekte auftreten könnten: z.B. eine Auswirkung auf den sekundären Stoffwechsel der Pflanzen.
Dies könnte eine Auswirkung auf die Produktion möglicher allergener Substanzen haben.
Durch die Produktion von neuen Eiweißen nehmen Allergien in erschreckendem Ausmaß zu. Außerdem könnten bereits betroffene Allergiker dadurch Probleme bekommen, dass bestimmte Eiweiße aus speziellen Pflanzen, gegen die sie allergisch reagieren, sich in anderen Nahrungsmitteln wiederfinden. Wer vermutet schon tierische Eiweiße in Kartoffeln oder in Tomaten Erdnussproteine?
In diesem Zusammenhang hat ein Beispiel besonders in den USA die Diskussion neu entfacht. Die Sojabohne wurde mit einem Protein aus der Paranuss versehen, um einen höheren Nährwert zu erreichen. Gerade dieses eine Protein aus einem Spektrum von mehr als 1000 Proteinen der Paranuss hat sich als ein Auslöser von Allergien entpuppt. Daraufhin wurde ein Antrag auf Marktzulassung zurückgezogen.
Es gibt trotz alledem Projekte, die durchaus für die Natur (und darin inbegriffen die Menschheit) von Vorteil wären:
Biologische Stickstofffixierung
Die Herstellung des Stickstoffdüngers verbraucht sehr viel Energie, so dass hohe Kosten für den Landwirt entstehen. Zudem verseuchen die Nitrate unser Trinkwasser. Eine Verringerung der weltweiten Produktion von Stickstoffdünger ist deshalb von Nöten.
Stickstoff ist ein lebenswichtiger Baustein für alle Lebewesen. Leider können Pflanzen den Stickstoff aber nicht aus der Luft aufnehmen, sondern nur über die Wurzeln in der Form von Nitraten oder Ammonium. Der Ertrag auf den Feldern ist deshalb direkt mit der Intensität der entsprechenden Stickstoffdüngung gekoppelt.
Im Gegensatz zu den höheren Pflanzen haben manche Bakterien die Fähigkeit, Stickstoff direkt aus der Luft aufzunehmen. Daraus ziehen z.B. die Erbse und andere Leguminosen ihren Nutzen, in dem sie sich die entsprechenden Bakterien als Haustiere halten. Die Rede ist von den Knöllchenbakterien, die mit den Leguminosen in Symbiose leben.
Es gibt verschiedene gentechnologische Forschungsansätze mit dem Ziel, andere Nutzpflanzen als die Erbse zur biologischen Stickstofffixierung zu befähigen:
Eine Methode ist die Übertragung der für die Stickstofffixierung notwendigen bakteriellen Gene direkt in die Pflanze. Dies ist bereits gelungen, die Gene sind auch aktiv, aber ihre Produkte, insbesondere das Enzym Nitrogenase, arbeiten in den Pflanzen nicht in Gegenwart von Sauerstoff. Das ist ein Lehrbeispiel dafür, dass die Übertragung von Genen aus einem Organismus in einen anderen nicht ohne weiteres erwarten lässt, dass deren Produkte dann dort funktionieren.
Wesentlich vielversprechender ist der Versuch, die Bakterien so zu verändern, dass sie eine Symbiose auch mit anderen Wirtspflanzen eingehen. Daran wird intensiv gearbeitet und es ist zu hoffen, dass dies langfristig gelingen wird.
Herbizide
Zur Zeit sind über 800 verschiedene Herbizide auf dem Markt. Herbizide kommen zum Einsatz, um sogenanntes Unkraut auf Feldern zu vernichten. Wenn es gelänge, alle Nutzpflanzen einer Fruchtfolge gegen das gleich Herbizid resistent zu machen, dann könnte die Anzahl der existierenden Herbizidsorten reduziert werden. Dies könnte eine Standardisierung der Handhabung und damit größere Sicherheit gewinnen helfen. Zudem ist es ein mit der Gentechnik erreichbares Ziel, biologisch abbaubare Herbizide herzustellen, die nicht mehr wie herkömmliche Herbizide unser Grundwasser verseuchen.
Dem Argument, dass durch die Anwendung eines effektiven Herbizids (und sei es noch so leicht abbaubar), die Artenvielfalt auf dem Feld reduziert werde, ist entgegenzuhalten, dass der Flächenverbrauch der Landwirtschaft (bei gleicher Produktion) ohne Herbizide noch größer wäre und damit in der Gesamtbilanz der Naturverbrauch ebenso.
Mit Hilfe der Gentechnik können Pflanzen auch gegenüber tierischen Schädlingen und gegenüber Pilzbefall resistent gemacht werden. Bei vielen Nutzpflanzen könnte zudem der Ertrag gesteigert werden, wenn es gelänge, wie es bei einigen Kulturpflanzen mit Hilfe der klassischen Züchtungsgenetik seit Jahrtausenden bereits versucht wird, sie an die jeweiligen Standorte und Witterungsbedingungen optimal anzupassen.
An diesen beiden Beispielen sollte verdeutlicht werden, dass gentechnologische Eingriffe durchaus für die Natur zum Vorteil sein können. Natürlich würde es der Natur noch besser gehen, wenn der Mensch nicht existierte. Aber da er nun ein Mal existiert, muss man versuchen das Beste daraus zu machen. Wir können natürlich nicht auf landwirtschaftliche Nutzung verzichten, da wir uns ernähren müssen. Aber wir können versuchen es so zu machen, dass es möglichst naturfreundlich ist. Dazu können wir uns (paradoxer Weise) durch Eingriffe in die Natur wieder dem natürlichen Gleichgewicht nähern, indem wir uns der natürlichen Vorgänge als Vorbilder bedienen.
Abfallbeseitigung
Die Bevölkerungsexplosion auf dieser Erde stellt uns zukünftig nicht nur vor das Problem der Welternährung. Ein viel größeres Problem ist der Zuwachs an entstehendem Abfall. Ohne umfassende technologische Veränderungen ist absehbar, wann uns die Abfall-Lawine überrollt. Welchen Beitrag könnte die Gentechnologie hier leisten?
Seit eh und je zersetzen Mikroorganismen chemische Verbindungen in ihre Bestandteile oder wandeln sie um und tragen somit wesentlich zum Stoffkreislauf auf der Erde bei. Der Mensch macht sich diese Fähigkeit der Mikroorganismen in vielfältiger Weise zunutze. In Kläranlagen werden die privaten und die industriellen Abwässer durch gezielt eingesetzte Mikroben gereinigt. Durch die Verwendung gentechnologischer Methoden könnte deren Effektivität verbessert werden. Wahrscheinlich könnten gentechnologisch veränderte Mikroorganismen auch auf Chemikalien angesetzt werden, die sich bisher noch einer biologischen Zersetzung entziehen. Vielleicht wird es irgendwann sogar möglich sein die Halbwertszeit des Atommülls bedeutend herabzusetzen.
Medizinische Anwendungen
Zu den Anwendungen der Gentechnologie, die den Menschen direkt betreffen, gehören diejenigen im medizinischen Bereich. Hormone sollen kurz besprochen werden.
Hormone
Eines der gentechnisch hergestellten Hormone, G-CSF, das die Bildung weißer Blutkörperchen anregt, wurde bei zunächst 16 Krebspatienten angewendet. Ein Nebeneffekt der üblichen Chemotherapie bei Krebs ist die Zerstörung des Knochenmarks. Dadurch werden Krebspatienten anfällig für Infektionen. Dieses Risiko hat bisher die Bekämpfung von Krebs wesentlich behindert und z.B. die möglichen Dosen von Medikamenten begrenzt. Hier kann das Hormon G-CSF teilweise Besserung schaffen. Gaben des Hormons G-CSF bewirkten bei den 16 Patienten, dass sich ihr Knochenmark sehr viel schneller als normal von den Folgen der Chemotherapie erholte.
Das Hormon GM-CSF, das ebenfalls die Bildung weißer Blutkörperchen fördert, konnte bei AIDS-Patienten die Konzentration der weißen Blutkörperchen, die als Teil des Abwehrsystems in zu niedrigen Konzentrationen vorkamen, dosisabhängig auf normale Werte und darüber steigern.
Die klinischen Ergebnisse mit den gentechnologisch gewonnenen Hormonen zeigen, was die Versuche an Zellkulturen und dann Tierversuche bereits hatten vermuten lassen: Die in Bakterien vermehrten Hormone entfalten ihre Wirkung im Menschen effektiv und zwar als körpereigene Substanzen - anders als viele Pharmaka - in spezifischer Weise, ohne ersichtliche Nebenwirkungen.
Durch die Presse gingen Berichte über künstlich Aids-infizierte Mäuse und wurden als Indiz für die Perversion der Gentechnologen hingestellt. Es wurde kaum ein Gedanke darauf verwendet, dass es die Intention der hieran beteiligten Forscher ist, mit Aids-infizierten Mäusen den vielen Aids-infizierten Menschen zu helfen. Die Vermehrung von Viren in fremden Wirten kann eine Möglichkeit sein, ihnen ihren pathogenen Charakter zu nehmen.
Der erste Impfstoff überhaupt, der gegen die Pocken, wurde 1798 von dem englischen Arzt Jenner gefunden, der bemerkte, dass an Kuhpocken erkrankte Melkerinnen gegen die menschlichen Pocken immun waren. Gegen seine Impfungen gab es damals wütende Proteste. Inzwischen gelten die Pocken als ausgestorben, nicht die Kühe und erst recht nicht die Menschen.
Wer möchte die Verantwortung übernehmen, Experimente mit Aids-infizierten Mäusen als verantwortungslos zu bezeichnen, wenn sie die kleinste Hoffnung bieten, einen Impfstoff gegen Aids zu gewinnen?
Grundlagenforschung
Der Anwendungsbereich, in dem die Gentechnologie am festesten verankert ist, ist die biologische und medizinische Grundlagenforschung. Es ist ein wichtiges Ziel herauszufinden, welche Aufgaben den einzelnen Genen im Organismus zukommen. Wenn dies bekannt ist, können genetisch bedingte Krankheiten ursächlich behandelt werden. Hierzu gehören Erbkrankheiten, aber z.B. auch Krebs, Virusinfektionen und Immunreaktionen. Als Beispiel sei folgendes Projekt beschrieben: Es handelt von der Untersuchung des Nervenwachstums, insbesondere wie Nervenzellfortsätze während der Embryonalentwicklung oder bei der Regeneration eines Nerven nach einem Unfall manchmal über sehr große Entfernungen zu ihren Zielzellen (z.B. zum Muskel) gelangen. Für diese Leistung müssen in den Nervenzellen bestimmte Gene aktiv sein. Man untersuchte die Funktion solcher Gene, die z.B. bei Mensch, Huhn, Maus, Zebrafisch oder Fliege isoliert wurden, in Drosophilas. Die Drosophilaforschung besitzt ein großes Arsenal genetischer und gentechnischer Methoden. Hier ist es z.B. möglich, beliebige Gene in definierten, ausgewählten Zelltypen zu aktivieren. Mit dieser Technik kann die Funktion eines Eiweißmoleküls vom Huhn oder der Maus quasi stellvertretend in einer wachsenden Nervenzelle der Fliege untersucht werden. Die erhaltenen Ergebnisse sind hilfreich beim Versuch, die molekularen Mechanismen von Nervenwachstum in Wirbeltieren und selbst im Menschen zu verstehen. Das Verständnis der Grundlagen des Nervenwachstums ist notwendig für die richtige therapeutische Unterstützung regenerativer Heilungsprozesse. Ein Zurückdrehen der Uhr, d.h. ein Verzicht auf gentechnologische Methoden in der Forschung, ist völlig undenkbar und wird glücklicherweise wohl auch nirgends von ernstzunehmenden Gruppen in Erwägung gezogen. Ein solches Verbot würde einem Verbot der Grundlagenforschung überhaupt gleichkommen, wäre mit der Unterdrückung von Wissen identisch und nur in einem totalitären Staat vorstellbar.
Abschließende Bewertung
Die aufgeführten Beispiele von Anwendungsmöglichkeiten der Gentechnologie sollten gezeigt haben, dass die pauschale Ablehnung dieser neuen Technologie unverantwortlich ist. Selbst wenn nur wenig Hoffnung besteht, dass ihre innovative Ausarbeitung für die Sicherung der Lebensgrundlage von Milliarden von Menschen ausreicht - wir müssen versuchen die kleinste Chance zu nutzen. Diese Feststellung kann aber keine generelle Freigabe aller möglichen Experimente bedeuten. Jedes gentechnologische Projekt hat sich einzeln einer gründlichen Abwägung seiner Chancen und Risiken zu unterziehen. Es besteht bei dem gegenwärtigen Wissensstand ein breiter Konsens für das Verbot von Eingriffen in die Keimbahn des Menschen. Demgegenüber dürfen somatische, gentherapeutische Eingriffe bei einer Notlage nicht verweigert werden.
Man kann also zusammenfassen, dass die Gentechnologie an sich und durch Einschränkungen von Gesetzen als positiv zu bewerten ist.
Jedoch halten wir ihren Einsatz in einem profitorientierten Wirtschaftssystem wie unserem für sehr fraglich. Wenn man sich ansieht, wie viel Zeit und Geld daran verloren ging, als das menschliche Genom gleichzeitig von 2 Projekten zu entschlüsseln versucht wurde. Indem Craig Venter das öffentliche Human-Genom-Projekt verließ, seine eigene Firma ,,Celera Genomics" gründete und mit ihr das selbe Ziel verfolgte (mit dem Vorteil sich der öffentlich Gen-Datenbank bedienen zu können) machte er allzu deutlich, dass er vielmehr finanzielle Interessen verfolgte und nicht wissenschaftliche. Die Forschungsergebnisse des öffentlichen Projektes sind in einer Gen-Datenbank für jeden frei verfügbar. Die Ergebnisse des privaten Unternehmens sind unter festgelegten Bedingungen und nach Bezahlung einzusehen. Damit wird die Wissenschaft behindert, nur weil man sie auf eine profitorientierte Ebene reduziert. Genauso verhält sich mit Patenten auf identifizierte Gene. Es ist erstens unverständlich, warum man auf ein Gen, das nicht erfunden wurde, sondern lediglich entdeckt, ein Patent bekommen kann. Noch viel unverständlicher erscheint das Patentrecht, wenn man bedenkt, dass Patente vergeben werden auf Gene, dessen Funktion noch nicht vollständig bekannt ist. Ferner behindert die Patentvergabe die Forschung, da sie durch die Anhäufung der Patente bei einigen großen Firmen die Weiterforschung an diesen Genen durch kleinere Unternehmen hemmt. Denn diese haben meist nicht genug finanzielle Mittel zur Verfügung, um sich Forschungsrechte auf Gene zu kaufen.
Weniger die Gentechnologie als solche, sondern viel mehr die Gefahr des Missbrauches, für welchen unser Wirtschaftssystem die Basis bietet, ist das Problem, mit dem man sich auseinandersetzen sollte.
Albert Camus in ,,Die Pest": ,,Das Böse in der Welt rührt fast immer von der Unwissenheit her, und der gute Wille kann so viel Schaden anrichten wie die Bosheit, wenn er nicht aufgeklärt ist". Wir alle sollten daraus folgern, dass es notwendig ist, unsere Meinungen ständig zu hinterfragen, damit sich unsere Absichten nicht ins Gegenteil verkehren.
Quellen
1. Ostsee-Zeitung 19.03.1997
2. Deutsche Ärzteblatt 21.03.1997
3. P.M. Perspektive Biotechnik Jahrg. 90/017
4. Stefan Seidel, Werner Thumshirn
5. Der Spiegel 15/97
6. Spektrum der Wissenschaft Januar 1994
7. Spektrum der Wissenschaft Juli1996
8. Spektrum der Wissenschaft September 2000
9. London (AP), Montag, 8. Juni 1998
10. ,,Wissenschaftliche Grundlagen, Anwendungsmöglichkeiten und der Versuch einer Einordnung von Chancen und Risiken" K.F. Fischbach
11. Institut für Biologie III der Universität, Freiburg
Häufig gestellte Fragen
Was ist Gentechnologie laut diesem Text?
Gentechnologie ermöglicht die gezielte Veränderung des Erbgutes von Organismen durch die Addition bzw. Subtraktion synthetischer oder artfremder Gene. Man erhofft sich davon eine Lösung zahlreicher Probleme im Bereich der Medizin, der Landwirtschaft, der Umwelttechnik und der Ernährung.
Welche Bedenken gibt es hinsichtlich der Gentechnologie?
Es gibt Skepsis gegenüber der Gentechnik aufgrund der Möglichkeit negativer Folgen, ähnlich wie bei der Atomtechnik. Es wird betont, dass Chancen und Risiken einzeln und projektbezogen abgewogen werden müssen. Die Forschung und Industrie müssen transparent sein und die Ziele und Gründe für den Einsatz von Gentechnik erläutern. Prinz Charles fordert eine klare Kennzeichnungspflicht gentechnisch veränderter Produkte.
Wie positioniert sich die Nordelbische Kirche zur Gentechnologie?
Die Kirche betont Ehrfurcht und Respekt vor der Schöpfung und lehnt Eingriffe in menschliche Embryonen zur Ausschaltung unerwünschter Erbanlagen ab. Sie hält jedoch die Heilung bestimmter Krankheiten mit Hilfe der Gentechnik (Produktion von Medikamenten und Impfstoffen, Gentherapie) für verantwortbar.
Welche unterschiedlichen Meinungen gibt es zur Gentherapie?
Die Meinungen gehen weit auseinander. Einige Experten sehen die Möglichkeit, menschliche Keimzellen zu manipulieren, um Körpergröße und Intelligenz zu erhöhen. Andere warnen vor unvorhergesehenen Folgen und möglichen Verschlechterungen des Zustandes gesunder Menschen. Eingriffe in die Keimbahn werden kritisch betrachtet, während die Therapie von Körperzellen zur Heilung von Krankheiten grundsätzlich anders bewertet wird.
Was ist der Unterschied zwischen Eingriffen in Körperzellen und Keimbahnzellen?
Bei der Therapie von Körperzellen geht es um die Heilung eines Individuums, während Eingriffe in die Keimbahn zukünftige Generationen betreffen. Gentechnologische Manipulation an der menschlichen Keimbahn wird auf dem Stand des heutigen Wissens tabuisiert.
Wie wird Gentechnologie definiert?
Gentechnologie beschreibt die Summe aller Methoden, die sich mit der Isolierung, Charakterisierung, Vermehrung und Neukombination von Genen auch über Artgrenzen hinweg beschäftigen. Ihre wichtigste Grundlage ist die Universalität des genetischen Codes.
Wie unterscheidet sich Gentechnik von traditioneller Tier- und Pflanzenzucht?
Der Mensch betreibt seit Urzeiten Tier- und Pflanzenzüchtung, bei der das Erbgut von Nutzorganismen verändert wird. Die Gentechnik stellt jedoch einen methodischen Durchbruch dar, der die Effizienz der Züchter gewaltig steigern wird.
Welche Ziele werden in der Pflanzenzucht mit Gentechnologie verfolgt?
Die Ziele sind Qualitätsverbesserung, Ertragssteigerung und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit. Gentechnologie wird die bisherige Pflanzenzüchtung in wichtigen Punkten ergänzen.
Könnte Gentechnologie den Welthunger stillen?
Es ist trügerisch, die Gentechnologie mit der Notwendigkeit, den Welthunger zu stillen, zu rechtfertigen, da genug Nahrungsmittel vorhanden sind und deren gleichmäßige Verteilung Hungernöte beseitigen würde. Alternativ könnte man Armut und Überbevölkerung mit den Milliarden, die in die Gentechnologie investiert werden, beseitigen.
Welche Probleme können durch genmanipulierte Pflanzen entstehen?
Es gibt Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf das Umweltgleichgewicht, mögliche Nebeneffekte wie Auswirkungen auf den sekundären Stoffwechsel der Pflanzen und die Produktion möglicher allergener Substanzen. Ein Beispiel ist die Sojabohne, die mit einem Protein aus der Paranuss versehen wurde, das sich als Auslöser von Allergien entpuppt hat.
Welche Vorteile könnte die Gentechnologie in Bezug auf Stickstofffixierung und Herbizide haben?
Es gibt gentechnologische Forschungsansätze, die darauf abzielen, andere Nutzpflanzen als die Erbse zur biologischen Stickstofffixierung zu befähigen, um die Produktion von Stickstoffdünger zu verringern. Zudem könnte die Gentechnologie zur Entwicklung biologisch abbaubarer Herbizide beitragen.
Wie kann die Gentechnologie bei der Abfallbeseitigung helfen?
Gentechnologisch veränderte Mikroorganismen könnten zur Zersetzung von Chemikalien eingesetzt werden, die sich bisher noch einer biologischen Zersetzung entziehen. Es besteht die Hoffnung, dass eines Tages sogar die Halbwertszeit von Atommüll bedeutend herabgesetzt werden kann.
Welche medizinischen Anwendungen der Gentechnologie werden genannt?
Es werden Hormone wie G-CSF und GM-CSF genannt, die bei Krebspatienten bzw. AIDS-Patienten die Bildung weißer Blutkörperchen fördern können. Zudem wird auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen Krankheiten wie Aids hingewiesen.
Welche Bedeutung hat die Gentechnologie für die Grundlagenforschung?
Die Gentechnologie ist in der biologischen und medizinischen Grundlagenforschung fest verankert. Es ist ein wichtiges Ziel herauszufinden, welche Aufgaben den einzelnen Genen im Organismus zukommen, um genetisch bedingte Krankheiten ursächlich behandeln zu können. Ein Beispiel ist die Untersuchung des Nervenwachstums.
Wie lautet die abschließende Bewertung der Gentechnologie?
Die pauschale Ablehnung der Gentechnologie wird als unverantwortlich bezeichnet. Jedes gentechnologische Projekt hat sich einzeln einer gründlichen Abwägung seiner Chancen und Risiken zu unterziehen. Es besteht ein breiter Konsens für das Verbot von Eingriffen in die Keimbahn des Menschen. Somatische, gentherapeutische Eingriffe dürfen bei einer Notlage nicht verweigert werden.
Welche Kritik gibt es am Einsatz der Gentechnologie in einem profitorientierten Wirtschaftssystem?
Es wird die Gefahr des Missbrauchs durch Gewinninteressen kritisiert, z.B. durch die Patentierung von Genen, die nicht erfunden, sondern lediglich entdeckt wurden. Die Patentvergabe behindert die Forschung, da sie die Weiterforschung an diesen Genen durch kleinere Unternehmen hemmt.
- Quote paper
- Matthias Schulz (Author), 2000, Gen-Ethik. Diskussion um die Gentechnik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100234