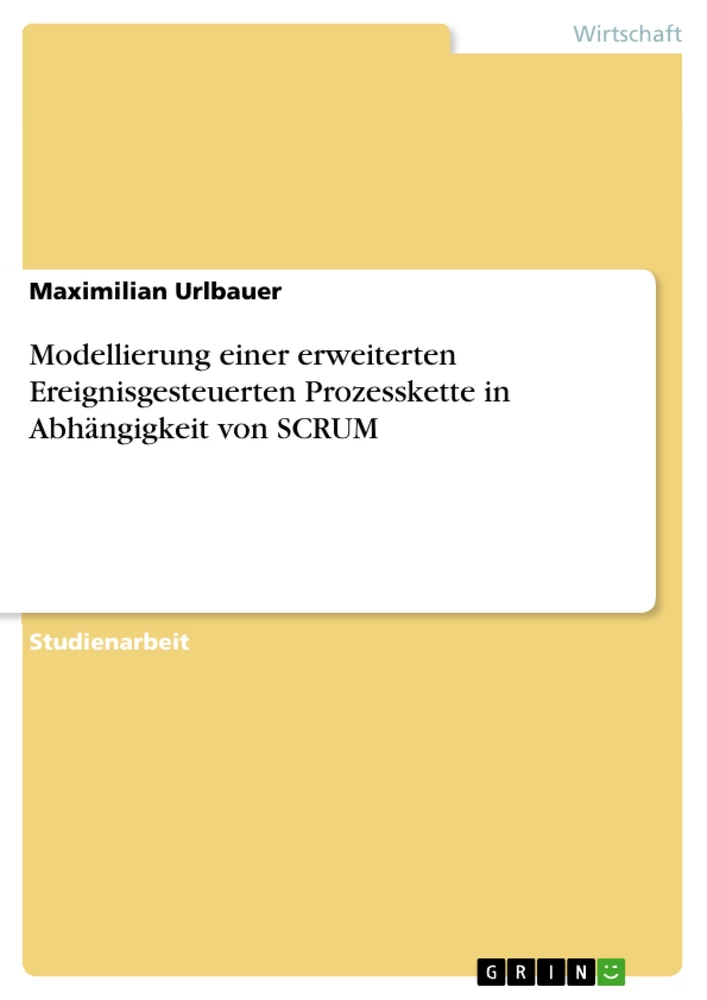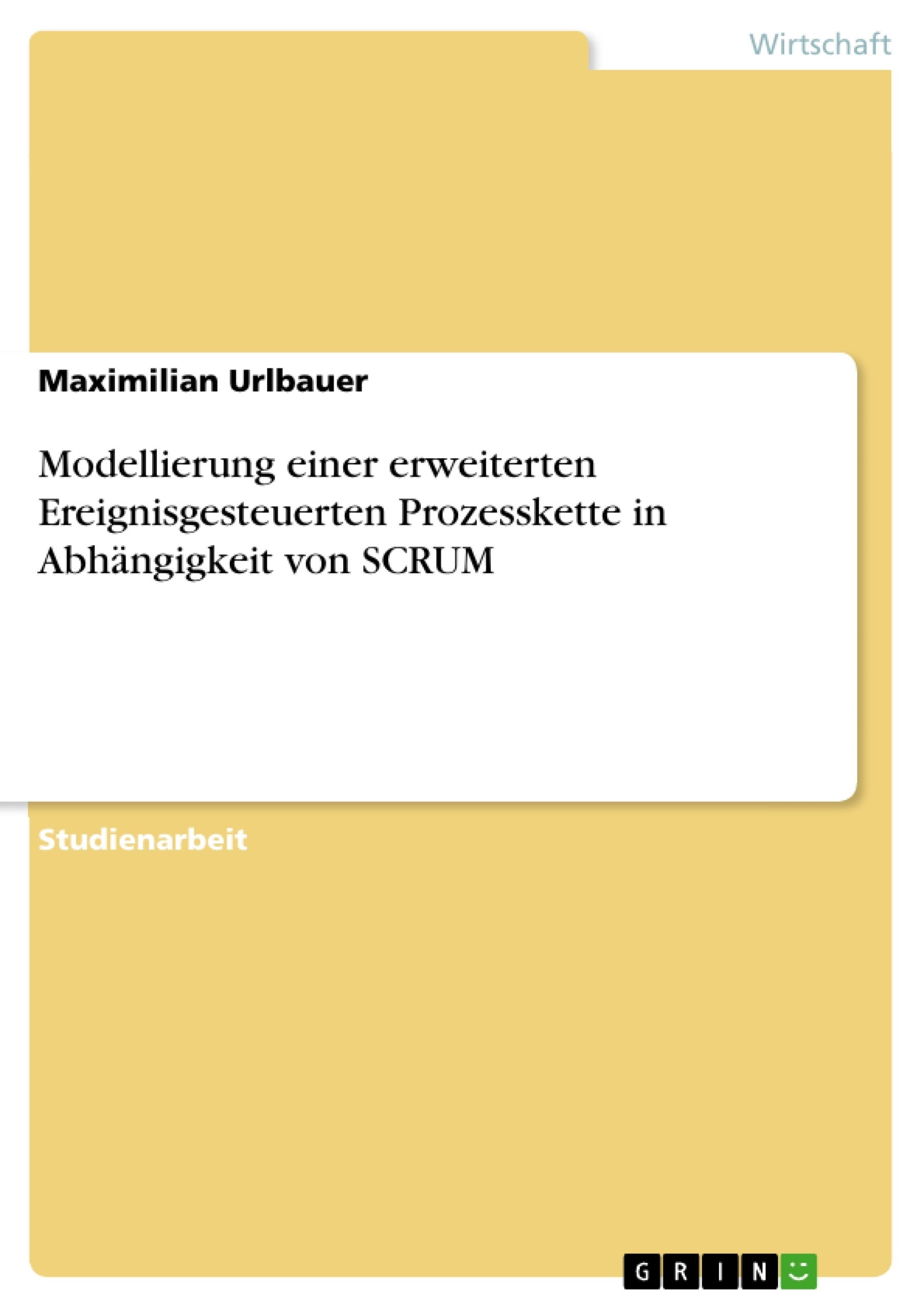In der Arbeit wird die erweiterte Ereignisgesteuerte Prozesskette sowie der Ablauf von SCRUM beschrieben. Durch Modellierung einer eEPK anhand eines Praxisbeispiels, soll ermittelt werden, ob diese in Kombination mit SCRUM verwendet werden kann. Weiterhin werden die Vor- und Nachteile der eEPK gegeneinander abgewogen.
In der heutigen Zeit ist es für Unternehmen wichtiger denn je, Geschäftsprozesse beispielsweise entlang einer Lieferkette zu überblicken, um flexibel und vielseitig auf neue Verhältnisse reagieren zu können. Die Schwierigkeit für Unternehmen ohne ein funktionierendes Prozessmanagement liegt darin, dass diese Prozesse teilweise nicht durchgehend dokumentiert und lückenhaft sind. Dadurch können die Benutzer die benötigten Dokumente bei Bedarf nicht finden und aufgrund der Dokumentationslücken nicht richtig anwenden. Die erfolgreiche Anwendung eines Prozessmanagementtools ist eine Möglichkeit, um nicht notwendigen Aufwand zu minimieren und eine vollständige Dokumentation der laufenden Geschäftsprozesse reibungslos zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition der Begrifflichkeiten
- 2.1 Definition eEPK
- 2.2 Definition SCRUM
- 3 Vor- & Nachteile der EPK/eEPK
- 3.1 Vorteile EPK/eEPK
- 3.2 Nachteile EPK/eEPK
- 4 Praxisbeispiel Auftragsannahme der Firma Miele & Cie. KG
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die erweiterte Ereignisgesteuerte Prozesskette (eEPK) und deren Anwendbarkeit, insbesondere im Vergleich zu agilen Methoden wie Scrum. Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktionsweise der eEPK zu erläutern, ihre Vor- und Nachteile aufzuzeigen und ihre Eignung in praktischen Anwendungsszenarien zu bewerten.
- Definition und Funktionsweise der eEPK
- Vor- und Nachteile der eEPK im Vergleich zu anderen Prozessmodellierungsmethoden
- Anwendbarkeit der eEPK in der Praxis
- Kompatibilität der eEPK mit agilen Vorgehensweisen wie Scrum
- Analyse eines Praxisbeispiels zur Auftragsannahme bei Miele & Cie. KG
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung hebt die Bedeutung eines effektiven Prozessmanagements für Unternehmen hervor, insbesondere die Notwendigkeit einer vollständigen und nachvollziehbaren Dokumentation von Geschäftsprozessen. Sie führt in die Thematik der eEPK ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Funktionsweise, Vor- und Nachteile sowie die Anwendbarkeit der eEPK in einem Praxisbeispiel beleuchtet, inklusive der Betrachtung im Kontext agiler Methoden wie Scrum. Die Einleitung betont den wachsenden Fokus auf wertschöpfende Aktivitäten und die Vorteile der Integration bestehender IT-Systeme in optimierte Prozesse.
2 Definition der Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel definiert präzise die Begriffe „eEPK“ und „Scrum“. Es legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem es die Kernkonzepte beider Methoden klar darstellt und die Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten aufzeigt. Diese präzisen Definitionen sind essenziell für eine fundierte Analyse der Vor- und Nachteile und der Anwendbarkeit beider Methoden im späteren Verlauf der Arbeit.
3 Vor- & Nachteile der EPK/eEPK: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen der eEPK. Es analysiert die Stärken der Methode, wie zum Beispiel die verbesserte Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Prozessen und die Unterstützung bei der Optimierung von Arbeitsabläufen. Gleichzeitig werden auch die Schwächen der eEPK, z.B. möglicher hoher Aufwand bei der Modellierung komplexer Prozesse, beleuchtet. Die Gegenüberstellung von Vor- und Nachteilen ermöglicht eine ausgewogene Bewertung der Anwendbarkeit der eEPK in unterschiedlichen Kontexten.
4 Praxisbeispiel Auftragsannahme der Firma Miele & Cie. KG: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Praxisbeispiel zur Auftragsannahme bei Miele & Cie. KG, modelliert mit Hilfe der eEPK. Es demonstriert die praktische Anwendung der eEPK und illustriert die Vorteile der Methode in einem realistischen Szenario. Die Analyse dieses Beispiels zeigt, wie die eEPK dazu beitragen kann, Geschäftsprozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Die detaillierte Darstellung des Modells ermöglicht eine fundierte Beurteilung der Eignung der eEPK für komplexe Geschäftsprozesse. Die Integration in agile Vorgehensweisen wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Erweiterte Ereignisgesteuerte Prozesskette (eEPK), Scrum, Prozessmanagement, Prozessmodellierung, Geschäftsprozessoptimierung, IT-Integration, Miele & Cie. KG, Prozessdokumentation, Agile Methoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: eEPK vs. Scrum
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit vergleicht die erweiterte Ereignisgesteuerte Prozesskette (eEPK) mit agilen Methoden wie Scrum. Sie erläutert die Funktionsweise der eEPK, zeigt deren Vor- und Nachteile auf und bewertet ihre Eignung in praktischen Anwendungsszenarien. Ein Praxisbeispiel der Auftragsannahme bei Miele & Cie. KG wird analysiert.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Funktionsweise der eEPK, den Vergleich der eEPK mit anderen Prozessmodellierungsmethoden, die praktische Anwendbarkeit der eEPK, die Kompatibilität mit agilen Vorgehensweisen wie Scrum und die Analyse eines Praxisbeispiels (Auftragsannahme bei Miele & Cie. KG).
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Definition der Begriffe eEPK und Scrum, die Darstellung der Vor- und Nachteile der eEPK, ein Praxisbeispiel zur Auftragsannahme bei Miele & Cie. KG und ein Fazit. Jedes Kapitel wird detailliert zusammengefasst.
Was sind die Vor- und Nachteile der eEPK?
Die Vorteile der eEPK liegen in der verbesserten Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Prozessen und der Unterstützung bei der Optimierung von Arbeitsabläufen. Nachteile können ein hoher Aufwand bei der Modellierung komplexer Prozesse sein.
Wie wird die eEPK im Praxisbeispiel angewendet?
Das Praxisbeispiel zeigt die Anwendung der eEPK bei der Auftragsannahme von Miele & Cie. KG. Es illustriert die Vorteile der Methode in einem realistischen Szenario und demonstriert, wie die eEPK zur Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung beitragen kann. Die Integration in agile Vorgehensweisen wird diskutiert.
Wie wird Scrum in der Arbeit behandelt?
Scrum dient als Vergleichsmethode zur eEPK. Die Arbeit definiert Scrum präzise und vergleicht es mit der eEPK hinsichtlich Vor- und Nachteile sowie der Anwendbarkeit in verschiedenen Kontexten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Erweiterte Ereignisgesteuerte Prozesskette (eEPK), Scrum, Prozessmanagement, Prozessmodellierung, Geschäftsprozessoptimierung, IT-Integration, Miele & Cie. KG, Prozessdokumentation, Agile Methoden.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel ist es, die eEPK zu untersuchen und deren Anwendbarkeit, insbesondere im Vergleich zu agilen Methoden wie Scrum, zu bewerten. Die Arbeit soll die Funktionsweise der eEPK erläutern, ihre Vor- und Nachteile aufzeigen und ihre Eignung in der Praxis beurteilen.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine ausführliche Zusammenfassung jedes Kapitels: Einleitung, Definition der Begrifflichkeiten (eEPK und Scrum), Vor- und Nachteile der eEPK, Praxisbeispiel Miele & Cie. KG und Fazit. Diese Zusammenfassungen bieten einen Überblick über den jeweiligen Inhalt.
- Arbeit zitieren
- Maximilian Urlbauer (Autor:in), 2020, Modellierung einer erweiterten Ereignisgesteuerten Prozesskette in Abhängigkeit von SCRUM, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1002192