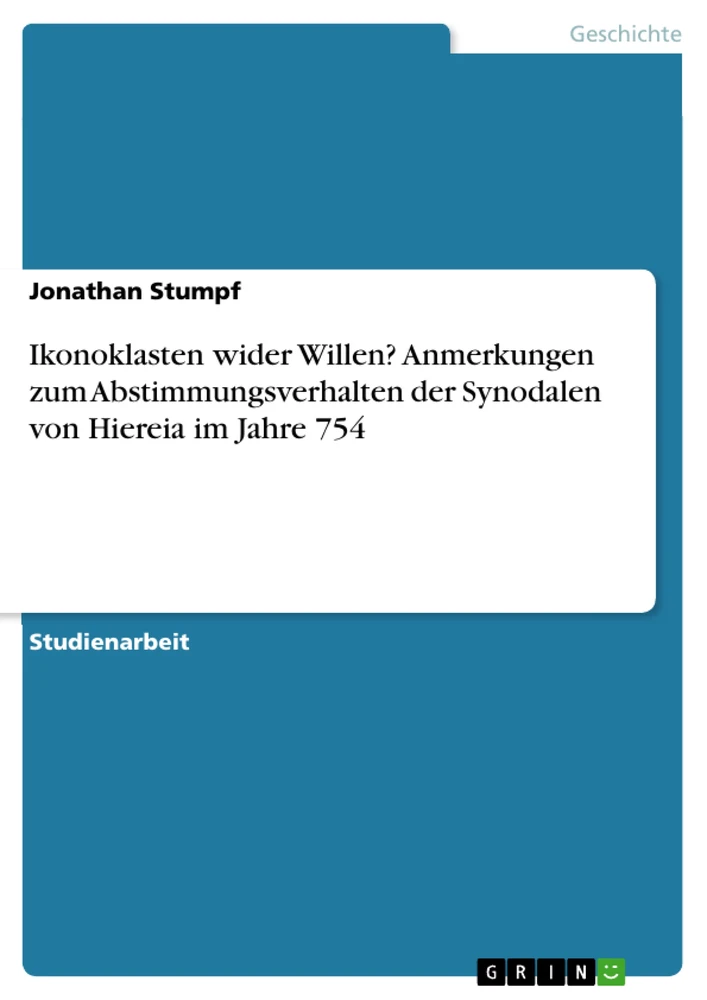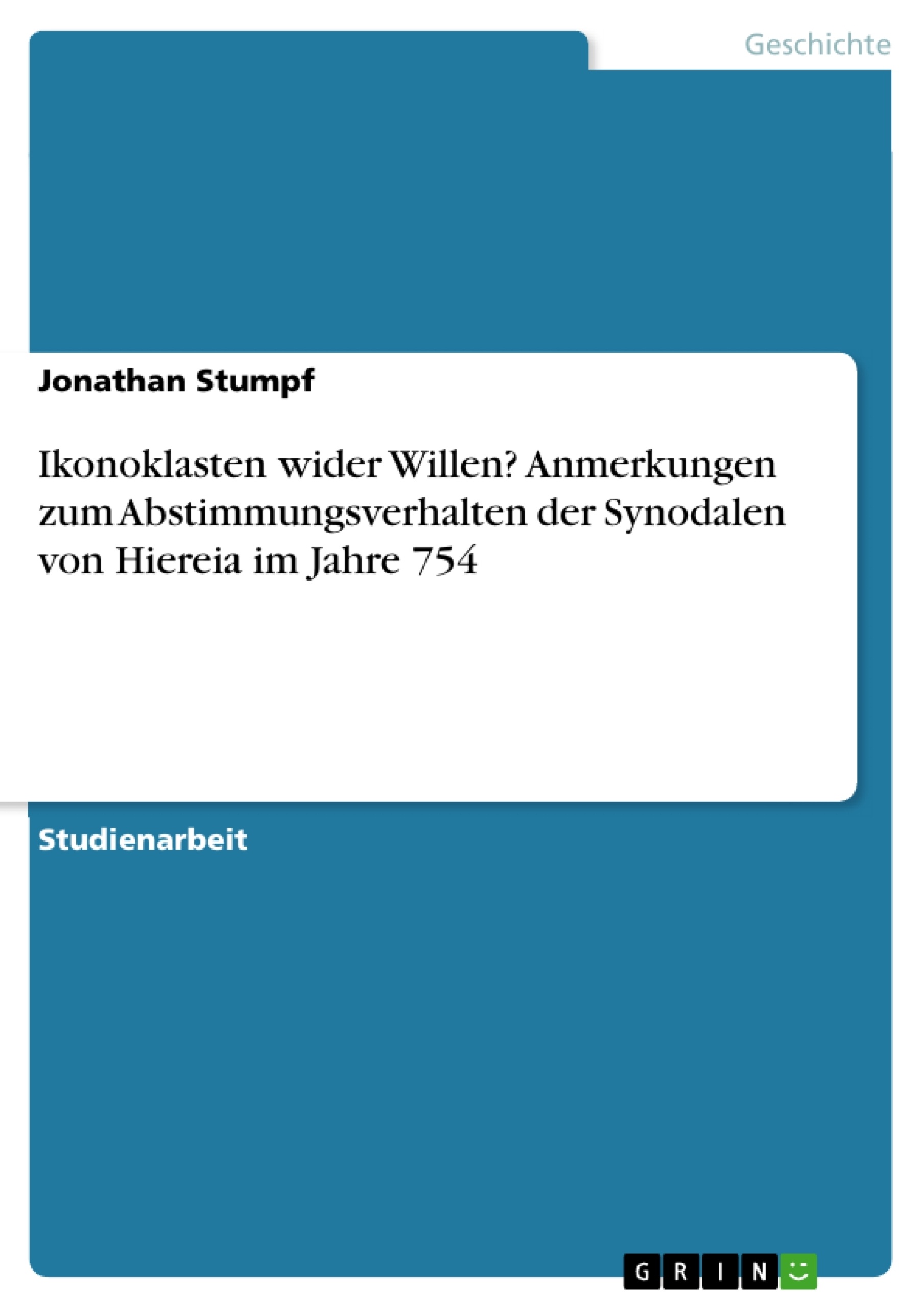In der Arbeit sollen die Thesen der zu konsultierenden jüngeren Forschungsliteratur in eine Bewertung der Quellen zum ikonoklastischen Konzil hinsichtlich der bischöflichen Haltung einfließen, wobei es in der Hauptsache um die Frage gehen wird, ob der Ikonoklasmus eine gegen den Willen der meisten Bischöfe durchgesetzte kaiserliche Politik gewesen ist oder vielmehr im Einklang mit den theologischen Vorstellungen der Prälaten gestanden hat.
Auf Geheiß Kaiser Konstantins V traten im Februar 754 die 338 geladenen Bischöfe im Palast von Hiereia zusammen, um über die Bilderfrage zu disputieren. Es sollte bis zum August dauern, bis auf der letzten Sitzung der Synode in der Blachernenkirche in Konstantinopel der neue Patriarch Konstantin II. ernannt und der Horos beschlossen wurde, der die Verehrung und Anfertigung von Bildern sowohl Christi als auch aller Heiligen verdammte. Waren die in Hiereia versammelten Bischöfe Ikonoklasten wider Willen?
Diese Unterstellung muss umso plausibler erscheinen, je mehr der Ikonoklasmus als eine Theologie der Wenigen, nämlich namentlich des Kaisers und seines Umfeldes, angesehen wird, zu welcher die Mönche und das einfache Volk in unversöhnlicher Opposition standen. Diesen Eindruck vermitteln die spätere ikonodule Geschichtsschreibung und Hagiographie.
Es ist in den letzten Jahrzehnten indes gleich von mehreren Forschern darauf verwiesen worden, wie problematisch diese Quellen z. T. sind. Wenn in dieser Arbeit gefragt werden soll, wie frei die Bischöfe von Hiereia bei ihrer Entscheidung, den Bilderkult zu verurteilen und die Bilderfreunde zu anathematisieren, tatsächlich waren, kann das selbstverständlich nur näherungsweise geschehen und es können hierbei keine letzten Wahrheiten zu Tage gefördert werden. Ein Anliegen der Arbeit ist es hingegen, unter Einbeziehung der Peuseis Konstantins V. den Grad der Übereinstimmung zwischen kaiserlicher Auffassung und Konzilsbeschluss zu eruieren, wobei sich ein solches Unterfangen besonders auf die Habilitationsschrift Georg Ostrogorskys aus den späten 1920er Jahren stützen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ausgangslage
- Die Entwicklung unter Leon III.
- Exkurs: Die Bilderverehrung vor dem Bilderstreit
- Die Entwicklung unter Konstantin V. bis zum Konzil von Hiereia
- Die Fragen Konstantins V. und die Synode von Hiereia
- Waren die Synodalen von 754 Ikonoklasten wider Willen?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Haltung der Bischöfe auf dem Konzil von Hiereia im Jahr 754 zur Bilderfrage. Das Hauptziel ist es, den Grad der Übereinstimmung zwischen der kaiserlichen Auffassung und dem Konzilsbeschluss zu ermitteln und zu analysieren, ob der Ikonoklasmus eine gegen den Willen der meisten Bischöfe durchgesetzte kaiserliche Politik war oder im Einklang mit deren theologischen Vorstellungen stand. Die Arbeit stützt sich auf die verfügbaren Quellen und die Ergebnisse der jüngeren Forschung.
- Die Entwicklung des Ikonoklasmus im 8. Jahrhundert
- Die Rolle Kaiser Leons III. und Konstantins V.
- Die theologischen Debatten um die Bilderverehrung
- Die Quellenlage und deren Interpretation
- Die Haltung der Bischöfe auf dem Konzil von Hiereia
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Konzil von Hiereia im Jahr 754, bei dem die Verehrung von Bildern verurteilt wurde. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Grad der Freiwilligkeit der bischöflichen Entscheidung und skizziert die methodischen Herausforderungen aufgrund der problematischen Quellenlage. Die Einleitung betont die Notwendigkeit, das Konzil im Kontext der geschichtlichen Entwicklungen des 8. Jahrhunderts zu betrachten und verweist auf die bestehenden Kontroversen in der Forschung.
Die Ausgangslage: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die geschichtlichen Entwicklungen des 8. Jahrhunderts, die zum Konzil von Hiereia führten. Es skizziert die wichtigsten Eckpunkte der Entwicklung, wobei der Fokus auf die Aspekte gelegt wird, die für die Fragestellung der Arbeit relevant sind. Das Kapitel betont, dass das Konzil nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern im Kontext der damaligen Ereignisse und geistigen Strömungen verstanden werden muss.
Die Entwicklung unter Leon III.: Dieses Kapitel behandelt die Anfänge des Ikonoklasmus unter Kaiser Leon III. Es analysiert die Briefe des Patriarchen Germanos und diskutiert die verschiedenen Interpretationen der Ereignisse um den Vulkanausbruch von 726 und den möglichen Zusammenhang mit der Ablehnung der Bilderverehrung. Es beleuchtet kritisch die historische Zuverlässigkeit verschiedener Überlieferungen, die in der Forschung umstritten sind.
Schlüsselwörter
Ikonoklasmus, Bilderstreit, Konzil von Hiereia (754), Kaiser Leon III., Kaiser Konstantin V., Byzanz, Bilderverehrung, Ikonen, Theologie, Quellenkritik, Konzilsbeschlüsse, Peuseis, Horos, Bischöfe, Historiographie.
Häufig gestellte Fragen zum Text über das Konzil von Hiereia (754)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Haltung der Bischöfe auf dem Konzil von Hiereia im Jahr 754 zur Bilderfrage. Das Hauptziel ist es, den Grad der Übereinstimmung zwischen der kaiserlichen Auffassung und dem Konzilsbeschluss zu ermitteln und zu analysieren, ob der Ikonoklasmus eine gegen den Willen der meisten Bischöfe durchgesetzte kaiserliche Politik war oder im Einklang mit deren theologischen Vorstellungen stand.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Entwicklung des Ikonoklasmus im 8. Jahrhundert, die Rolle Kaiser Leons III. und Konstantins V., die theologischen Debatten um die Bilderverehrung, die Quellenlage und deren Interpretation sowie die Haltung der Bischöfe auf dem Konzil von Hiereia. Er bietet einen Überblick über die geschichtlichen Entwicklungen, die zum Konzil führten, und analysiert die Ereignisse unter Kaiser Leon III. Die Arbeit beleuchtet kritisch die historische Zuverlässigkeit verschiedener Überlieferungen.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in ihnen?
Der Text umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Ausgangslage, ein Kapitel zur Entwicklung unter Leon III., sowie weitere Kapitel zu den Fragen Konstantins V. und der Synode von Hiereia, und ob die Synodalen von 754 Ikonoklasten wider Willen waren. Die Einleitung beschreibt das Konzil von Hiereia und stellt die zentrale Forschungsfrage. Das Kapitel zur Ausgangslage bietet einen Überblick über die geschichtlichen Entwicklungen des 8. Jahrhunderts. Das Kapitel zur Entwicklung unter Leon III. behandelt die Anfänge des Ikonoklasmus unter Kaiser Leon III. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die verfügbaren Quellen und die Ergebnisse der jüngeren Forschung. Die Quellenlage und deren Interpretation werden explizit als Thema behandelt, da die Quellenlage als problematisch beschrieben wird. Der Text erwähnt die Briefe des Patriarchen Germanos und diskutiert die verschiedenen Interpretationen der Ereignisse um den Vulkanausbruch von 726.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Ikonoklasmus, Bilderstreit, Konzil von Hiereia (754), Kaiser Leon III., Kaiser Konstantin V., Byzanz, Bilderverehrung, Ikonen, Theologie, Quellenkritik, Konzilsbeschlüsse, Peuseis, Horos, Bischöfe, und Historiographie.
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Einleitung betont die methodischen Herausforderungen aufgrund der problematischen Quellenlage. Die Arbeit beleuchtet kritisch die historische Zuverlässigkeit verschiedener Überlieferungen, die in der Forschung umstritten sind. Die Notwendigkeit, das Konzil im Kontext der geschichtlichen Entwicklungen des 8. Jahrhunderts zu betrachten und die bestehenden Kontroversen in der Forschung werden hervorgehoben.
- Quote paper
- Jonathan Stumpf (Author), 2016, Ikonoklasten wider Willen? Anmerkungen zum Abstimmungsverhalten der Synodalen von Hiereia im Jahre 754, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1002047