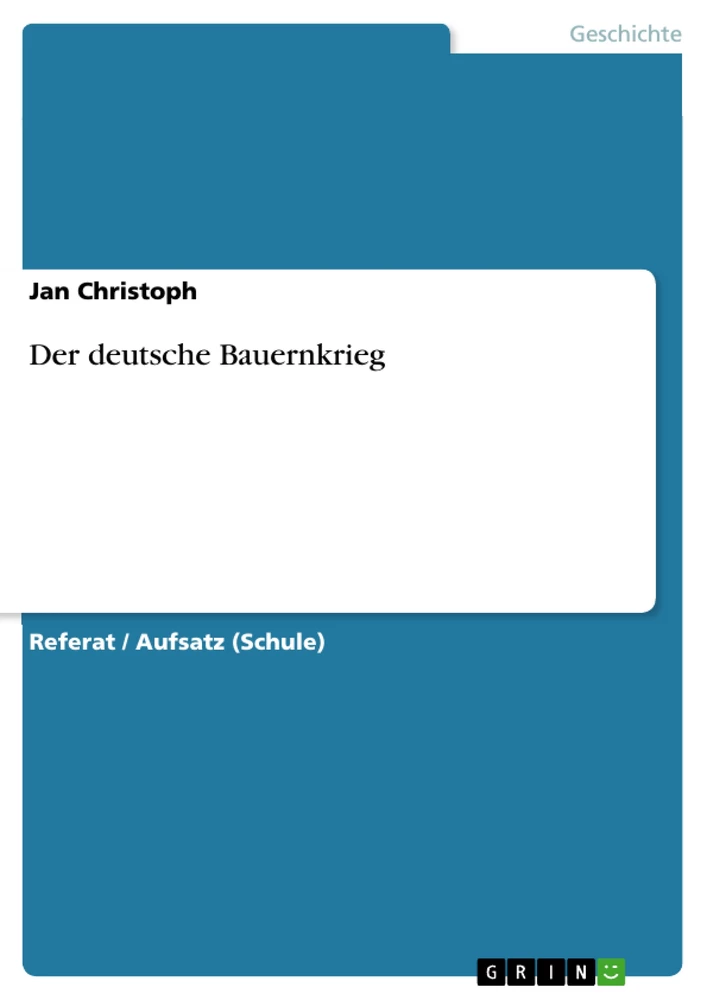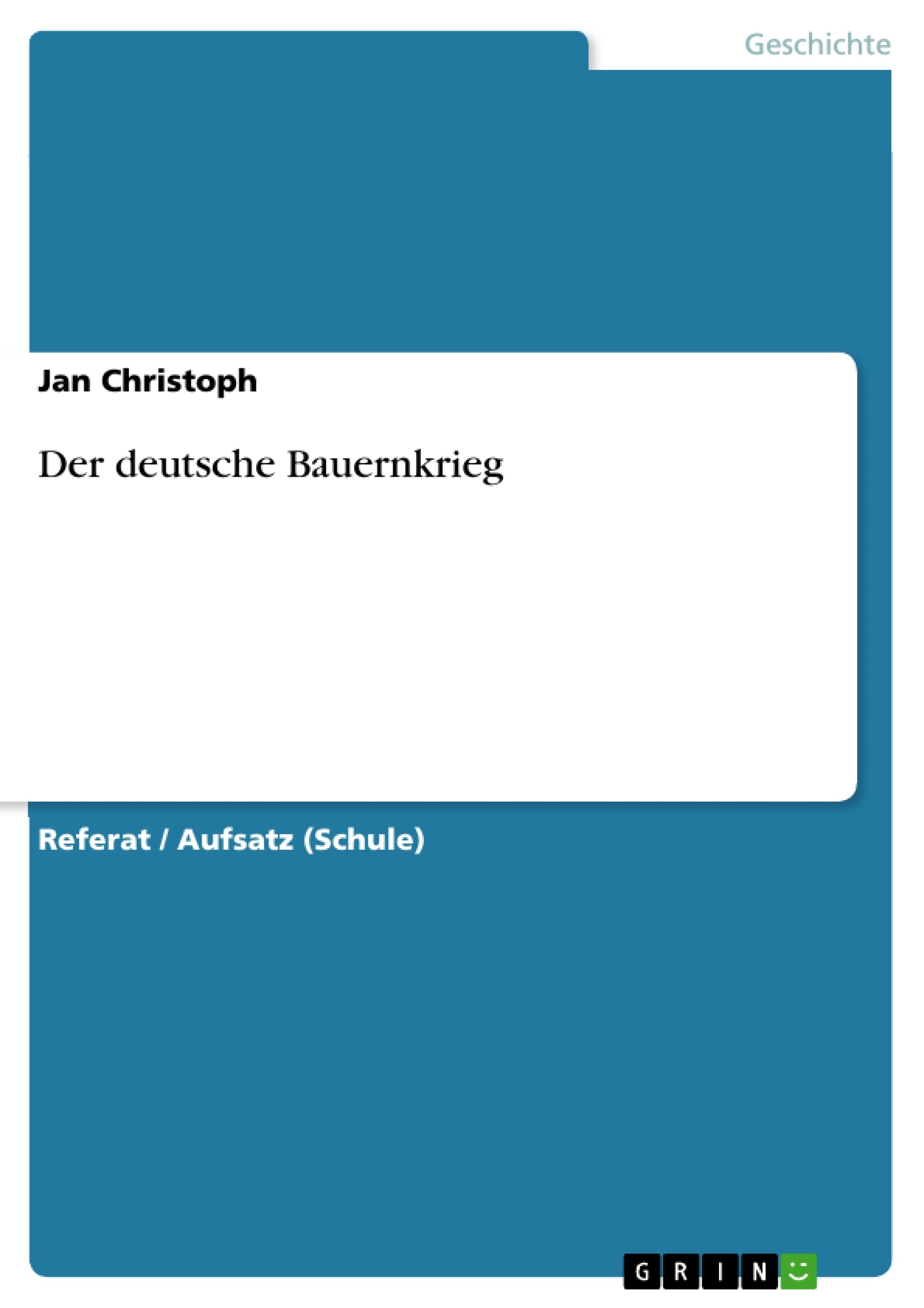Ein finsteres Zeitalter der Aufruhr und des blutigen Konflikts bricht über das Heilige Römische Reich herein! Tauchen Sie ein in die Wirren des Bauernkriegs, einer explosiven Periode des Umbruchs, in der sich unterdrückte Bauern gegen ihre feudalen Herren erhoben. Diese tiefgreifende Analyse entfaltet die komplexen Ursachen, den Verlauf und die verheerenden Folgen dieser epischen Revolte, die das Fundament der deutschen Gesellschaft erschütterte. Erforschen Sie die wirtschaftlichen Ungleichheiten, die sozialen Spannungen und die religiösen Strömungen, die den Konflikt anheizten, von den wachsenden Handelszentren bis zur verarmten Landbevölkerung, die unter der Last erdrückender Abgaben stöhnte. Entdecken Sie die Schlüsselereignisse, von den geheimen Bündnissen des Bundschuhs und des Armen Konrads bis zu den offenen Feldschlachten, in denen schlecht ausgerüstete Bauernheere gegen die schlagkräftigen Armeen der Fürsten antraten. Verfolgen Sie die Schicksale charismatischer Anführer wie Thomas Müntzer, dessen radikale Vision einesReichs Gottes auf Erden die Massen entflammte, und Martin Luther, dessen Reformation zwar religiöse Freiheit versprach, aber die Bauernaufstände letztlich verurteilte. Erleben Sie die brutaleRealität des Krieges, die Zerstörung von Schlössern und Klöstern, die Massaker an wehrlosen Bauern und die rücksichtslosen Vergeltungsmaßnahmen der siegreichen Obrigkeit. Untersuchen Sie die langfristigen Auswirkungen des Bauernkriegs auf die deutsche Geschichte, die Stärkung der fürstlichen Macht, die Stagnation der Bauernbefreiung und die tiefen Narben, die der Konflikt in der kollektiven Psyche der Nation hinterließ. Diese umfassende Studie bietet eine differenzierte Perspektive auf eine entscheidende Epoche der deutschen Geschichte und beleuchtet die zeitlosen Themen sozialer Gerechtigkeit, religiöserInbrunst und des Kampfes um Freiheit und Würde. Entdecken Sie die vielschichtigen Hintergründe des Adelsaufstands unter Franz von Sickingen und seine verhängnisvolle Rolle im Bauernkrieg, sowie die Bedeutung der Zwölf Artikel von Memmingen als revolutionäres Manifest der Bauernschaft. Analysieren Sie die verheerendenKonsequenzen des Krieges, einschließlich der kurzfristigen Verschlimmerung der Bauernlage durch Brandschatzungen und der langfristigen Auswirkungen auf die soziale und politische Struktur Deutschlands. Ergründen Sie den Einfluss der Reformation, insbesondere die konträren Positionen von Martin Luther und Thomas Müntzer, auf die Rechtfertigung und den Verlauf des Bauernkriegs. Abschließend wird eine kritische Bewertung der wichtigsten Quellen, insbesondere Friedrich Engels' "Der deutsche Bauernkrieg", präsentiert, um die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen dieser turbulenten Epoche zu beleuchten und ein umfassendes Verständnis der komplexen Dynamiken des Bauernkriegs zu ermöglichen, von den wirtschaftlichen Nöten und sozialenHierarchien bis zu den religiösen Einflüssen und den militärischen Auseinandersetzungen, die das Schicksal Deutschlands nachhaltig prägten.
Übersicht:
I. Die ökonomische Lage und der soziale Schichtbau Deutschlands
II. Vorläufer des großen Bauernkriegs zwischen 1493 und 1517
III. Der Adelsaufstand
IV. Der Schwäbisch-fränkische Bauernkrieg
V. Der thüringische, elsässische und österreichische Bauernkrieg
VI. Folgen des Bauernkriegs
VII. Einfluß der Reformation auf den Bauernkrieg
VIII. Quellenkritik
IX. Quellenangaben
I. Die ökonomische Lage und der soziale Schichtbau Deutschlands:
Das deutsche Gewerbe und damit der Handel erlebten im 14. /15. Jh. einen Aufschwung, was zum einen auf die wachsende Weberei- und an die Kunst streifende Industrie (Gold- und Silberarbeiter, Bildhauer, Kupferstecher) zurückzuführen ist, als auch auf Erfindungen wie den Buchdruck und die Einführung des Schießpulvers.
Dadurch dass sich der Handel mangels Infrastruktur größtenteils auf die Küsten- bzw. Flußschiffahrt und auf die großen Handelsstraßen von Augsburg und Nürnberg über Köln nach den Niederlanden und über Erfurt nach dem Norden beschränkte, kamen abseitige Städte und Dörfer mit dieser Entwicklung nur wenig und die Landbevölkerung -abgesehen vom Adel- gar nicht in Berührung.
In dieser Zeit begannen aus den großen Reichslehenträgern, dem hohen Adel, fast unabhängige Fürsten hervorzugehen, die nur noch bedingt vom Kaiser abhängig und im Besitz der meisten Hoheitsrechte waren, sodass sie Steuern ausschreiben, Kriege führen und stehende Heere haben durften. Durch ihren gestiegenen Geldbedarf wuchsen auch die Abgaben, die meist die Bauern tragen mußten, da die Städte durch ihre Privilegien oft geschützt waren.
Der mittlere Adel konnte sich entweder zu kleineren Fürsten emporschwingen oder aber er sank zum niederen Adel herab. Dieser und die Ritterschaft verarmten, da zum Beispiel die Bedeutung der Ritter in der Kriegführung aufgrund des steigenden Einsatzes von Feuerwaffen sank und auch ihre Burgen durch das Schwarzpulver einnehmbar wurden. Um die Armut abzuwenden, erfanden auch sie neue Abgaben, Zinsen und Leistungen, die die Bauern abzuliefern hatten. Der niedere Adel lag aber auch mit den Fürsten wegen seiner Unabhängigkeit, die er entweder zu erreichen oder zu wahren versuchte, im Streit und die Geistlichkeit beneidete er um er deren Güter.
Bei der Geistlichkeit muß man zwischen zwei Gruppen differenzieren, nämlich der aristokratischen Klasse, die aus den (Erz-) Bischöfen, Äbten und sonstigen Prälaten bestand und selbst Land, Leibeigene und Hörige besaß und an den Bauern durch die Kirchensteuer oder dem Handel mit Reliquien oder Ablaßbriefen verdiente, und der plebejischen Fraktion, zu der die Wanderprediger auf dem Land gehörten und welche eher arm war und die bei Aufständen der Bauern oft Theoretiker und Ideologen lieferte. Wenn im späteren die Rede vom Volkszorn gegen das Pfaffentum die Rede ist, so bezieht er sich nur auf die erstgenannte Klasse.
Unterhalb all dieser Klassen befand sich der Bauer und war er ein Leibeigener, so war er seinem Herrn, z.B. ein Fürst, Bischof, Kloster, oder eine Stadt, völlig ausgeliefert. Wenn er ein Höriger war, dann waren die gesetzlichen, vertragsmäßigen Abgaben enorm, denn er mußte den größten Teil seiner Zeit auf den Gütern des Herrn arbeiten und von dem was er sonst erwirtschaftete, waren noch Zehnte, Zins, Kriegssteuer, Landessteuer und Reichssteuer abzuführen. Die Gemeindeweiden und Waldungen waren meist ebenfalls im Besitz des Herren, sodass diesem das Jagd- und Holzrecht zustand.
Zusammenfassung: Die Fürsten werden mächtiger, der (niedere) Adel und die Ritterschaft ärmer, sodass diese begehrlich auf die Güter der Kirche schauen. Die Bauern befürchten in zunehmendem Maße Einschränkungen ihrer dörflichen Selbstverwaltung, größere Abhängigkeiten von ihrer Obrigkeit und weitere Erhöhungen ihrer Dienst- und Abgabenleistungen.
II. Vorläufer des großen Bauernkriegs zwischen 1493 und 1517:
Schon vor dem großen Bauernkrieg hatte es immer wieder Aufstände mit ähnlichen Zielen wie 1525 gegeben, wenn auch die Begründung eine andere war, denn bei den früheren Auflehnungen ging es hauptsächlich um das "gute, alte Recht", was es zu bewahren bzw. wiederherzustellen galt. Im Folgenden werde ich die beiden großen Vorläufer des deutschen Bauernkriegs, die diesen auch vorbereiteten, schildern, nämlich den Bundschuh und den Armen Konrad.
1. Der Bundschuh: Der Bundschuh wurde 1493 im Elsaß von Bauern und Plebejern als Geheimbund gegründet und hatte als Ziel, Verjährung von Schulden nach einer bestimmten Zeitspanne (Jubeljahr), Aufhebung der Zölle, Abschaffung der Ohrenbeichte und eigene, selbstgewählte Gerichte für jede Gemeinde. Zunächst wollte man jedoch eine Stadt namens Schlettstadt einnehmen, die Kloster- und Stadtkassen plündern und die Stadt als Hauptsitz für weitere Verschwörungen ausbauen. Das Zeichen des Bundes war ein Bauernschuh mit langen Bindriemen, der Bundschuh.
Der Plan konnte jedoch nicht in die Tat umgesetzt werden, da er vorzeitig verraten wurde und die Behörden die Verschworenen verhaftete. Diejenigen, die entkamen, flohen größtenteils in die Schweiz und nach Süddeutschland und versuchten zum Teil mit Erfolg den Bundschuh weiterleben zu lassen, was man am Bistum Speyer, zu welchem damals auch Bruchsal gehörte, sieht, wo 7000 Verschworene Pläne zur Abschaffung der Leibeigenschaft, Einziehung sämtlicher geistlicher Güter und Anerkennung des Kaisers als alleiniger Herr faßten. Zuerst wollten sie aber (ähnlich wie die Elsässer), Bruchsal erobern, um von dort ein Bundesheer zu organisieren, welches man dann gegen die benachbarten Fürstentümer schicken wollte. Diese Pläne scheiterten jedoch ebenfalls aufgrund eines Verrats, sodass auch hier Verhaftungen mit Hinrichtungen die Folge waren.
Ein gewisser Joß Fritz stellte den oberrheinischen Bundschuh aber wieder her, dessen Anhänger jetzt neben den Bauern auch Handwerksgesellen, Wirte, Landsknechte und sogar manche Adelige waren. Der Bereich der Verschwörung erstreckte sich über das Elsaß, Baden, bis nach Württemberg und an den Main. Die Ziele waren denen der beiden früheren Verschwörungen ähnlich und auch jetzt wollte man eine Stadt als Stützpunkt einnehmen, nämlich Freiburg (im Breisgau). Im Herbst 1513 sollten diese Pläne verwirklicht werden, doch da ein übereilter Versuch der Einnahme gemacht wurde und der Rat der Stadt durch Verrat über die Pläne informiert war, scheiterte auch dieser Aufstand, bevor er richtig begonnen hatte.
Dies war auch der letzte große Plan des Bundschuhs, später gab es noch einige Versuche, die jedoch alle entdeckt und im Keim erstickt wurden.
2. Der Arme Konrad: Nachdem die Verschwörung des Bundschuhs im Bistum Speyer aufgedeckt worden war und seine Mitglieder fliehen mußten, bildete ein Teil von ihnen in Schwaben den Kern eines neuen Bundes, der sich 1503 bildete und den Namen Armer Konrad annahm, da den Mitgliedern die Bezeichnung Bundschuh zu gefährlich schien. Trotzdem stand er in direkter Verbindung mit dem Bundschuh in Baden (Joß Fritz). Allerdings war der Arme Konrad im Gegensatz zum Bundschuh kein Geheimbund, denn er war dem einfachen Volk bekannt. Durch eine Reihe von Hungerjahren und die Erhöhung von Steuern auf Wein, Fleisch und Brot stieg die Zahl der Verbündeten. Schließlich war die Einführung einer Kapitalsteuer von einem Pfennig pro Gulden jährlich Ursache für den Ausbruch der Bewegung. Im Frühjahr 1514 wollten etwa 4000 Bauern die Stadt Schorndorf einnehmen, ließen sich jedoch von den Versprechen des Herzogs Ulrich dazu bewegen, wieder abzuziehen. Dieser versprach die neuen Steuern abzuschaffen und einen Landtag einzuberufen, wo die Beschwerden untersucht werden sollten.
Da die Anführer jedoch vermuteten, dass dies nur eine Finte des Herzoges sei, um Zeit zu gewinnen, um den Aufstand gewaltsam und ohne Zugeständnisse zu beenden, erhöhten sie den Druck auf ihn, sodass Herzog Ulrich den Landtag für den 25. Juni in Stuttgart einberufen mußte. Die Delegierten der Bauern und die Abgeordneten der Städte kamen jedoch schon am 18. Juni zusammen und beschlossen die Räte des Herzoges abzusetzen und die Klöster zu konfiszieren.
Herzog Ulrich reagierte darauf mit einem eigenen Landtag ohne Bauern in Tübingen, wo der Tübinger Vertrag verfaßt wurde, der dem Herzog einige Beschränkungen auferlegte, sonst aber den Bauern keinen Nutzen und vor allem keine Vertretung im Landtag zusicherte. Anschließend stellte er Truppen auf und stellte die Ruhe im Land, welches den Vertrag annehmen mußte, wieder her. Nur im Remstal, dem Gründungsgebiet des Armen Konrads, leisteten die Bauern weiter Widerstand, der sich mit der Zeit jedoch aufgrund von Lebensmittelmangel und zweideutigen Verträgen auflöste. Trotzdem überfiel Herzog Ulrich das Remstal und ließ etwa 1600 Bauern verhaften und 16 sofort enthaupten.
Damit war die Bewegung des Armen Konrads gescheitert.
Zusammenfassung: Es gab also auf deutschem Gebiet schon vor 1525 Bauernaufstände, die jedoch aufgrund von Verrat oder mangelnder Organisation keinen Erfolg hatten. Die Legitimation der Bauern für ihren Aufstand gegen ihre Grundherren lag in der Wiederherstellung des "guten, alten Rechts", was auf dem germanischen Recht gründete und in welchem die Bauern frei waren.
III. Der Adelsaufstand
Der Adel, der seinen Einfluß und seine Macht an die Fürsten verlor, und dessen finanzielle Verhältnisse eher schlechter als besser wurden, versuchte eine Säkularisierung der geistlichen Fürstentümer zu erreichen, um sich an deren Gütern zu bereichern. Ein bedeutender Verfechter dieser Politik war der Ritter Franz von Sickingen, ein begeisterter Anhänger Luthers, der unter der Losung "Evangelium, Freiheit, Gerechtigkeit" den Kampf gegen die "Pfaffenherrschaft" aufnehmen wollte und dessen Ziel es war, das geistliche Kurfürstentum Trier in ein weltliches zu verwandeln und sich selbst eine fürstliche Herrschaft zu errichten. So zog er mit einem Heer 1522 nach Trier, wo er allerdings durch die Truppen des Landgrafen von Hessen und des Kurfürsten von der Pfalz, die dem geistlichen Kurfürsten von Trier zur Hilfe gekommen waren, geschlagen wurde und -vom Adel, der durch diese Aktion der Fürsten eingeschüchtert worden war, im Stich gelassen- tödlich verwundet starb.
Zusammenfassung: Dem Adel gelingt es nicht die geistlichen oder weltlichen Fürstentümer zu stürzen; er wird nach Friedrich Engels Meinung in Zukunft "nur noch im Dienst und unter der Leitung der Fürsten auftreten".
IV. Der Schwäbisch-fränkische Bauernkrieg:
Engels bezeichnet folgendes als Anfang des Bauernkrieges:
Die Bauern aus der Landgrafschaft Stühlingen verweigerten Leistungen an den Landgrafen und zogen unter der Leitung von Hans Müller von Bulgenbach am 24. August 1524 nach Waldshut, wo sie mit den Bürgern eine evangelische Brüderschaft gründeten und von wo sie Boten zum Elsaß, der Mosel, dem ganzen Oberrhein und nach Franken schickten, um weitere Bauern in die Brüderschaft zu bringen. Als Ziel derselben forderten sie die Abschaffung der Feudalherrschaft, die Zerstörung aller Schlösser und Klöster und die Beseitigung aller Herren außer dem Kaiser. Als Bundfahne wählten sie die deutsche Trikolore.
Da dieser Aufstand sich im gesamten badischen Oberland ausbreitete und sich die Truppen des Adels in Italien im Krieg gegen Franz I. befanden, begann der Adel mit der Verzögerungstaktik, die im Kampf gegen die dezentralisierten und unorganisierten Bauern schon bei den früheren Aufständen seine stärkste Waffe gewesen war.
Da die Bauern 3500 Mann zusammengebracht hatten, der Adel aber nur 1700 Mann, welche dazu noch räumlich verstreut waren, zur Verfügung hatte, mußte der Schwäbische Bund, der aus den Fürsten, dem Adel und den Reichsststädten Südwestdeutschlands bestand, einen Waffenstillstand anbieten. Er versprach eine Untersuchung der Beschwerden durch das Landgericht von Stockach. Darauf gingen die Bauern auseinander. Ende Dezember begannen die Verhandlungen vor dem Stockacher Landgericht, welches allerdings nur aus Adligen zusammengesetzt war, wogegen die Bauern protestierten und der Streit von neuem ausbrach. Während sich die Verhandlungen in die Länge zogen, stellte der Schwäbische Bund Truppen auf. Während des Winters, in welchem sämtliche Kampfhandlungen ruhten, schlossen sich immer mehr Bauer im gesamten Gebiet zwischen Donau, Rhein und Lech den Aufständischen an.
Im Februar bildeten sich unter anderen 4 Bauernheere, welche sich "Baltringer Haufen", "Seehaufen", "Unterallgäuer-" und "Oberallgäuer Haufen"nannten. Letzterer verfaßte am 7. März 1525 in Memmingen die "12 Artikel". Alle vier Heere, die insgesamt 30.000 Mann stark waren, nahmen die 12 Memminger Artikel an.
Der Charakter dieser Bauernhaufen war unterschiedlich: Der revolutionäre Teil, der den Ideen Münzers folgte, war überall in der Minderheit, bildete jedoch den Kern und Halt des Aufstands, da die Masse der Bauern immer bereit war, mit dem Adel Kompromisse einzugehen, wenn dieser nur Zugeständnisse in Aussicht stellte. Abgesehen davon hatten die Mehrheit der Bauern keine große Ausdauer, sodass viele, wenn sich die Sache in die Länge zu ziehen begann, nach Hause gingen. Dazu kam noch ihre taktische Unzulänglichkeit und der Mangel an guten Führern. Dies führte dazu, dass sie den organisierten Heeren der Fürsten unterlegen sein mußten, obwohl sie zahlenmäßig durchaus in der Mehrheit sein konnten.
Zu diesem Zeitpunkt aber hatten die Fürsten ihre Heere noch nicht gesammelt, sodass es den Bauern gelang den Schwäbischen Bund in Bedrängnis zu bringen. Denn wenn diese 4 Haufen gegen die Truppen von Truchseß vorgegangen wären, der sich gerade im Kampf gegen den "Schwarzwald-Hegauer Haufen" befand, der von einem Herzog angeführt wurde und dessen Ziele radikaler als die der 12 Artikel war und welcher Stuttgart einnehmen wollte, so hätte Truchseß und mit ihm der Schwäbische Bund verloren.
Da Truchseß jedoch den Charakter der Bauernheere kannte, gelang es ihm mit den 4 Haufen einen Waffenstillstand abzuschließen und einen Termin (der 2. April 1525, Sonntag Judika) festzusetzen, an welchem die Forderungen verhandelt werden sollten. Danach konnte er gegen den Schwarzwald-Hegauer Haufen vorgehen und Stuttgart zurückerobern. Anschließend zog er nach Ulm, um dort Verstärkung zu sammeln.
Der Schwäbische Bund, der nun wieder handlungsfähig war, stellte sofort Truppen zusammen, um gegen die Bauer trotz des Waffenstillstandvertrags vorzugehen. Bevor die Bauern ihre Forderungen, die 12 Artikel, den berufenen Schiedsrichtern vorlegen konnten, erfuhren sie von dem Vertragsbruch der Gegenseite und dem Herannahen der Truppen. Darauf nahmen sie neben den "12 Artikeln" noch den "Artikelbrief" in ihr Programm auf, der alle Bauernschaften aufforderte, in die "christliche Vereinigung und Brüderschaft" einzutreten, um alle geistlichen Güter zu konfiszieren, die Kleinodien zur Aufbesserung der Kriegskasse zu verkaufen und alle Schlösser zu verbrennen. Danach beschlossen sie in einer Generalversammlung ihre vier Haufen neu zu organisieren, sodass der Sonntag Judika, der ursprünglich der Tag des Friedensschlusses werden sollte, von Engels als Datum der "allgemeinen Erhebung" bezeichnet wird, da am 2 April 1525 auch in den Gegenden im Odenwald, in Unter- und Mittelfranken, in Württemberg und am Neckar das Zeichen zum Aufstand, also der Zerstörung von Schlössern und Klöstern, gegeben wurde.
Anmerkung: Friedrich Engels schildert nun detailliert die Bewegungen von jedem einzelnem Haufen, ich werde nur beispielhaft die wichtigsten Züge nennen.
In Franken vereinigten sich die Neckartaler, geführt von Jäcklein Rohrbach, und das Bildhäuser Bauernlager, geführt von Georg Metzler und einem Adligen namens Wendel Hipler, der laut "dtv-Atlas zur Weltgeschichte" die 12 Artikel verfaßte, zum "hellen Haufen" und organisierten Streifzüge gegen Schlösser und Klöster. Der helle Haufen war 8000 Mann stark und mit Kanonen und 3000 Handbüchsen ausgerüstet. Der Ritter Florian Geyer, den unser Geschichtsbuch (8.Klasse) als "politisch herausragenden Führer" bezeichnet, schloß sich diesem Bauernheer freiwillig an und bildete die "Schwarze Schar", die laut Engels ein "Elitekorps" war.
Der helle Haufen zog zum Schloß des württembergischen Grafen von Helfenstein, da dieser alle Bauern in seinem Gebiet töten ließ. Florian Geyer stürmte das Schloß und der Rest eroberte nach langem Kampf die dazugehörige Stadt Weinsberg. Jäcklein Rohrbach saß am 17. April 1525 über dem gefangenen Graf und seinen Rittern Gericht und ließ sie anschließend durch die Spieße der Bauern jagen, was unser Geschichtsbuch (8.Klasse) als "Ausnahme" bezeichnet. Die Einnahme von Weinsberg und die Hinrichtung von Graf Ludwig veranlaßten die Grafen von Löwenstein der Bauernverbindung beizutreten und die Grafen von Hohenlohe den Bauern Geschütze und Pulver zu liefern.
Anschließend beschlossen die Führer des hellen Haufens Götz von Berlichingen zum Hauptmann zu nehmen (bzw. ihn dazu zu zwingen, da dieser zu diesem Zeitpunkt noch nichts davon wußte), weil dieser noch mehr Adel zu ihnen bringen könnte.
Daraufhin trennte sich Florian Geyer mit seiner schwarzen Schar vom hellen Haufen und durchstreifte die Neckargegend, wo er Schlösser und Niederlassungen der Geistlichkeit ("Pfaffennester") zerstörte.
Der Rest des hellen Haufens zog zunächst zur mächtigen und freien Reichsstadt Heilbronn, welche Georg Metzler und Jäcklein Rohrbach noch am selben Tag (also der 17. April) in Besitz nahmen. Heilbronn sollte das Zentrum der Bauernbewegung werden, welches die einzelnen Haufen koordinieren und zu welchem auch Delegierte geschickt werden sollte, wozu es jedoch nie richtig kam. Die Bauern zogen nach Hinterlassen einer kleineren Besatzung schon am 22. April zum Odenwald, wo ihnen zwei Tage später Götz von Berlichingen beitreten und das Oberkommando über den hellen Haufen übernehmen mußte.
Georg Metzler und Götz von Berlichingen zogen nun in die Gegend von Mainz, wo sie die Schlösser des Adel, wenn er sich ihnen anschloß, verschonten und nur die Klöster zerstörten. Nach Engels Meinung waren allerdings die "energischsten Leute" fort, denn nach Florian Geyer hatte auch Jäcklein Rohrbach, der über den Grafen Ludwig Gericht gesessen hatte, den hellen Haufen verlassen, da dieser genauso wie Geyer nicht bei einem Haufen bleiben wollte, der mit dem Adel eine Verständigung suchte. Diese Suche nach Verständigung wertet Engels als "Zeichen von Demoralisation". Die Versuche Wendel Hiplers die Kampfstärke zu verbessern, indem man Landsknechte anwerben sollte, wurden von der Gemeindeversammlung verworfen, da sie die Beute der Plünderungen nicht teilen wollte.
" In der Pfalz hatten sich auf beiden Rheinufern gegen Ende April Bauernhaufen gebildet. Sie zerstörten viele Schl ößer und Klöster und nahmen am 1. Mai Neustadt a.d. Haardt, nachdem die herübergekommenen Bruchrainer schon tags vorher Speyer zu einem Vertrag gezwungen hatten. Der Marschall von Habern konnte mit den wenigen kurfürstlichen Truppen nichts gegen sie ausrichten, und am 10. Mai muß te der Kurfürst mit den insurgierten Bauern einen Vertrag abschließ en, in welchem er ihnen Abstellung ihrer Beschwerden auf einem Landtag garantierte."
Ein anderes Beispiel für die Bauernaufstände ist der "helle christliche Haufen", an dessen Spitze Matern Feuerbacher, Ratsherr von Bottwar, stand. Dieser Führer war sehr gemäßigt, verhinderte die Vollziehung des Artikelbriefes an den Schlössern und versuchte zwischen den Bauern und der gemäßigten Bürgerschaft zu vermitteln. Als sich jedoch Jäcklein Rohrbach am 22. April mit 200 Mann mit dem hellen christlichen Haufen vereinigte, mußte Feuerbacher Jäcklein Rohrbach die Führung des gemeinsamen Haufens überlassen. Nun zog das 6000 Mann starke Bauernheer nach Stuttgart und konnte es, da der Rat der Stadt größtenteils geflohen war und ein Bürgerausschuß an die Spitz der Verwaltung gesetzt hatte, von welchem der revolutionäre Teil die Tore öffnete, besetzen. Hier konnte sich der helle christliche Haufen organisieren, Beute verteilen, Verpflegung aufnehmen und Regeln festsetzen. Anschließend zog der gesamte Haufen am 29 April 1525 nach Schorndorf und von dort nach Kirchheim unter Teck, wo er lagerte, da er benachrichtigt worden war, das Truchseß mit seinen Truppen nahte.
Truchseß, der nach Ulm gezogen war, um Verstärkung für den Kampf gegen die Bauern zu bekommen, mußte einige Zeit warten, da weitere Truppen aufgrund von Geldmangel seitens der Regierungen oder der nur wenig vorhanden Truppen im Land, die dazu noch zur Befestigung der Schlosser unentbehrlich waren, nur schwer zu bekommen waren. Schließlich hatte er 10.000 Mann zusammen und von dieser Armee hing das Bestehen des Schwäbischen Bundes ab.
Truchseß wandte sich zuerst gegen den Baltringer Haufen, der sich darauf hin in die Wälder der Schwäbischen Alb flüchtete, wo ihn Truchseß nicht weiter verfolgte, da er dort die Reiterei und die Geschütze nicht einsetzen konnte. Statt dessen zog er gegen den 5000 Mann starken Leipheimer Haufen, welcher sich in gleichnamiger Stadt befand und dort Klöster und Schlösser zerstörte und sich vorbereitete nach Ulm zu ziehen. Dessen Führer Jakob Wehe versuchte noch mit Truchseß zu verhandeln, doch dieser griff am 4. April 1525 an, vernichtete den Leipheimer Haufen vollständig und lies Jakob Wehe neben 3 anderen Bauernfühern köpfen.
(Nach Engels ist diese Vorgehensweise von Truchseß Grund für die "Erbitterung" der Bauern und deren Behandlung von Graf Ludwig von Helfenstein am 17 April) Danach zog er wiederum gegen den Baltringer Haufen, der in die Herrschaften Waldburg, Zeil und Wolfegg eingedrungen war und dort die Schlösser belagerte. Truchseß konnte ihn, da er zersplittert war, am 11. April in Einzelgefechten schlagen, sodass sich auch dieser Haufen vollständig auflöste. Als er gegen den Seehaufen ziehen wollte, bestand dieser 10.000 starke Haufen jedoch das Gefecht. Als Truchseß hörte, dass auch noch der Allgäuer und Hegauer Haufen im Anmarsch waren, beschloß er am 17. April einen Vertrag mit diesen Bauernheeren zu schließen, den die Führer der Heere auch annahmen. Dieser Zug von Truchseß rettete ihn laut Engels, da er sonst mit seiner vergleichsweise kleinen Armee zwischen den drei Haufen, die zusammen 25.000 bis 30.000 Mann stark waren, verloren gewesen wäre. So jedoch konnte er nach Württemberg ziehen, wo sich der helle christliche Haufen, jetzt wieder unter der Führung von Matern Feuerbacher, von Kirchheim unter Teck nach Böblingen gezogen war und inzwischen noch bedeutenden Zulauf aus der Region bekommen hatte. Als Truchseß die Stärke des Bauernheeres erkannte, schloß er wiederum einen Waffenstillstand mit den Bauern, überfiel sie jedoch trotzdem am 12. Mai und zwang sie zu einer Endscheidungsschlacht, die sie teils mangelnder Disziplin, aber auch durch Verrat der Böblinger Bürgerschaft verloren. Feuerbacher konnte fliehen, Jäcklein wurde auf grausame Weise umgebracht. Nach dieser Böblinger Niederlage breitete sich unter den Aufständischen im ganzen Gebiet Angst aus und die Reichsstädte, die von den Bauern bedrängt worden waren, atmeten erleichtert auf. So suchte zum Beispiel Heilbronn als erste Stadt die Versöhnung mit dem Schwäbischen Bund. Und während die Bauern in Heilbronn mit Wendel Hipler über eine Reichsreform debattierten, schickten die Bürgerschaft und die patrizischen Familien Boten zu Truchseß, um wegen der Übergabe der Stadt zu verhandeln. Durch diesen Verrat, mußte Wendel Hipler mit den Bauern aus Heilbronn nach Würzburg fliehen. Anschließend errang Truchseß ein Sieg über die Bauern nach dem anderen. Oft wurden die Bauern von ihren Verbündeten wie zum Beispiel manchen Städten verraten oder fehlinformiert, was sie dann in Angst und Schrecken versetzte, sodass sie auseinanderliefen und dann einzeln von der Reiterei von den Heeren von Truchseß niedergemacht werden konnten. Abgesehen davon sank die Moral in den einzelnen, schlecht geführten Bauernhaufen, sodass immer mehr Bauern die Heere verließen, um nach Hause zurückzukehren.
In Würzburg zum Beispiel, wo sich 5000 Bauern befanden, öffnete der Rat der Stadt am 7. Juni nach heimlicher Absprache mit Truchseß die Tore, sodass dieser ohne Gegenwehr einmarschieren, den letzten fränkischen Bauernhaufen entwaffnen und sämtliche Führer gefangen nehmen konnte. Bei dem Allgäuer Haufen, der sich am längsten hielt, entschied ebenfalls Verrat am Ende die Schlacht, weil sich einige Hauptleute und Geschützmeister von Truchseß kaufen ließen, um anschließend den Pulvervorrat zu verbrennen und den Bauernhaufen, strategisch in eine solche Lage zu bringen, dass er von Truchseß besiegt werden konnte. Als sich dann ein Teil der versprengten Truppenteile der Bauern wieder sammelte und verschanzte, ließ Truchseß fast 200 Dörfer in der Umgebung niederbrennen und schnitt ihnen den Nachschub ab, sodass die Bauern im Angesicht ihrer brennenden Häuser und vor Hunger kapitulierten.
Mit der Niederlage des Allgäuer Haufens war laut Engels der Schwäbisch-fränkische Bauernkrieg beendet.
Zusammenfassung: Der deutsche Bauernkrieg begann am 14 August 1524. Wichtige Bauernführer waren Wendel Hipler, Florian Geyer, Georg Metzler, Jäcklein Rohrbach und Götz von Berlichingen. Diese alle führten Bauernheere, die sehr unterschiedlich ausgerüstet und jeweils von 5000 bis 15.000 Mann stark waren. Der Schwäbische Bund war durch das Heer von Truchseß Waldburg vertreten, der maßgeblich die Niederschlagung der schwäbischen und fränkischen Aufstände bewerkstelligte.
V. Der thüringische, elsässische und österreichische Bauernkrieg:
Dieser verlief in Prinzip ähnlich wie der oben geschilderte, jedoch in kleineren Dimensionen. Außerdem war Thomas Münzer an der Organisation beteiligt, der nach den ersten Aufständen in Schwaben nach Thüringen geeilt war, wo er in der freien Reichstadt Mühlhausen seine Zentrale errichtete.
Überall in Thüringen, Hessen, Sachsen und in der Harzgegend fanden sich seine Anhänger. Am 17 März 1525 fand in Mühlhausen eine Revolution statt, in der der Stadtrat abgesetzt und die Regierung in die Hände eines neugewählten "ewigen " Rats gelegt wurde, dessen Vorsitz Thomas Münzer inne hatte. Nach diesem Ereignis schlossen sich die Bauern in den eben genannten Gebieten zu Haufen zusammen und verbrannten Schlösser und Klöster. Münzer wurde im großen und ganzen als Führer der gesamten Bewegung anerkannt. Ende April, als sich die Fürsten von ihrer anfänglichen Ratlosigkeit erholt hatten, gelang es dem Landgrafen Philipp die größten Teile des Gebietes wieder in seine Gewalt zu bringen und zog dann nach Mühlhausen, wo Münzer etwa 8000 Mann beisammen hatte. Nach der Taktik von Truchseß schloß auch Philipp einen Waffenstillstand, den auch er nicht hielt, sodass er Mühlhausen einnehmen konnte. Münzer wurde im Alter von etwa 28 Jahren hingerichtet. Mühlhausen verlor seine Reichsfreiheit und wurde den sächsischen Ländern untergeordnet.
Im Elsaß brach der Aufstand später los als auf der rechten Rheinseite (18. April erste Klosterplünderung), doch wurde er hier von den Franzosen, die eine Restauration der Adelsherrschaft vollzogen, schnell beendet.
Auch die Bauernaufstände in den österreichischen Alpenländern, im Bistum Salzburg, in der Steiermark, Oberösterreich, Kärnten und Krain, die zum Teil auch Verträge abtrotzen konnten, welche allerdings nie lange von der Obrigkeit eingehalten wurden, scheiterten allesamt.
VI. Folgen des Bauernkriegs:
Damit war der Bauernkrieg im Prinzip beendet, bleiben aber noch die Folgen zu klären: Die Bauern wurden wieder unter die Botmäßigkeit ihrer geistlichen, adligen oder patrizischen Herren gebracht. Kurzzeitig verschlimmerte sich die Lage der Bauern, da sie meist die Brandschatzungen bezahlen mußten, langfristig änderte sie sich nicht, obgleich sich eine Menge Höriger in die Leibeigenschaft fügen mußten und mache wohlhabenderen Mittelbauern ruiniert waren. Nach Engels jedoch schadeten die Religionskriege und letztlich der Dreißigjährige Krieg der Bevölkerung weit mehr.
Die meisten Nachteile durch den Bauernkrieg hatte die Geistlichkeit, denn sie hatte sich am wenigsten zur Wehr setzen können und die anderen Stände hatten von der gewaltsamen Säkularisierung nur profitiert, sodass diese an einer Beibehaltung der jetzigen Lage interessiert waren. Das Ansehen des Adels war ebenfalls beschädigt worden, da er nur durch die Truppen der Fürsten gerettet worden war. Diese (die Fürsten) bezeichnet Engels als eigentliche Gewinner des Bauernkrieges, da ihr Einfluß gestiegen und auf längere Zeit gesichert war.
VII. Einfluß der Reformation auf den Bauernkrieg:
Bisher habe ich den Einfluß von Martin Luther und Thomas Münzer auf den Bauernkrieg vernachlässigt:
Wie schon eingangs erwähnt, fanden die Vorläufer unter einer anderen Legitimation bzw. Begründung seitens der Bauern statt als der große Bauernkrieg selbst. Bei den früheren Aufständen wollten sich die Bauern gegen eine Verschlimmerung ihrer Lage oder gegen die Leibeigenschaft wehren, indem sie sich auf das "gute, alte Recht" beriefen (entweder das Recht, wie es vor einer Verschlimmerung der Lage wie zum Beispiel eine Abgabenerhöhung bestand hatte, oder das Recht wie es bei den Germanen galt, als die Bauern frei und den Adligen nur zur Gefolgschaft verpflichtet waren).
Eine Vielzahl der im großen Bauernkrieg erhobenen Forderungen war also schon vor Martin Luther existent. Diesmal jedoch war die Begründung neu, denn jetzt ging es den Bauern und ihren Führern, unter welchen sich viele Theologen (vgl. I) befanden, um die Wiederherstellung des göttlichen Rechts, was sich auch in ihren 12 Artikeln widerspiegelt, in welchen sie die Aufhebung der Leibeigenschaft, Zuständigkeit der bäuerlichen Gemeinde für Gericht und Verwaltung und auch für die Ein- und Absetzung des Pfarrers, und schließlich die Verfügung über den Zehnten für die Besoldung des Pfarrers und die Armenfürsorge fordern. Dass sich auf die Bibel beziehen, wird im 12. Artikel deutlich, in welchem sie sagen, dass sie von den Artikeln abstand nehmen wollen, bei welchen man ihnen anhand der Heiligen Schrift nachweisen könne, dass sie wider Gottes Willen sind. Insbesondere bei der Abschaffung der Leibeigenschaft beziehen sich viele auf die Veröffentlichung Martin Luthers "Von der Freiheit eines Christenmenschen".
Martin Luther allerdings war die Art, wie man politische und soziale Forderungen aus der Bibel ableitete ein "Greuel", denn seiner Meinung nach könne jeder Mensch christlich frei sein, unabhängig davon ob er sich im Zustand der Leibeigenschaft oder der Gefangenschaft befindet, also die äußere Freiheit besitzt. Für ihn wurde mit den 12 Artikeln das Evangelium "fleischlich" mißverstanden. Trotzdem forderte er in seiner Schrift "Vermahnung zum Frieden" beide Seiten zu einem Kompromiß auf. Als er jedoch vom gewalttätigen Vorgehen der Bauern, vor allem im Umkreis von Thomas Münzer, hörte, bestärkte dies ihn in seiner Meinung, dass bei der menschlichen Tücke und Bosheit das Reich Gottes, welches Thomas Münzer immer zu errichten versuchte, nicht ohne ein "strafendes Schwert" auf Erden errichtet werden könne. Deshalb habe Gott ein "weltliches Regiment" errichtet, um das Zusammenleben der Menschen zu gewährleisten. Dieser Obrigkeit sei jedermann Gehorsam schuldig, selbst wenn diese einmal ihre Macht ungerecht ausüben sollte. Widerstand dürfe man höchstens mit Worten, nie aber mit Gewalt leisten. Da die Bauern dagegen jedoch eindeutig verstoßen hatten, ergriff Luther in seiner Schrift "Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern" eindeutig Partei für das Vorgehen der Fürsten.
Diese Obrigkeitslehre Luthers, die sich auf Römer 13,1 stützt ("es ist keine Obrigkeit, die nicht von Gott verordnet ist") wird von unserem Geschichtsbuch der Oberstufe für die "Schwierigkeiten der Deutschen auf dem Weg zur Demokratie mitverantwortlich gemacht". Die Bedeutung der Reformation auf den Bauernkrieg schätzt es aufgrund der früheren Bauernaufstände eher gering ein.
Um noch kurz auf Thomas Münzer zu sprechen zu kommen, der von Luther als Erzteufel von Mühlhausen (von wo er die Bauernaufstände in Thüringen und Umgebung leitete, vgl. V) bezeichnet wurde:
Münzer war ein Revolutionär, der die Möglichkeit gesehen hatte, seine Vorstellungen zur Errichtung eines neuen Gottesreiches auf Erden zu verwirklichen, indem die bestehende Adels- und Fürstengewalt beseitigt, alle Besitz- und Rangunterschiede aufgehoben werden sollten. Dann könne der wahre Glauben das Gottesreich auf Erden verwirklichen und alle Menschen in Gleichheit und Brüderlichkeit zusammenleben. Wer sich diesem allerdings widersetzte sollte als Gegner der wahren Gottesherrschaft vernichtet werden.
So gesehen war die Welt für ihn zweigeteilt in Auserwählte, die den rechten Glauben haben und in Gottlose, die es zu bekämpfen galt. Zu diesen zählten z.B. die Fürsten, da sie dem Volk keine Gelegenheit gaben, lesen zu lernen und damit zum rechten Glauben zu finden. Jedoch wurde Thomas Münzer schon im Alter von 28 Jahren (die Lebenserwartung war im Mittelalter allerdings auch geringer), nach der Einnahme von Mühlhausen durch fürstliche Truppen (vgl. oben) gefoltert und hingerichtet.
VIII. Quellenkritik:
Da sich die Teile I bis VI des Referats eng an die Schrift "Der deutsche Bauernkrieg" von Friedrich Engels anlehnt, werde ich diese näher erklären: Engels, der mit Karl Marx 1848 das "Kommunistische Manifest" verfaßte und damit dem linken politischen Bereich zuzuordnen ist, dürfte die deskriptive Schrift über den Bauernkrieg, eine Sekundärquelle, die nun selbst ein historisches Dokument geworden ist, aus Gründen der Tradition verfaßt haben, da er größtenteils kritisch und im gesamten glaubwürdig berichtet. Die groben Abläufe lassen sich in den unten erwähnten Quellen nachprüfen.
Dennoch ergeben sich geringe Widersprüche:
Unser Geschichtsbuch 8.Klasse sagt, dass es eine Ausnahme war "wenn -wie zu Ostern 1525 in Weinsberg- die adligen Herren durch die Spieße der Bauern des OdenwÄlder Haufens gejagt wurden"(s.176). Sowohl bei Engels als auch in den Karten von Wilhelm Zimmermann kommt der "Odenwälder Haufen" jedoch gar nicht vor. Statt dessen ist vom "hellen Haufen" die Rede, was mir glaubwürdiger erscheint.
Was aber die (wirtschaftliche) Lage der Bauern vor dem Aufstand angeht, so läßt Engels diese undifferenziert in einem sehr düsteren Licht erscheinen. Das Geschichtsbuch 8. Klasse ist der Meinung, dass "die wirtschaftliche Situation auf dem Lande äußerst verschieden war", denn "Bilder und Darstellungen aus dieser Zeit berichten von Schlemmereien auf Bauernhochzeiten, von Wohlleben und teuerer Kleidung mancher Bauern", jedoch gäbe es "auch viele zeitgenössische Zeugnisse bitterster Armut, Eintönigkeit der täglichen Speise, ja des Hungerleidens von Bauern anderswo"(s.176).
Der dtv-Atlas zur Weltgeschichte meint dazu: "Durch sicheren Absatz ihrer Produkte wohlhabend und infolge der Landsknechts-Taktik wieder wehrhaft und selbstbewußt geworden, wehren sich die Bauern... gegen den Geld- und Frondruck verarmter Grundherren" Diese doch recht positiv beschriebene Lage der Bauern erscheint mir etwas übertrieben, sodass ich für mich die Aussage des Geschichtsbuchs übernommen habe.
IX Quellenangaben:
Zur Quelle/ den Quellen: Das Referat ergibt sich, wie oben schön erwähnt, größtenteils aus der Schrift "Der deutsche Bauernkrieg" von Friedrich Engels, welche von der Internetseite www.felix2.f2s.com///deutsch/html index kostenlos heruntergeladen werden kann. Des weiteren habe ich unser Geschichtsbuch der 8.Klasse ("Geschichte und Geschehen 8", Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1988) und der 11.Klasse ("Geschichte und Geschehen I Oberstufe, Ausgabe A, Ernst Klett Schulbuchverlag, Leipzig 1997) benutzt, um zu ergänzen oder zu strukturieren.
Außerdem liefert (der "dtv- Atlas zur Weltgeschichte Band 1 von den Anfängen bis zur Französischen Revolution", Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1964) eine Karte und die wichtigsten Daten. "Der grosse Deutsche Bauernkrieg" von Wilhelm Zimmermann, Dietz Verlag, Berlin 1982 half bei der Klärung mir unklarer Abläufe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments "Übersicht:"?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Deutschen Bauernkrieg. Es behandelt die ökonomische und soziale Lage Deutschlands im 14. und 15. Jahrhundert, die Vorläufer des Bauernkriegs, den Adelsaufstand, den Schwäbisch-fränkischen Bauernkrieg, den Thüringischen, Elsässischen und Österreichischen Bauernkrieg, die Folgen des Krieges, den Einfluss der Reformation, Quellenkritik und Quellenangaben.
Welche Themen werden im Abschnitt über die ökonomische Lage und den sozialen Schichtbau Deutschlands behandelt?
Dieser Abschnitt analysiert den Aufschwung des deutschen Gewerbes und Handels, die unterschiedliche Teilhabe der Bevölkerung an dieser Entwicklung, das Entstehen fast unabhängiger Fürstentümer, die Situation des mittleren und niederen Adels, die Differenzierung innerhalb der Geistlichkeit und die Lage der Bauern, insbesondere Leibeigener und Höriger.
Was waren die Vorläufer des großen Bauernkriegs, die im Dokument beschrieben werden?
Das Dokument beschreibt den Bundschuh und den Armen Konrad als wichtige Vorläufer des Bauernkriegs. Es erläutert ihre Ziele, Organisation und das Scheitern ihrer jeweiligen Aufstände.
Was wird über den Adelsaufstand berichtet?
Der Text beschreibt den Versuch des Adels unter Führung von Franz von Sickingen, die geistlichen Fürstentümer zu säkularisieren und sich an deren Gütern zu bereichern. Der Aufstand scheiterte und Sickingen starb tödlich verwundet.
Welche Schwerpunkte werden im Abschnitt über den Schwäbisch-fränkischen Bauernkrieg gesetzt?
Dieser Abschnitt behandelt den Beginn des Bauernkriegs mit dem Aufstand in Stühlingen, die Rolle von Hans Müller von Bulgenbach, die Bildung verschiedener Bauernheere (Baltringer Haufen, Seehaufen, Unterallgäuer Haufen, Oberallgäuer Haufen), die Verfassung der "12 Artikel von Memmingen", die Rolle von Jäcklein Rohrbach, Florian Geyer und Götz von Berlichingen. Außerdem die Rolle des Heerführers Truchseß von Waldburg bei der Niederschlagung der Aufstände.
Was wird über den Thüringischen, Elsässischen und Österreichischen Bauernkrieg gesagt?
Der Text beschreibt diese Aufstände als ähnlich, aber kleiner als der Schwäbisch-fränkische Bauernkrieg. Erwähnt wird die Rolle von Thomas Münzer in Thüringen und das Scheitern der Aufstände in den genannten Regionen.
Welche Folgen des Bauernkriegs werden im Dokument analysiert?
Das Dokument analysiert die Wiederherstellung der Botmäßigkeit der Bauern, die kurzfristige Verschlimmerung ihrer Lage, die langfristige Stagnation, die Profite der anderen Stände (insbesondere durch die Säkularisierung von Kirchengütern) und die gestiegene Macht der Fürsten.
Welchen Einfluss hatte die Reformation auf den Bauernkrieg?
Der Text analysiert den Einfluss von Martin Luther und Thomas Münzer. Er beleuchtet die unterschiedlichen Begründungen für die Forderungen der Bauern (göttliches Recht vs. "gutes, altes Recht"). Außerdem Luthers Obrigkeitslehre und seine Ablehnung der Gewalt.
Welche Quellen werden im Dokument zur Quellenkritik genannt?
Das Dokument bezieht sich kritisch auf Friedrich Engels' "Der deutsche Bauernkrieg", unser Geschichtsbuch der 8.Klasse ("Geschichte und Geschehen 8", Ernst Klett Schulbuchverlag, Stuttgart 1988) und der 11.Klasse ("Geschichte und Geschehen I Oberstufe, Ausgabe A, Ernst Klett Schulbuchverlag, Leipzig 1997), der "dtv- Atlas zur Weltgeschichte Band 1 von den Anfängen bis zur Französischen Revolution", Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1964 und "Der grosse Deutsche Bauernkrieg" von Wilhelm Zimmermann, Dietz Verlag, Berlin 1982.
Welche zentralen Bauernführer werden im Text genannt?
Zu den Bauernführern gehören Hans Müller von Bulgenbach, Jäcklein Rohrbach, Florian Geyer, Georg Metzler, Wendel Hipler und Thomas Münzer.
- Citar trabajo
- Jan Christoph (Autor), 2001, Der deutsche Bauernkrieg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100200