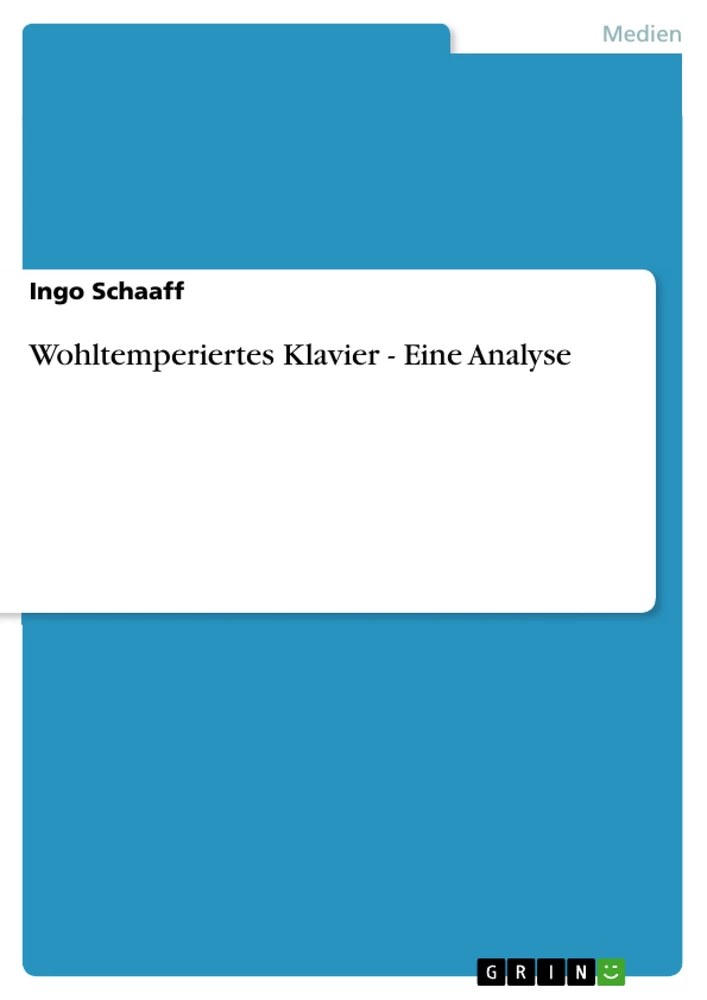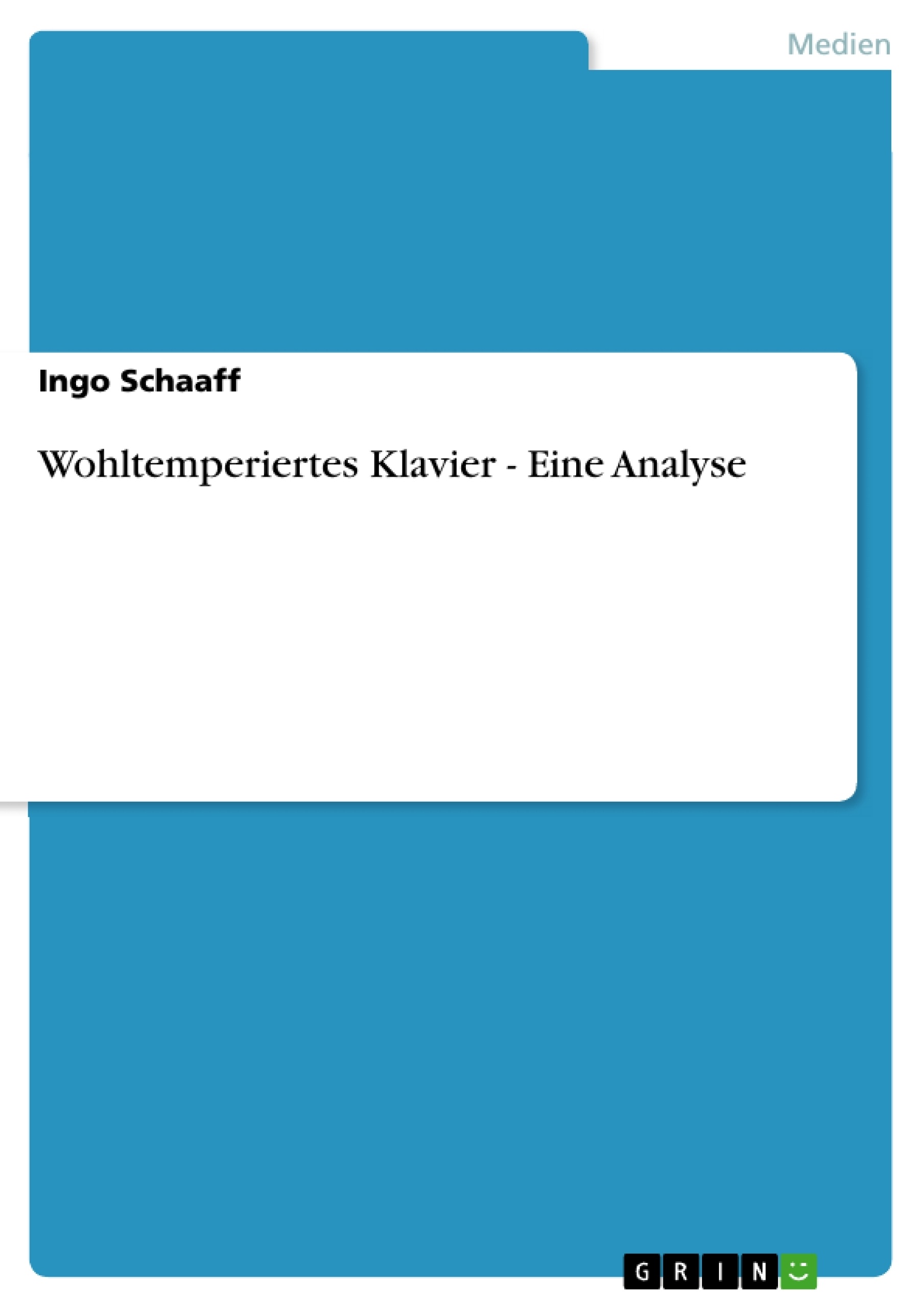Entdecken Sie die verborgene Architektur einer musikalischen Meisterleistung! Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Johann Sebastian Bachs "Fuga II" (BWV 871) aus dem "Wohltemperierten Klavier, II", ein Werk, das auf den ersten Blick von schlichter Eleganz geprägt scheint, doch bei näherer Betrachtung ein Universum musikalischer Innovation und satztechnischer Finesse offenbart. Diese detaillierte Analyse entschlüsselt die Geheimnisse dieser vierstimmigen Fuge in C-Moll, indem sie das unscheinbare, aber wirkungsvolle Thema, seine kunstvollen Variationen und die überraschenden Wendungen in Bachs Kompositionsstil beleuchtet. Verfolgen Sie, wie Bach aus einem einzigen, absteigenden Motiv ein komplexes Netz von Engführungen, Augmentationen und Umkehrungen spinnt, die das Stück zu einem Höhepunkt führen, der seine bescheidenen Anfänge weit übertrifft. Ergründen Sie die Bedeutung der melodischen Kadenzen, die den musikalischen Fluss strukturieren und gleichzeitig dramatische Spannungen erzeugen, und erleben Sie, wie die ungewöhnliche dreistimmige Textur bis zum späten Eintritt der vierten Stimme eine einzigartige Klangfarbe erzeugt. Diese tiefgehende Untersuchung enthüllt, wie Bach die traditionellen Fugenregeln auf meisterhafte Weise interpretiert und erweitert, um ein Werk von außergewöhnlicher Tiefe und Ausdruckskraft zu schaffen, das sowohl Kenner als auch Liebhaber klassischer Musik in seinen Bann zieht. Erfahren Sie, wie die scheinbare Einfachheit des Themas durch Bachs kompositorische Kunstfertigkeit zu einer erstaunlichen musikalischen Reise transformiert wird, und gewinnen Sie ein neues Verständnis für die Genialität des "Meisters der Fuge". Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die Analyse klassischer Musik, die Faszination der Barockmusik und die unsterbliche Kunst von Johann Sebastian Bach interessieren.
Wohltemperiertes Klavier - Eine Analyse
Analyse des Musikstücks ,,Fuga II" (BWV 871)
Das Musikstück ,,Fuga II" (BWV 871) von Johann Sebastian Bach (1685 -1750) aus seinem Werk ,,Das Wohltemperierte Klavier, II" ist eine vierstimmige Fuge in C-Moll für Klavier und umfasst 28 Takte. Es wurde 1738 geschrieben und ist der zweite Teil (es folgt auf das Präludium) des zweiten Stückes.
Das Thema ist ruhig, fließend und besitzt den Ambitus von einer Quinte. Hinter ihm verbirgt sich eine ganz schlichte absteigende Linie von der Quinte zur Terz (s. Blatt). Es kommt zum ersten mal im Alt vor. Rhythmisch wird das Thema durch Achtel geprägt gefolgt von einer kurzen Sechzehntel Bewegung. Motivischen Charakter besitzt die Figur bestehend aus einer Achtel, zwei Sechzehntel und einer Viertel, die im Verlauf des Stückes oft gekürzt wird. Variiert werden an diesem Thema meist die ersten drei Achtel, wie beim Comes, bei dem die erste und die dritte Achtel die gleiche Tonhöhe besitzen und der Quintsprung von der Vierten auf die Fünfte Achtel, bei dem die Sprunghöhe auch oft variiert.
Der Kontrapunkt wird außer in Takt 2 und Takt 4 nicht mehr aufgegriffen und erhält somit keine charakteristische Bedeutung für das Stück. Man kann hier also nicht direkt von einem Kontrasubjekt sprechen. Der Kontrapunkt ist tonleitergebunden und hat, genau wie das Thema, den Ambitus von einer Quinte und besteht aus Achteln und Vierteln. Thema und Kontrapunkt ergänzen sich in Terzparallelen (Takt 2/ Zählzeit 3,4 und Takt 3/ Zählzeit 1).
Der Comes entspricht einer tonalen Beantwortung, da das Intervall zwischen der ersten und der zweiten Achtel nur noch eine Sekunde anstatt einer Terz beträgt. Charakteristisch für den Comes ist, dass die erste und die dritte Achtel die gleiche Tonhöhe besitzen.
Der Dux beginnt im Alt auf der ersten Stufe. Der Comes folgt im Sopran auf der fünften Stufe. Dadurch ergibt sich eine Tonika-Dominant Spannung. Da der Comes in die Dominanttonart moduliert ist eine Rückmodulation eingefügt bevor der Tenor in Takt 5 auf der ersten Zählzeit die Exposition beendet. Auch der Tenor spielt das Thema aufgrund der Rückmodulation wieder auf der ersten Stufe.
Die einzelnen Durchführungsteile variieren von der Länge her zwischen 2 und 5 Takten. Es fällt auf, dass nach der Exposition, der zweite Durchführungsteil sehr kurz ist (zwei Takte). Die Länge der Durchführungsteile steigt bis zum vierten Durchführungsteil, der ersten Engführung (fünf Takte), und wird danach wieder kürzer, bis sie beim sechsten Durchführungsteil, der Coda, nur noch drei Takte umfasst.
Besonders deutlich wird in Ende Takt 13 und Takt 23 mit melodischen Kadenzen gegliedert. In Takt 13 Ende führt Bach mit der Kadenz zur Dominanten G zum Anfangston der drei folgenden Themeneinsätze. Da die Grundtonart C-Moll ist, baut die Kadenz zur Dominante G eine Dominantspannung auf, die in den folgenden Verarbeitungen des Themas abgebaut wird. Bach bereitet diese Kadenz in Takt 13 durch Modulation vor. Hier wird der zweite Teil, der in Takt 14 gleich mit einer Engführung beginnt, sowohl vorbereitet als auch akustisch vom ersten Teil gegliedert.
Auch die Kadenz in Takt 23 wird durch Modulation vorbereitet. Sie leitet vom 5. Durchführungsteil, der in der Dominanten G-Dur endet, in die Coda über. Während die erstgenannte Kadenz den dritten vom vierten Durchführungsteil trennt, und gleichzeitig auch die Engführungen vorbereitet, die direkt nach der Kadenz beginnen, trennt die Kadenz zur Tonika den fünften Durchführungsteil von der Coda.
Abgesehen von der Exposition und der Coda, die ja Anfang und Ende bezeichnen, stehen also je 2 Durchführungsteile zusammen (Exposition - 2.&3. - 4.&5. - Coda) :
Nach der Exposition folgt das längste Zwischenspiel dieser Fuge (2 Takte). Dieses trennt die Exposition von der zweiten und der dritten Durchführung. Die beiden melodischen Kadenzen grenzen den vierten und den fünften Durchführungsteil ab, und nach der letzten melodischen Kadenz folgt die Coda (sechste Durchführung).
Der Hauptteil des Stückes steht, wie schon beschreiben, in C-Moll. In Takt sieben und Takt zehn findet man den Comes jeweils in C-Dur. Das Ende des dritten Durchführungsteils steht in harmonischer G-Moll (Takt 13). Der Themeneinsatz der dritten Stimme in Takt 17 ist in melodischer C-Moll geschrieben. In Takt 22 spielt die erste Stimme in der Dominanten zu C- Moll, also G-Dur.
Auffallend am Aufbau ist, dass die vierte Stimme erst relativ spät einsetzt (Takt 19). Sogar die Exposition ist nur dreistimmig geschrieben. Die dritte Stimme wird aus diesem Grund bis zu Takt 19 mal als Tenor und mal als Bass behandelt. Die vierte Stimme erhält aber gleich eine wichtige Bedeutung, da sie sofort mit großen Notenwerten mit dem Thema einsetzt (Augmentation), gefolgt von einer Umkehrung und einem weiteren Comes, nach dem sie in Takt 23 mit einer Kadenz den Schluss einleitet.
In der Exposition findet man in Takt drei die Grundgestalt des Themas, die, wie bereits oben beschreiben, aus einer sekundweise absteigenden Bewegung von der Quinte zur Terz führt. Das Zwischenspiel nach der Exposition enthält in dem sekundweisen Aufwärtsgang der dritten Stimme (Takt 5) und in der Gegenbewegung der ersten Stimme (Takt 6) eine Anspielung auf das Thema. Es ist ein diminuierter Krebs der zweiten bis sechsten Achtel des Themas. Unterschiedlich ist nur das Intervall zwischen der fünften und sechsten Achtel, das im Thema die Größe einer Quarte besitzt, in der Variation allerdings nur noch eine Terz beträgt.
In der dritten Stimme wird außerdem noch mit einer Umkehrung gearbeitet. Bach kombiniert also schon direkt am Anfang drei Stilmittel (Diminution, Krebs und Umkehrung). Diese verwendet er aber nur für einen Ausschnitt des Themas. So behält er sich die komplexen Variationen des gesamten Themas noch vor.
Die dritte und die zweite Stimme weisen mit ihren Scheineinsätzen (Takt 6) auf die zweite Durchführung, die mit C-Dur beginnt. Die erste Stimme spielt in Takt 8 zum ersten Mal eine rhythmische Variation des Dux. In dem folgenden Zwischenspiel ist wieder das Motiv des Themas zu erkennen, das nach dem Dux der ersten Stimme einsetzt und jeweils um eine Terz sequenziert wird. Es bildet zusammen mit den sequenzierten Quartsprüngen der dritten Stimme Terzparallelen. Dies erinnert an das Thema und den Kontrapunkt in Takt 2 und 3, die sich auch immer in Terzparallelen ergänzen.
Den dritte Durchführungsteil lässt Bach mit einem sehr stark variierten tonalen Comes enden, bei dem die dritte Achtel fehlt. Außerdem wurde bis auf das Motiv eine Umkehrung des Themas vorgenommen. Auch der Quintsprung wurde verändert, und zwar wurde er auf einen Quartsprung verkleinert. Der Quartsprung setzt zusätzlich noch eine Quinte tiefer ein, als erwartet. Auch das Motiv, mit dem jedes Thema endet, setzt tiefer ein als erwartet und ist auch nicht mehr umgekehrt. Als Tonart wird in diesem Abschnitt harmonische G-Moll verwendet.
Nach der gliedernden Kadenz zur Dominanten G folgt zum ersten mal in diesem Stück das satztechnische Mittel der Engführung (ab Takt 14). Bach verwendet hier eine dreifache Schichtung von Grundgestalt (erste Stimme), Augmentation (zweite Stimme) und variierter Umkehrung (dritte Stimme). Variiert wird in der dritten Stimme das bereits am Anfang erwähnte Intervall zwischen der vierten und der fünften Achtel. Es wurde von einer Quinte im Original auf eine Sexte vergrößert. Die Bedeutung der Kadenz wird in diesem Zusammenhang noch vergrößert, da sie mit G endet und alle drei Stimmen in ihrem folgenden Themeneinsatz mit einem G beginnen. In diesem vierten Durchführungsteil, der der längste dieser Fuge ist, wird auch die höchste Dichte an Themeneinsätzen erreicht. In nur fünf Takten wird acht mal das Thema gespielt (natürlich variiert).
Ohne ein weiteres Zwischenspiel, aber mit einem deutlichen Tonartwechsel beginnt in Takt 19 dann die fünfte Durchführung gleich mit einer weiteren Engführung von Sopran und erstmals dem Bass, der in diesem Takt zum ersten mal einsetzt und so auch noch die fünfte von der vierten Durchführung trennt. Er spielt bis zum Ende der fünften Durchführung ununterbrochen das Thema und leitet schließlich mit einer Kadenz zur Tonika C die Coda ein. Auch die Coda besitzt eine sehr hohe thematische Dichte (6 Themeneinsätze in 3 Takten) und enthält außerdem noch drei mal das charakteristische Motiv des Thema. Neben Takt 24 Ende findet man es in Takt 26 Ende in der ersten und zweiten Stimme, die das Motiv mit dem Tonabstand einer Quinte genau gleichzeitig spielen (Transponierung). In der Mitte von Takt 27 wird durch einen dissonanten Vierklang eine Spannung aufgebaut, die ihren Höhepunkt in Takt 27 am Ende hat. Hier ergänzen sich die vier Stimmen zu einem Dominantseptakkord zu der Tonika C.
Das Stück endet mit einem C-Moll Dreiklang, der das Stück harmonisch abschließt und die aufgebaute Spannung auflöst. Interessant an diesem Dreiklang ist, dass alle vier Stimmen ein C spielen, die zweite Stimme jedoch auch noch die kleine Terz und die Quinte zu C, so dass überhaupt ein Dreiklang entstehen kann.
Bach beweist mit diesem Stück, dass er dem ihm oft gegebenen Titel des ,,Meisters der Fuge" würdig ist. Er baut seine gesamte Fuge aus nur einem Thema auf. Die Schlichtheit dieser monothematischen Komposition wird durch ein fehlendes Kontrasubjekt noch verstärkt. Doch mit dem Begriff Schlichtheit muss man bei diesem Stück stark aufpassen. Das schlichte und unscheinbare Thema des Anfang entwickelt sich innerhalb des Stückes durch kunstvolle Satztechniken, die besonders in der zweiten Hälfte des Stückes in den einzelnen Engführungen in dichtestem Raum aufeinanderfolgen, zu einer eigenen Größe, die der Fuge selber zu einer Größe verhilft, von der man am Anfang nur wenig erkennen konnte. Charakteristisch und sehr ungewöhnlich ist auch, dass die an sich vierstimmige Fuge über die Hälfte der Länge nur dreistimmig ist. Aufgrund der fundamentalen Bedeutung, die Bach der vierten Stimme gibt, bleibt sie meines Erachtens aber gleichberechtigt zu den anderen Stimmen und nimmt keine untergeordnete Position ein.
Häufig gestellte Fragen - Wohltemperiertes Klavier: Eine Analyse
Was ist das Musikstück "Fuga II" (BWV 871)?
Das Musikstück "Fuga II" (BWV 871) ist eine vierstimmige Fuge in C-Moll für Klavier, komponiert von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Es ist Teil seines Werkes "Das Wohltemperierte Klavier, II" und umfasst 28 Takte. Es wurde 1738 geschrieben und ist der zweite Teil des zweiten Stückes, folgend auf das Präludium.
Wie ist das Thema der Fuge aufgebaut?
Das Thema ist ruhig, fließend und hat einen Ambitus von einer Quinte. Es basiert auf einer schlichten absteigenden Linie von der Quinte zur Terz. Rhythmisch wird das Thema durch Achtel geprägt, gefolgt von einer kurzen Sechzehntel-Bewegung. Ein motivischer Charakter liegt in der Figur aus einer Achtel, zwei Sechzehntel und einer Viertel.
Welche Rolle spielt der Kontrapunkt?
Der Kontrapunkt wird außer in Takt 2 und Takt 4 nicht weiter aufgegriffen und erhält keine charakteristische Bedeutung für das Stück. Es kann also nicht direkt von einem Kontrasubjekt gesprochen werden. Er ist tonleitergebunden, hat ebenfalls den Ambitus einer Quinte und besteht aus Achteln und Vierteln. Thema und Kontrapunkt ergänzen sich in Terzparallelen.
Was ist charakteristisch für den Comes?
Der Comes entspricht einer tonalen Beantwortung. Das Intervall zwischen der ersten und der zweiten Achtel beträgt nur noch eine Sekunde anstatt einer Terz. Die erste und dritte Achtel haben die gleiche Tonhöhe.
Wie ist die Exposition aufgebaut?
Der Dux beginnt im Alt auf der ersten Stufe. Der Comes folgt im Sopran auf der fünften Stufe, wodurch eine Tonika-Dominant-Spannung entsteht. Durch die Modulation des Comes in die Dominanttonart wird eine Rückmodulation eingefügt, bevor der Tenor in Takt 5 die Exposition beendet. Der Tenor spielt das Thema aufgrund der Rückmodulation wieder auf der ersten Stufe.
Wie sind die Durchführungsteile strukturiert?
Die Durchführungsteile variieren in ihrer Länge zwischen 2 und 5 Takten. Der zweite Durchführungsteil ist besonders kurz. Die Länge der Durchführungsteile nimmt bis zum vierten Durchführungsteil (erste Engführung) zu und wird danach wieder kürzer.
Welche Bedeutung haben die Kadenzen in Takt 13 und Takt 23?
Die melodischen Kadenzen in Takt 13 und Takt 23 gliedern das Stück. Die Kadenz in Takt 13 führt zur Dominanten G und bereitet die folgenden Themeneinsätze vor. Die Kadenz in Takt 23 leitet von der Dominanten G-Dur in die Coda über.
Welche Tonarten werden im Stück verwendet?
Der Hauptteil des Stückes steht in C-Moll. In Takt 7 und Takt 10 findet man den Comes in C-Dur. Das Ende des dritten Durchführungsteils steht in harmonischer G-Moll (Takt 13). In Takt 22 spielt die erste Stimme in der Dominanten zu C-Moll, also G-Dur.
Was ist auffällig am Einsatz der vierten Stimme?
Die vierte Stimme setzt erst relativ spät ein (Takt 19). Die Exposition ist nur dreistimmig geschrieben. Die vierte Stimme erhält aber sofort eine wichtige Bedeutung, da sie mit großen Notenwerten mit dem Thema einsetzt (Augmentation), gefolgt von einer Umkehrung und einem weiteren Comes.
Welche Variationstechniken werden verwendet?
Bach verwendet verschiedene Variationstechniken wie Diminution, Krebs und Umkehrung, oft nur für Ausschnitte des Themas. Im Zwischenspiel nach der Exposition findet sich beispielsweise ein diminuierter Krebs des Themas. Auch rhythmische Variationen des Themas werden eingesetzt.
Welche Rolle spielen die Engführungen?
Das satztechnische Mittel der Engführung wird ab Takt 14 eingesetzt. Bach verwendet hier eine dreifache Schichtung von Grundgestalt, Augmentation und variierter Umkehrung des Themas.
Wie ist die Coda aufgebaut?
Die Coda besitzt eine sehr hohe thematische Dichte und enthält außerdem das charakteristische Motiv des Themas. In Takt 27 wird durch einen dissonanten Vierklang eine Spannung aufgebaut, die sich in einem Dominantseptakkord zu C auflöst. Das Stück endet mit einem C-Moll Dreiklang.
Was ist das Fazit der Analyse?
Bach beweist mit diesem Stück seine Meisterschaft in der Fugenkomposition. Er baut die gesamte Fuge aus nur einem Thema auf und entwickelt dieses durch kunstvolle Satztechniken zu einer eigenen Größe. Die Fuge ist ungewöhnlich, da sie über die Hälfte der Länge nur dreistimmig ist, aber die vierte Stimme eine fundamentale Bedeutung erhält.
- Citation du texte
- Ingo Schaaff (Auteur), 2001, Wohltemperiertes Klavier - Eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100189