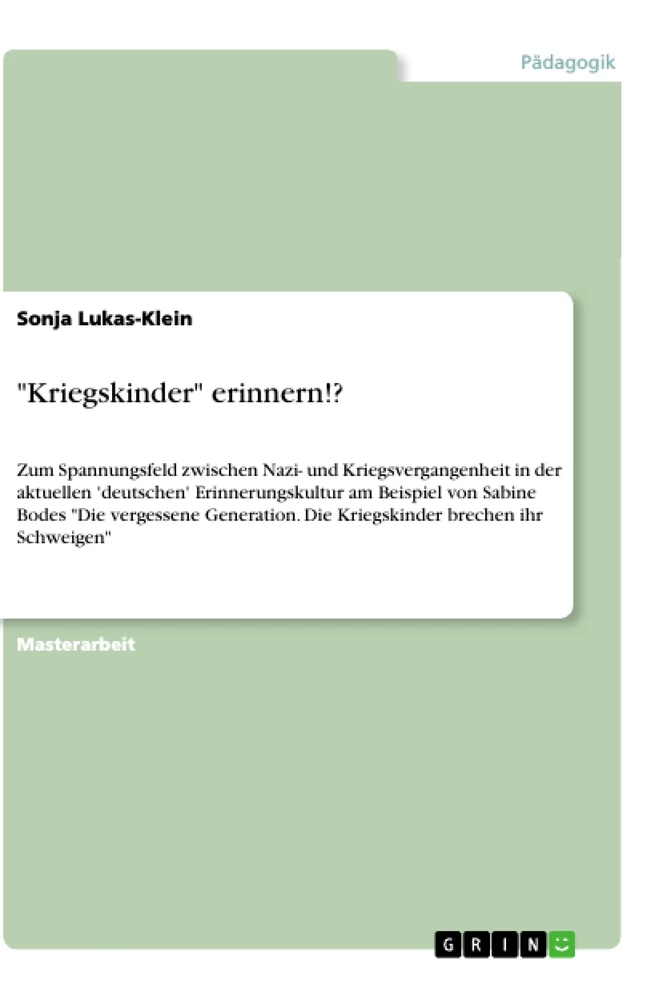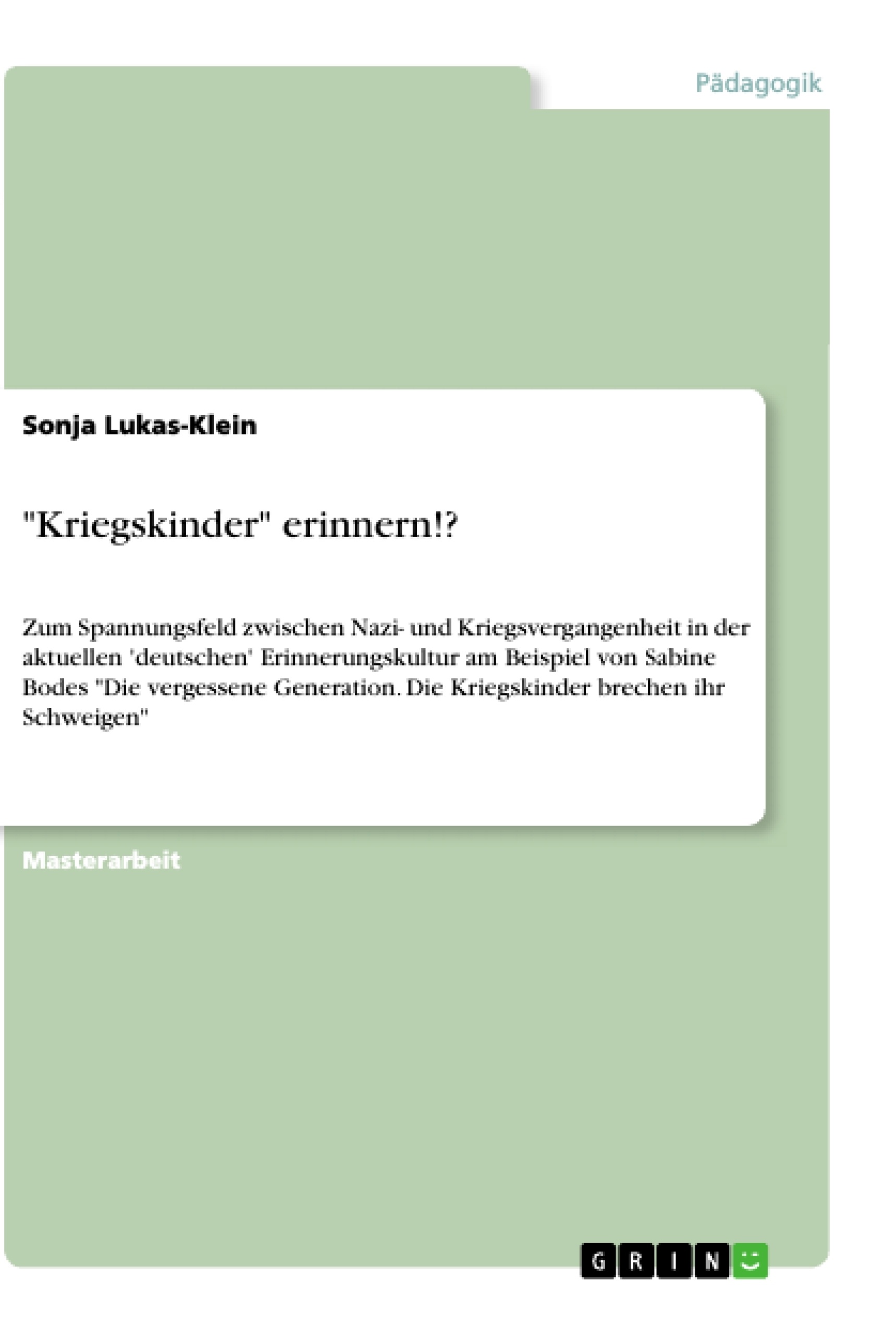Die vorliegende Arbeit ist eine konzeptionelle und setzt sich hermeneutisch am ‚Fall Sabine Bode‘ mit dem Problem auseinander, ob die von ihr identifizierten ‚deutschen Opfer‘ in ihrer Spezifik als ‚Kriegskinder‘ kollektiv erinnert werden sollten.
Dafür werden im theoretischen Teil zentrale Begrifflichkeiten konturiert, ohne die „Die vergessene Generation“ sprachlich nicht gefasst werden kann. Dabei ist dieses Kapitel nicht ‚rein theoretisch‘, sondern von Verweisen auf die (west-)deutsche Erinnerungsgeschichte durchzogen, die für den Fortgang der Arbeit relevant sind.
Im dritten Kapitel wird die aktuelle ‚deutsche‘ Erinnerungskultur beschrieben.
Daraufhin wird der momentane Stand der Forschung zu ‚Kriegskindern‘ dargelegt, die Sabine Bode auf nationaler Ebene erinnert wissen möchte.
Warum sich Bode für eine Modifikation der bestehenden Erinnerungskultur ausspricht und wie diese ihres Erachtens sichtbar gemacht werden sollte, ist dem deskriptiv-analytischen Kapitel zu entnehmen.
Im Anschluss erfolgt zunächst eine Zusammenschau dessen, welchen Raum die ‚Kriegskinder‘ mit ihren zeitgeschichtlichen Erfahrungen gegenwärtig in der Gesellschaft einnehmen.
Erst daran schließt ein kritisch-konstruktives Kapitel an, in dem Bodes erinnerungspolitische Forderung aus vier verschiedenen Blickwinkeln diskutiert wird.
Im Schluss findet eine kurze Zusammenfassung sowie ein Ausblick statt.
In ihrem Buch „Die vergessene Generation“ legt Bode das Thema der (Un-)Vereinbarkeit von Schuld und Leid neu auf, indem sie die klare Grenze zwischen Opfern und Tätern* verwischt. Sie stellt die These auf, dass diejenigen nichtjüdischen Deutschen, die den Zweiten Weltkrieg als Kinder oder Jugendliche erlebt und überlebt haben, von ihr „Kriegskinder“ genannt, durch ihre (früh-) kindlichen Erfahrungen traumatisiert wurden und jetzt im Alter noch immer unter den Folgestörungen leiden, weil sie die Arbeit am Erlebten zeitlebens vermieden, ihre seelischen Verletzungen als Kinder von Tätern* aufgrund der Affekte von Scham und Schuld als gesellschaftlich unbrauchbar verdrängt und verschwiegen haben, sodass ihre Trauer um das Verlorene seit Jahrzehnten offen ist, obwohl sie als genauso unschuldige Opfer anzusehen sind wie Holocaustüberlebende, weil sie als Kinder keine Täter* waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erinnerungskultur(en)
- Kollektive Gedächtnisformen
- Das nationale Gedächtnis
- Wer erinnert sich?
- Heroisches und traumatisches Opfergedächtnis
- Täter* gedächtnis
- Die Figur des moralischen Zeugen
- Umgang mit historischen Traumata
- Aktuelle, deutsche Erinnerungskultur
- ‚Kriegskinder‘ und ihre Traumatisierungen
- Psychologisches Trauma
- ,Kriegskinder
- ,Kriegskinder“ national erinnern! – Sabine Bodes „Die vergessene Genera-\ntion. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen.“
- Sabine Bodes Argumentation
- Sabine Bodes erinnerungspolitische Forderung aus gedächtnistheoreti-\nscher Perspektive
- Gesellschaftliche Wahrnehmung der, Kriegskinder
- ,Kriegskinder' national erinnern? - Diskussion
- Perspektive: „Kriegskinder‘
- Perspektive: Identitätsstiftung, nach innen‘
- Perspektive: Außenwahrnehmung
- Funktion symbolpolitischer Rituale
- Fazit:,Kriegskinder' werden erinnert
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die „Kriegskinder“-Generation in der deutschen Erinnerungskultur angemessen erinnert und gewürdigt werden kann. Sie beleuchtet den Spannungsbogen zwischen Nazi- und Kriegsvergangenheit und der aktuellen Debatte um die Bedeutung von Opfererinnerung im Kontext des Holocaust-Gedenkens.
- Kollektive Erinnerungskultur und nationale Gedächtnisformen
- Der Umgang mit historischen Traumata und der Einfluss auf spätere Generationen
- Die „Kriegskinder“-Generation als spezifische Opfergruppe der Kriegs- und Nachkriegszeit
- Die erinnerungspolitische Forderung von Sabine Bode und ihre Bedeutung für die nationale Identität
- Die gesellschaftliche Wahrnehmung der „Kriegskinder“ und die Debatte um ihre Rolle in der aktuellen Erinnerungskultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Stand der deutschen Erinnerungskultur beleuchtet und die Relevanz des Themas der „Kriegskinder“-Erinnerung herausstellt. Das zweite Kapitel widmet sich dem komplexen Feld der Erinnerungskultur und analysiert verschiedene Formen des kollektiven Gedächtnisses, insbesondere das nationale Gedächtnis, die Rolle von Zeitzeugen und den Umgang mit historischen Traumata. Im dritten Kapitel wird die aktuelle deutsche Erinnerungskultur im Kontext des Holocaust-Gedenkens beleuchtet. Kapitel 4 untersucht die spezifischen Traumatisierungen der „Kriegskinder“-Generation und die Auswirkungen dieser Traumata auf ihre Lebensgeschichten. Kapitel 5 analysiert Sabine Bodes Buch „Die vergessene Generation. Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen.“ und untersucht ihre Argumentation und ihre erinnerungspolitische Forderung. Das sechste Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Wahrnehmung der „Kriegskinder“ und ihre Rolle in der aktuellen Erinnerungskultur. Im siebten Kapitel wird die Debatte um die nationale Erinnerung an die „Kriegskinder“ aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet: die Perspektive der „Kriegskinder“ selbst, die Perspektive der Identitätsstiftung nach innen und die Perspektive der Außenwahrnehmung. Das Kapitel analysiert auch die Funktion symbolpolitischer Rituale in diesem Kontext und kommt zu einem Fazit über die Bedeutung der „Kriegskinder“-Erinnerung für die deutsche Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet zentrale Themen wie Erinnerungskultur, nationale Gedächtnisformen, historische Traumata, „Kriegskinder“-Generation, Opfererinnerung, Holocaust-Gedenken, Identitätsstiftung, symbolpolitische Rituale und gesellschaftliche Wahrnehmung. Sie befasst sich mit den Herausforderungen der Erinnerungskultur im Kontext des demografischen Wandels und der Bedeutung der „Kriegskinder“-Erinnerung für die deutsche Gesellschaft.
- Quote paper
- Dr. Sonja Lukas-Klein (Author), 2020, "Kriegskinder" erinnern!?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1001874