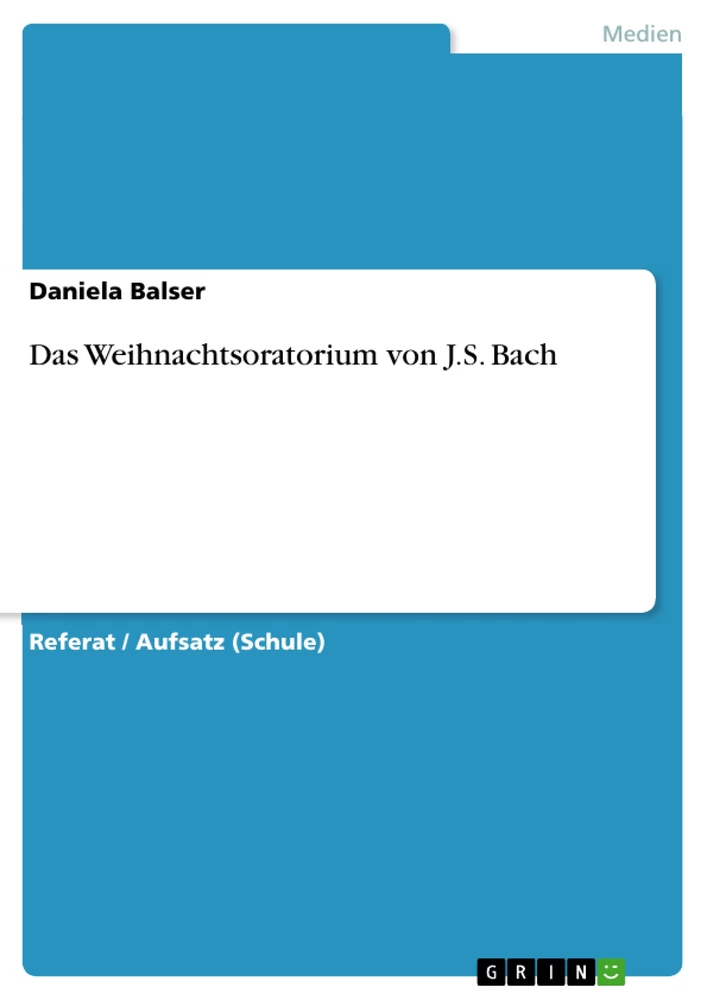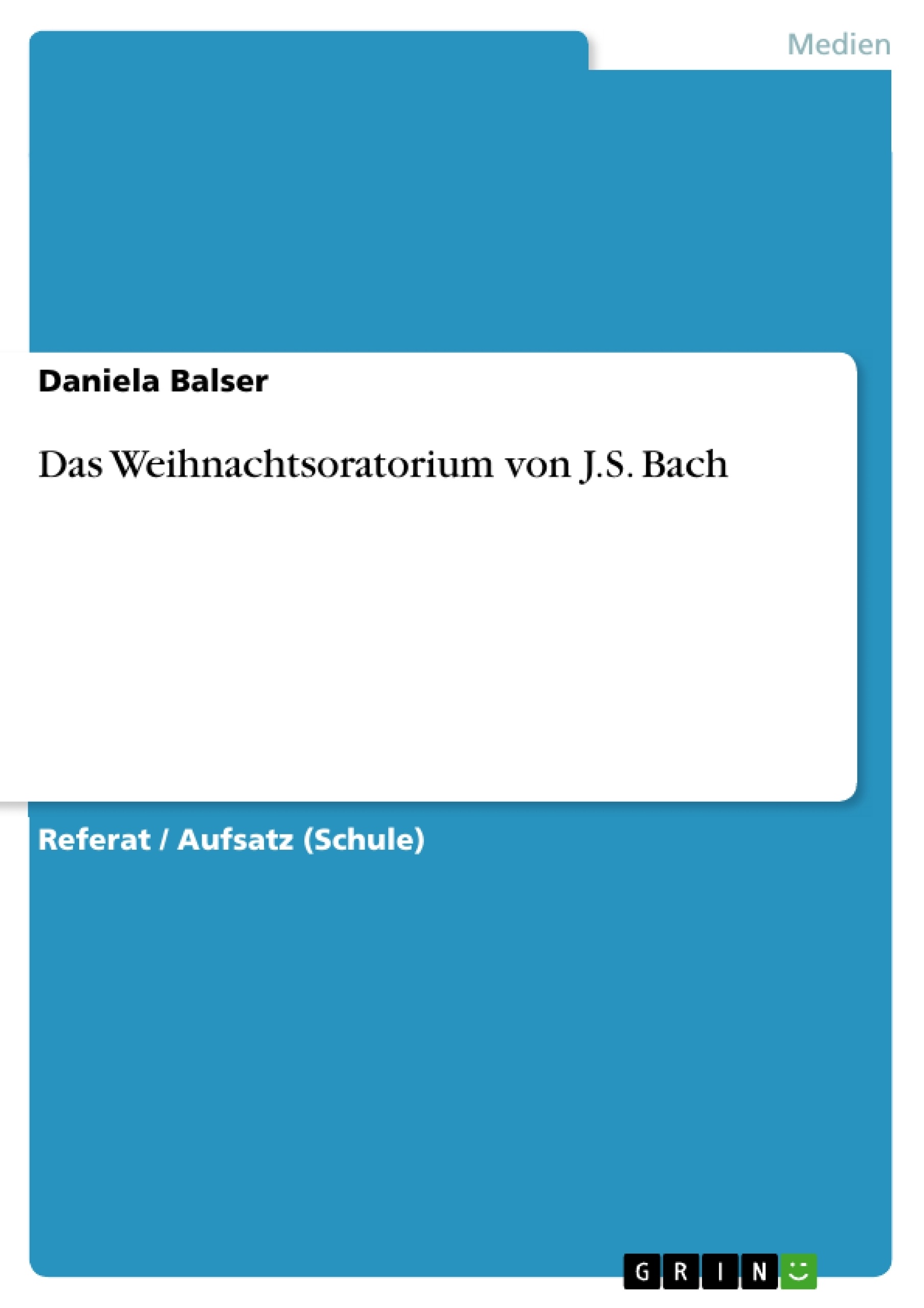Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Leipziger Thomaskirche im Jahr 1734, die Luft ist erfüllt von festlicher Erwartung. Doch was verbirgt sich wirklich hinter den Klängen, die Johann Sebastian Bachs Weihnachts-Oratorium zum Leben erwecken? Tauchen Sie ein in eine faszinierende Analyse dieses Meisterwerks, die nicht nur Bachs kompositorische Genialität beleuchtet, sondern auch die theologische Tiefe und die kulturellen Wurzeln des Werkes enthüllt. Von den bescheidenen Anfängen des Komponisten in Eisenach über seine prägenden Jahre als Organist in Arnstadt und Weimar bis hin zu seiner Berufung als Thomaskantor in Leipzig, verfolgen wir Bachs musikalische Entwicklung und seinen unermüdlichen Schaffensdrang. Entdecken Sie die subtilen musikalischen Details des Rezitativs "Und alsobald war da" und des Chors "Ehre sei Gott in der Höhe", eingebettet in den größeren Kontext des Weihnachts-Oratoriums. Ergründen Sie die Bedeutung der Instrumentierung, von den warmen Klängen der Oboen d'amore und da caccia bis hin zum strahlenden Glanz der Trompeten, die die himmlischen Heerscharen musikalisch darstellen. Analysieren Sie die polyphone Struktur der Chöre, die den Zuhörer in ein Netz aus Melodien und Harmonien einweben, und verstehen Sie, wie Bachs musikalische Sprache gotische Mystik mit barocker Vitalität vereint. Dieses Buch ist mehr als nur eine Musikanalyse; es ist eine Reise in die Welt des Barock, eine Auseinandersetzung mit der theologischen Botschaft der Weihnachtsgeschichte und eine Hommage an einen der größten Komponisten aller Zeiten. Erfahren Sie, wie Bachs Weihnachts-Oratorium, trotz seines ursprünglichen Gebrauchs von Parodieverfahren und Umtextierungen älterer Werke, zu einem Inbegriff weihnachtlicher Musik geworden ist, dessen Botschaft von Frieden und göttlicher Herrlichkeit bis heute die Herzen der Menschen berührt. Lassen Sie sich von der Detailtiefe der Analyse, der Leidenschaft für Bachs Musik und dem tiefen Verständnis für den historischen Kontext fesseln und entdecken Sie das Weihnachts-Oratorium auf eine völlig neue Art und Weise. Begleiten Sie uns auf einer musikalischen Entdeckungsreise und erfahren Sie, wie Bachs Weihnachts-Oratorium die theologische Botschaft der Christgeburt auf einzigartige Weise zum Ausdruck bringt, indem er biblische Texte, poetische Arien und kraftvolle Chöre zu einem unvergesslichen Gesamtkunstwerk vereint. Dieses Buch enthüllt nicht nur die musikalische Struktur, sondern auch die emotionale und spirituelle Tiefe dieses zeitlosen Meisterwerks, und beleuchtet die Gründe, warum es bis heute die Herzen der Zuhörer auf der ganzen Welt berührt. Tauchen Sie ein in die Welt von Johann Sebastian Bach und erleben Sie die Magie des Weihnachts-Oratoriums neu!
I. Einleitung
Der Komponist
Johann Sebastian Bach wurde am 21. März 1685, in Eisenach, als jüngster von sechs Geschwistern, geboren. Der Vater, Ambrosius Bach, wirkte als Stadt- und Hofmusiker in Eisenach. Auch sein jüngster Sohn erhielt Unterricht im Bläser- und Streicherspiel. Mit 7 Jahren (1692) trat er in die Lateinschule ein.
Innerhalb eines Jahres, zwischen 1694 und 1695, verliert Sebastian erst seine Mutter, Elisabeth, geb. Lämmerhirt, dann seinen Vater. Die Familie wird in alle Himmelsrichtungen verstreut. J. S. Bach findet bei seinem älteren Bruder, dem Organisten von Ohrdruf, Unterschlupf.
Trotz der Armut seines Bruders, darf Sebastian das dortige Gymnasium besuchen. Außerdem lehrte sein Bruder ihm das Spielen der Orgel (sein größter Traum geht in Erfüllung).
1703 erhält Sebastian seine erste stelle als Organist an der Privatkapelle des Herzogs Johann Ernst von Weimar und noch im gleichen Jahr an der Neuen Kirche in Arnstadt. Dort lässt er sich beurlauben und macht sich zu Fuß auf nach Lübeck, um den Organisten Buxtehude spielen zu hören.
Wegen "Urlaubsüberschreitung" bekommt er Streit in Arnstadt und wechselte deshalb 1707 als Organist nach Mühlhausen (Thüringen). Dort heiratet Bach eine Cousine 2 grades, Maria Barbara, die ihm bis 1718 sieben Kinder gebärt. 1708 geht er als Hoforganist und Kammermusiker nach Weimar und wird dort 1714 Hofkonzertmeister. Der Wechsel vom kirchlichen in den höfischen Dienst wird seinen Grund darin haben, dass der höfische Dienst in höherem Ansehen als der Kirchliche stand. In Weimar entstehen die meisten seiner freien Orgelkompositionen, etwa 30 Kantaten und viele Choralbearbeitungen.
Bach ist einer der ersten, der für das Orgel- und Klavierspiel eine systematische Methode zur Benutzung des Daumens ausarbeitet. 1717 siegt er in Dresden in einem Musikerwettstreit über den französischen Cembalisten Louis Marchand.
Die Weimarer Zeit machte Bach auch mit der italienischen Opernmusik bekannt und veranlagte ihn, neue Wege in den eigenen Vokalstücken zu beschreiten. Als man ihn bei der Neubesetzung des Kapellmeisterpostens übergeht, nimmt er 1717 die Stelle des Hofkapellmeisters beim Fürsten Leopold von Anhalt in Köthen an. Dort stirbt seine erste Frau Maria Barbara. Ein Jahr später heiratet er Anna Magdalena Wülcken (1701 bis 1760), die Tochter eines Hoftrompeters. Aus dieser Ehe stammen sechs Söhne und sieben Töchter.
Typisch für den Geist der Musikpflege im Hause Bach sind die drei Notenbüchlein, die J. S. Bach für seinen Sohn Wilhelm Friedemann und für seine Frau Anna Magdalena schrieb. In Köthen entstehen die eisten Kammermusik-, Klavier- und Orchesterwerke. Sein Versuch, den Zeitgenossen Händel kennenzulernen, misslingt. Die beiden gleichartigen Komponisten haben sich nie gesehen.
Als im Jahre 1722 der Leipziger Thomas-Kantor Johann Kuhnau stirbt und dir drei zu ihrer Zeit berühmtesten deutschen Komponisten und Kapellmeister Georg Philipp Telemann (Hamburg), Johann Friedrich Fasch (Zerbst) und Christoph Graupner (Darmstadt) die Nachfolge ausschlagen, fällt die Wahl auf Bach. Obwohl das Amt des Leipziger Thomas-Kantors seit der Reformation im deutschen Kirchenmusikleben sehr angesehen ist, entschloss sich Bach nicht sofort zur Annahme des Amtes. Denn die Thomas-Schule hat an Bedeutung verloren, und der Wechsel vom Hofkapellmeister zum Kantor wäre ein gesellschaftlicher Abstieg gewesen. Bach tritt 1723 das Amt dennoch an.
Neben der Ausbildung des Thomas-Chores hat er für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste an der Thomas- und an der Nikolaikirche zu sorgen. Außerdem übernimmt er die Leitung verschiedener Musikvereinigungen. Dem Kantor bieten sich ungewöhnliche Möglichkeiten, vor großer Hörerschaft und mit großem Ensemble Werke religiösen Charakters aufzuführen. Bach komponiert in Leipzig den Großteil seiner 300 Kirchenkantaten und Motetten. Davon sind 200 erhalten, darunter das "Weihnachst-Oratorium", die "h-Moll - Messe", die "Johannes-" und die "Matthäus- Passion".
Seiner Schaffenskraft werden weder durch seine Erblindun g, noch durch Schwierigkeiten mit den Behörden in Leipzig, die alles versuchten, die musikalische Tradition der Thomas-Schule zu unterbrechen, beeinträchtigt. Aller Resignation zum Trotz schafft er mit dem "Musikalischen Opfer" auf ein Thema Friedrichs 2. Und mit der "Kunst der Fuge" noch zwei Werke von fundamentaler Bedeutung.
Er stirbt am 28. Juli 1750. Zu dieser Zeit ist seine Kunst der Polyphonie nicht mehr modern. Man vergisst ihn deshalb sehr schnell. Von seinen Kompositionen gehen nahezu die Hälfte verloren. Sein Tod findet keinerlei Widerhall. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gilt sein Sohn Carl Philipp Emanuel allgemein als "der große Bach", während der Vater J. S. Bach kaum noch genannt wird.
Erst im Jahre 1829 bringt Felix Mendelssohn-Bartholdy mit einer Berliner Aufführung der "Matthäus-Passion" J. S. Bach und sein Werk wieder in Erinnerung.
Bachs Musik ist ein Schlusspunkt vor der Stilwende zur Klassik. In genialer Weise hat der Thomas-Kantor die Musikstile der Niederländer (Gotik) über Heinrich Schütz (den Vater der deutschenprotestantischen Kirchenmusik) zu Buxtehude von Vivaldis italienischem Barock zusammengefasst, in dem er die Gesetze der Polyphonie und der Generalbasskunst, der Kontrapunktik und der Harmonie miteinander verbindet. Gotische Mystik und barocke Vitalität werden in seiner Musik zu einer Einheit.
Das Weihnachts-Oratorium
"Oratorium, welches die heilige Weynacht über in den beiden Haupt-Kirchen zu Leipzig aufgeführet wurde. Anno 1734" - so lautete der Titel des gedruckten Textbuches, das zu den Festgottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und dem Epiphaniasfest vom 6. Januar des folgenden Jahres an den Toren von St. Thomas und St. Nicolai verkauft wurde. In diesen beiden Hauptkirchen Leipzigs wurden die sechs Kantaten, aus denen sich das Gesamtwerk aufbaut, jeweils vormittags und nachmittags aufgeführt, wobei die Reihenfolge abwechselte. Prediger, Sänger, Stadtmusiker und der Kantor, zu dessen Pflichten neben dem Orgelspiel die Komposition von Kantaten, Motetten und Passionen gehörte, waren an diesen Tagen, die einen Höhepunkt des Kirchenjahres und des bürgerlichen Lebens bezeichneten, vollauf beschäftigt.
Man ist verlockt, sich einmal in die damalige Funktion und Situation des heute berühmten und den Musikfreunden und gebildeten der ganzen Welt als "Weihnachts- Oratorium" vertrauten Werkes zurückzuversetzen. Zuhörer der ersten Aufführungen waren die Mitglieder der beiden Gemeinden. Nicht ein rein musikalisches Interesse hatte sie in die Kirche geführt, sondern die selbstverständliche Pflicht des geistlichen Jahreslaufes und er Wunsch nach Erbauung. Solche Erbauung fanden sie in erster Linie in der Predigt, in den ihnen vertrauten Worten des Evangeliums, in der im Textbuch nachzulesenden Poesie des Textdichters und schließlich, soweit sie musikalisch waren, in der Musik. Wer Bibelwort und Poesie, aus denen sich zu jener Zeit ein Kantatentext zusammensetzte, vertont hatte, das war im Textbuch nicht angegeben, brauchte gar nicht angegeben zu werden, weil nicht ein neugieriges Konzertpublikum, sondern ausschließlich die Gemeindemitglieder, denen ihr Kantor eine vertraute Figur war, zeugen der Aufführung waren.
Auch wenn Bach seine glücklicherweise erhaltene Partiturhandschrift vom Weihnachts-Oratorium nicht mit seinem Namen signiert hätte, wüsste man doch, dass nur er das herrliche Werk hätte komponieren können. Wer die Texte der Arien und Chöre gedichtet hat, ist zwar nicht ebenso durch Unterschrift dokumentiert, dennoch darf man vermuten, dass es der poetisch fruchtbare Christian Friedrich Henrici war, jener Leipziger Ober-Post-Kommissar und Steuereinnehmer, der unter dem Dichternamen "Picander" für Bach schon viele Texte geliefert hatte, darunter solche für Arien und Chöre der "Matthäus-Passion".
Bach hatte schon mehrfach Kantaten für die Gottesdienste der Weihnachtszeit schreiben müssen, aber erst im Winter 1734 beschloss er, die sechs Kantaten, deren jede einzeln aufzuführen war, dennoch in bezug auf Zusammenhang und Ablauf zu einem in sich geschlossenen Ganzen zu verbinden.
So stellt sich die Frage nach der Einheit von musikalischer Substanz und poetischgeistlichem Text ungleich komplizierter.
Bach hat nämlich nur die erzählenden Rezitative des Evangelisten, die Secco- Rezitative (nicht die Accompagnati und die vierstimmigen Choräle), mithin die musikalisch schlichtesten Bestandteile, für sein neues Werk auch wirklich neu komponiert.
Mit einigen Ausnahmen allerdings: neu schuf er auch die berühmte Sinfonie der Hirten und zwei Chöre, das mottethisch streng gearbeitete "Ehre sei Gott in der Höhe" (Nr.21) und den tonmalerischen Einschub "Lasset uns gehen gen Bethlehem " (Nr. 26).
Auch eine der Arien hat Bach neu komponiert, aber erst, nachdem er selbstkritisch bemerkt hatte, dass in diesem Fall die in der ganzen Barockmusik übliche und von der Musikwissenschaft als Parodieverfahren bezeichnete Praxis, eine früher geschriebene Vokalkomposition aus gegebenem Anlass mit einem neuen Text zu versehen, zu keinem ihn befriedigenden Resultat führte.
Den Arbeitsprozess insgesamt darf man sich so vorstellen, dass Bach zunächst den Evangelienbericht über die sechs dem Kalender zugeordneten Abschnitte verteilte, ihn durch Choräle sinngemäß ergänzte und schließlich, sofern er sich nicht zur Neukomposition entschloss, Chöre, Arien und begleitete Rezitative aus schon vorhandenen Kantaten hinzufügte, deren musikalischem Ablauf der neue Text anzupassen war. Diese Umtextierung von Takt zu Takt erforderte begreiflicherweise eine enge Zusammenarbeit zwischen Poet und Komponist. Zu solchem Parodieverfahren dienten Bach überwiegend zwei weltliche Kantaten, die ein Jahr vor dem Weihnachts-Oratorium komponiert worden waren: die am 5. September 1733 aufgeführte "Wahl des Herkules", eine Geburtstagskantate für den Kurprinzen Friedrich von Sachsen, und die der sächsischen Kurfürstin und polnischen Königin Maria Josepha ebenfalls zum Geburtstag gewidmete und am 8. Dezember des gleichen Jahres aufgeführte Kantate "Tönet, ihr Pauken". Teile aus der verlorengegangenen Markus-Passion und weitere weltliche und geistliche Vorlagen, die nicht genau zu identifizieren sind, wurden dergestalt zur Grundlage von Umtextierungen.
Dafür, dass die barocke Musikästhetik heute wieder verstanden wird, liefert gerade das Weihnachts-Oratorium den schlüssigen Beweis. Die als Inbegriff eines geistlichen Wiegenliedes allen Ohren und Herzen vertraute Arie "Schlafe, mein Liebster" (Nr. 19) ging aus einer textlich besonders diskrepanten Parodie hervor. Die im musikalischen Wortlaut notengetreu übernommene Partitur stand in der schon erwähnten Geburtstagskantate "Die Wahl des Herkules". Der dortige Text ("Schlafe mein Liebster und pflege der Ruh, folge der Lockung entbrannter Gedanken! Schmecke die Lust der lüsternen Brust und erkenne keine Schranken!") stellte dar, wie Herkules umbuhlt und eingeschläfert wurde. Schon allein seiner unfreiwilligen Komik wegen nimmt niemand von diesem Urtext Notiz. Unlösbar identifizierte sich dank Bachs
Entscheidung und auf Grund einer generationenlangen Tradition die auf Urmotive von "Schlaf" und "Ruhe" gründende Tonsymbolik von Melodie, Harmonie und wiegender Bewegung mit dem musikalisch sublimierten Text als einem nicht mehr umzukehrenden Vorgang.
Die innere Einheit von Bachs Weihnachts-Oratorium wurde von unzähligen Menschen erlebt und durch solches Erlebnis bezeugt.
Das Oratorium
Oratorium (lat.), der Oper verwandte, aber auf den Konzertsaal oder den Kirchenraum beschränkte musikalische Kunstform aus Text, Chor, Soli und Orchesterparts, die vornehmlich religiös-mythische Stoffe verarbeitet. Eines der ersten Oratorien war Cavalieres "Rappresentazione di anima e di corpo" (1600), bekannte spätere Komponisten waren Carissimi, Scarlatti, Pergolesi u.a., in Deutschland Schütz, Händel, Bach, Haydn, Mendelssohn-Bartholdy, Pfitzner, Hindemith u.a.
Unter Oratorium verstand man eine Komposition, die eine biblische Handlung durchlaufend darstellt, wie sie in diesem Fall mit der Christgeburt (nach Lukas) beginnt und mit der Anbetung der Könige (nach Matthäus) endet. Dieser vom Evangelisten erzählte Ablauf wird durch die Choräle, in denen sich die Gemeinde symbolisiert, durch repräsentative Chöre und "betrachtende" Arien, Duette und Terzette in sechs Abschnitten rhythmisiert.
Nr. 20 & Nr. 21 in Zusammenhang mit dem Gesamtwerk Die Nr. 20 von Bachs Weihnachts-Oratorium ist ein Rezitativ, gesungen vom Evangelisten.
Der Text " Und alsobald waren da bei dem Engel, die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:" entstammt der Bibel, Lukas 2, 13.
"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen" entstammt ebenfalls der Bibel, Lukas 2, 14, und ist ein Chorstück. Beide Nummern stammen aus dem zweiten Teil von Bachs Weihnachts-Oratorium, das den zweiten Weihnachtsfeiertag zelebriert.
Im ersten Teil des Weihnachts-Oratoriums geht es um die Zeit vor Jesu Geburt. Die Christenheit preist seine Ankunft ("Jauchzet, frohlocket").
Weiter handelt dieser Teil davon, dass Maria und Joseph, durch ein Gebot des Kaisers Augustus, gezwungen waren ihre Heimat Galiläa zu verlassen und in Josephs Geburtsort Bethlehem sich zählen zu lassen.
Das Rezitativ Nr. 6, "Und sie gebar" berichtet von Jesu Geburt.
Der zweite Teil des Weihnachts-Oratoriums handelt von der Nachricht von Jesu Geburt an die Hirten.
Ein Engel erscheint dem Hirtenvolk, das nachts auf einem Feld außerhalb Bethlehems seine Herden hütet, und berichtet von der Geburt des Erlösers. Er befiehlt ihnen nach Bethlehem zu pilgern und den Heiland zu preisen.
Davon handelt der von mir bearbeitete Part.
Der dritte Teil des Weihnachts-Oratoriums behandelt die Ankunft der Hirten im Stall in Bethlehem ("Und sie kamen eilend").
Im Choral Nr. 33, "Ich will dich mit Fleiß bewahren", schwört die christliche Gemeinschaft ewige Treue und legt sein Schicksal in die Hände des Erlösers.
Der vierte, fünfte und sechste Teil des Weihnachts-Oratoriums handelt von der Beschneidung Jesu, seiner Verehrung und der Angst und Verfolgung des Königs Herodes.
II. Musikanalyse Inhalte:
Das Rezitativ Nr. 20, "Und alsobald war da", berichtet, dass neben dem Engel, der den Hirten die Nachricht von Jesu Geburt brachte, eine himmlische Schar das Feld erfüllte und Gott lobte mit den Worten des Chores:
"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen"
Diese Worte der himmlischen Schar, die ich ebenfalls als Engel bezeichnen möchte, bewegten die Hirten so sehr, dass sie diesen mit dem Rezitativ "So recht; ihr Engel" zustimmten.
Diese oben aufgeführten Worte beinhalten die universelle Macht Gottes. Nicht nur über die Menschheit, sondern auch im Himmel, über die Engel. Den Menschen sei ein Wohlgefallen, wenn sie den Herrn preisen.
Orchester
Besetzung:
- 1. Solovioline
- 2. Solovioline
- Solo-Oboe
- 1. Oboe d'amore
- 2. Oboe d'amore
- 1. Oboe da caccia
- 2. Oboe da caccia
- Solotrompete
- 2. Trompete
- 3. Trompete
- 1. Corno da caccia
- 2. Corno da caccia
Basso continuo:
- Orgel
- Cembalo
- Violoncello
- Kontrabass
- Fagott
Rezitativ:
Ein Rezitativ ist ein Gesangsstück, dessen Text wortgetreu auf biblischen Texten beruht. ( Hier Lukas 2, 13) Es wird meist von Solisten gesungen.
Text:
"Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott, und sprachen:"
Dieses Rezitativ wird vom Evangelisten, einem Tenor, gesungen. Es liegt ein syllabischer Gesang vor.
So sind auch die Tonhöhen vom Textverlauf abhängig. Betonte Silben (z.b. "Heerscharen") sind durch hohe Töne gekennzeichnet.
Der Rhythmus des Gesangs entspricht der Sprachrhythmik, wobei die Taktart unwichtig ist.
Besonderheiten des Textes werden ebenfalls durch die Begleitung hervorgehoben. Orchesterbesetzung:
- Streicher
- Orgel
- Violoncello
- eventuell Cembalo
Die Einsätze des Orchesters erfolgen als akkordische Begleitung zur Betonung wichtiger Textstellen.
In diesem Fall besteht die Begleitung vor allem aus dem basso continuo. Dementsprechend liegt uns hier ein rezitativo secco vor.
Insgesamt werden hier 8 Akkorde von der Begleitung gespielt. An folgenden Stellen:
1. Vorm Einsetzen des Solisten
2. Zur Betonung der Silbe "En" des Wortes "Engel"
3. Zur Betonung der Silbe "scha" des Wortes "Heerscharen"
4. Zur Betonung der Pause nach dem Wort "Heerscharen"
5. Zur Betonung der Silbe "lob" des Wortes "lobten"
6. Zur Betonung des Wortes "Gott"
7. & 8. Zur Verdeutlichung des Schlusses des Rezitativs
Das Rezitativo Secco hat keine feste Tonart und wird piano im 4/4 Takt gespielt.
Chor:
Bei dem Chorstück "Ehre sei Gott" möchte ich zuerst auf das Orchester eingehen.
Besetzung:
- 2 Flöten
- 4 Oboen
- Violine
- Bläser
Basso continuo:
- Orgel
- Cembalo
- Violoncello
Zwar ist das Stück mit einem Kreuz gekennzeichnet und auch das Tempo könnte auf G-Dur schließen lassen, allerdings beginnt keines der Instrument oder eine Chorstimme auf dem Ton g. Deshalb möchte ich behaupten, dass keine Tonart feststellbar ist.
Der Einsatz des Orchesters ist parallel zu den Chorstimmen und ist sehr lebendig (vivace). Chor und Orchester beginnen forte, nur das Orchester spielt staccato.
Das Orchester spielt in einem recht ausführlichen Maße die Begeleitung des Chores. Wie der Chor spielt das Orchester forte und nur an Stellen, auf die noch eingehen werde, wie der Chor piano.
Die Chorstimmen sind in 6 Teile zu unterteilen:
1. Takt 1-25 (Anfang-O)
Text: "Ehre sei Gott in der Höhe"
Forte
2. Takt 25-31 (O-P)
Text: "und Friede auf Erden"
Piano
3. Takt 31-49 (P-R)
Text: "und den Menschen ein Wohlgefallen"
Forte
4. Takt 49-57 (R-S)
Text: "Ehre sei Gott in der Höhe"
Forte
5. Takt 57-61 (ab S)
Text: "und Friede auf Erden"
Piano
6. Takt 61-65 (Schluss)
Text: "und den Menschen ein Wohlgefallen" Forte
Teil 2 und 5 sind die einzigen beiden Teile, die piano gesungen und vom Orchester gespielt werden. Alles andere ist forte.
Dies hat folgende Erklärung:
Der Text dieser beiden Teile bedeutet Friede auf Erden. Friede ist etwas, das viel mit äußerer und innerer Ruhe zu tun hat. Deshalb hat Bach hier piano gewählt, während alle anderen Textteile sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Teil 1 und 4 beinhalten die Verehrung Gottes, die nicht laut genug hervorgebracht werden kann.
Gott muss einfach klar und deutlich gepriesen werden.
Ebenso ist mit den Teilen 3 und 6. Hier wird der Wunsch der Menschheit nach Erlösung deutlich, was ebenfalls von Bach durch ein forte verdeutlicht wird.
Einsätze:
Teil 1:
Gemeinsamer Einsatz von Sopran, Tenor und Bass. Alt setzt nach einer ½ Pause ein.
Teil 2:
Alt beginnt sofort.
Sopran und Tenor beginnen nach 1/8 Pause.
Bass setzt nach ¼, ½, ¼ Pausen in Takt 26 ein.
Teil 3:
Sopran beginnt sofort. Alt nach ¼ Pause.
Tenor setzt nach ½, 1/1, ¼ Pausen in Takt 33 ein.
Bass beginnt nach ½, 1/1, ½, ¼ Pausen in Takt 33.
Teil 4:
Alt beginnt sofort.
Tenor setzt nach ¼ Pause ein.
Sopran beginnt nach ½ Pause in Takt 50.
Bass setzt nach 2 ½ Pausen in Takt 50 ein.
Teil 5:
Tenor beginnt, da er 1/8 Noten singt.
Sopraneinsatz wegen ¼ Noten. Alt beginnt nach 1/8 Pause.
Bass setzt nach ¼, ½, ¼ Pausen ein.
Teil 6:
Alt beginnt sofort.
Sopran beginnt nach 2 ¼ Pausen parallel mit dem Tenor, der ¼ Pause nach dem Alt. Bass beginnt nach ½, ¼ Pausen.
Auffällig hierbei ist, dass keine Teile identische Einsätze zeigen. Jeder Teil ist ein Individuum.
Ein deutlicher Beweis für die von Bach sehr oft verwendete Polyphonie.
Die Melodieführung jedes einzelnen Teils ist ebenfalls individuell gestaltet.
Besonders auffällig ist, dass die 4 Chorstimmen nur an ganz seltenen Stellen zur selben Zeit den selben Text singen (Takt 28/29, 60/61 und 65).
Diese besonderen Stellen entstammen den drei Textteilen des Chorstücks. Sie sind am Anfang, in der Mitte und am Ende des Stückes verwendet, was ein für Bach typisches Mittel ist, dass er auch in der Abfolge der Chorstücke seines Gesamtwerkes anwendet. Chorstücke findet man also am Anfang, in der Mitte und am Ende eines der sechs Teile wieder.
Die Melodie des Stücks ist von Melismen geprägt. Es ist somit für Sänger und Zuhörer sehr schwer.
Die Melismen drücken erneut die Gewichtigkeit des Textes aus, der einer der wichtigsten des Gesamtwerkes darstellt.
Ebenfalls ist in fast jeder Stimme, auch in den Orchesterstimmen, eine Abfolge von Anabasis und Katabasis erkennbar.
Auch hat Bach einige Triller als weiter musikalische Figuren eingearbeitet.
Nach dem piano Rezitativ ist der Chor "Ehre sei Gott" ein sehr kraftvolles und ausdrucksstarkes Stück, dass mit seiner Lebhaftigkeit Neugier weckt und durch seine verwirrt wirkende Fülle an Melodien interessant wirkt.
Der Schluss des Stückes wirkt mit seinem scheinbar plötzlichen Ende abrupt. Er hat einen sehr dramatischen Klang, was durch eine Katabasis aller Stimmen geschieht.
Um nun zum Schluss zu kommen, möchte ich noch meine persönliche Meinung zu dem Stück "Ehre sei Gott" abgeben.
Ich fand es ziemlich schwer und kompliziert mich am Anfang rein zu hören.
Doch nun, da ich in das Werk eingearbeitet bin, gefällt es mir immer besser. Die Polyphonie dieses Stückes besonders reizt geradezu zum Nachdenken. Ich bin mir aber auch fast sicher, dass dies eines der komplizierteren Stücke des Weihnachts-Oratoriums darstellt.
Häufig gestellte Fragen zum Text
Wer war Johann Sebastian Bach?
Johann Sebastian Bach war ein Komponist, der am 21. März 1685 in Eisenach geboren wurde. Er verlor früh seine Eltern und fand Unterschlupf bei seinem älteren Bruder, der ihm das Orgelspielen beibrachte.
Wo arbeitete Bach?
Bach arbeitete an verschiedenen Orten, darunter Weimar, Arnstadt, Mühlhausen und Köthen. Später wurde er Thomaskantor in Leipzig.
Was sind einige von Bachs wichtigsten Werken?
Zu Bachs wichtigsten Werken gehören das "Weihnachts-Oratorium", die "h-Moll-Messe", die "Johannes-Passion" und die "Matthäus-Passion".
Was ist das Weihnachts-Oratorium?
Das Weihnachts-Oratorium ist ein Werk, das aus sechs Kantaten besteht und in den Festgottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem Epiphaniasfest aufgeführt wurde. Es erzählt die Geschichte der Geburt Jesu.
Wer hat die Texte für Bachs Werke geschrieben?
Es wird vermutet, dass Christian Friedrich Henrici, auch bekannt als "Picander", viele Texte für Bach geliefert hat, darunter auch Texte für Arien und Chöre der "Matthäus-Passion" und wahrscheinlich Teile des Weihnachts-Oratoriums.
Was ist ein Oratorium?
Ein Oratorium ist eine musikalische Kunstform, die der Oper ähnelt, aber auf den Konzertsaal oder den Kirchenraum beschränkt ist. Es besteht aus Text, Chor, Soli und Orchesterparts und verarbeitet vornehmlich religiös-mythische Stoffe.
Was behandelt das Rezitativ Nr. 20 aus dem Weihnachts-Oratorium?
Das Rezitativ Nr. 20 berichtet, dass neben dem Engel, der den Hirten die Nachricht von Jesu Geburt brachte, eine himmlische Schar das Feld erfüllte und Gott lobte.
Was ist das Chorstück "Ehre sei Gott in der Höhe"?
Das Chorstück "Ehre sei Gott in der Höhe" ist ein Teil des Weihnachts-Oratoriums, in dem die himmlischen Heerscharen Gott loben. Es ist ein lebhaftes Stück im Forte-Stil, mit einigen Abschnitten im Piano-Stil, um den Frieden auf Erden darzustellen.
Welche Instrumente werden im Orchester von "Ehre sei Gott" eingesetzt?
Das Orchester besteht aus Flöten, Oboen, Violinen, Bläsern, Orgel, Cembalo und Violoncello.
Was ist ein Rezitativ?
Ein Rezitativ ist ein Gesangsstück, dessen Text wortgetreu auf biblischen Texten beruht und meist von Solisten gesungen wird. Der Rhythmus des Gesangs entspricht der Sprachrhythmik.
Was ist die Polyphonie?
Die Polyphonie ist eine Kompositionsweise, bei der mehrere Stimmen gleichzeitig und unabhängig voneinander geführt werden, wodurch ein komplexes Klangbild entsteht. Bach war ein Meister der Polyphonie.
- Quote paper
- Daniela Balser (Author), 2001, Das Weihnachtsoratorium von J.S. Bach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100185