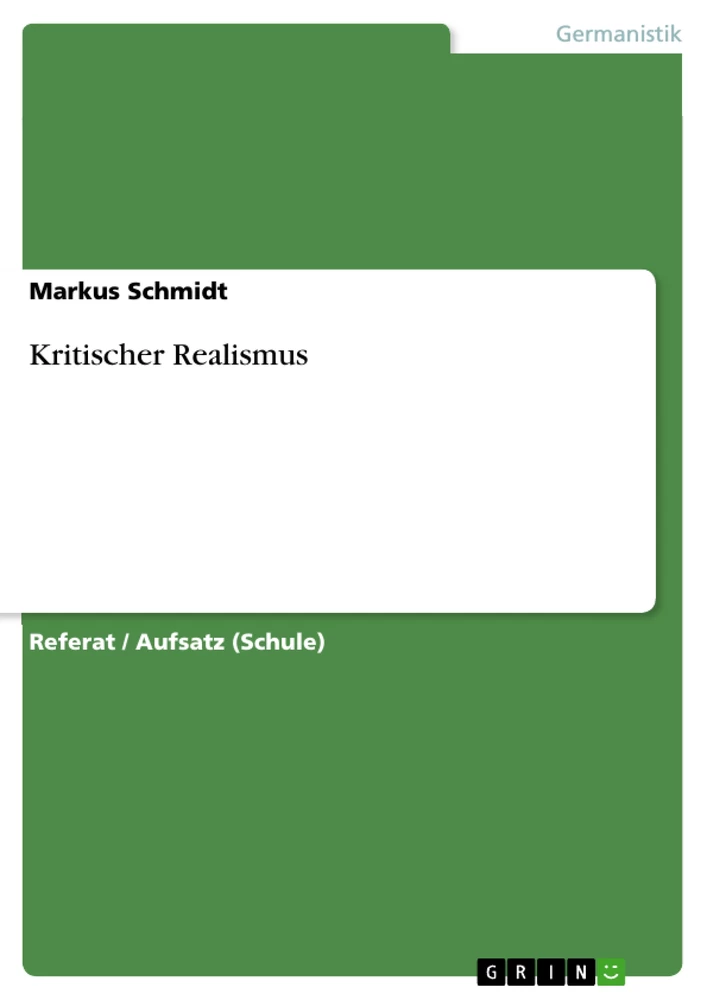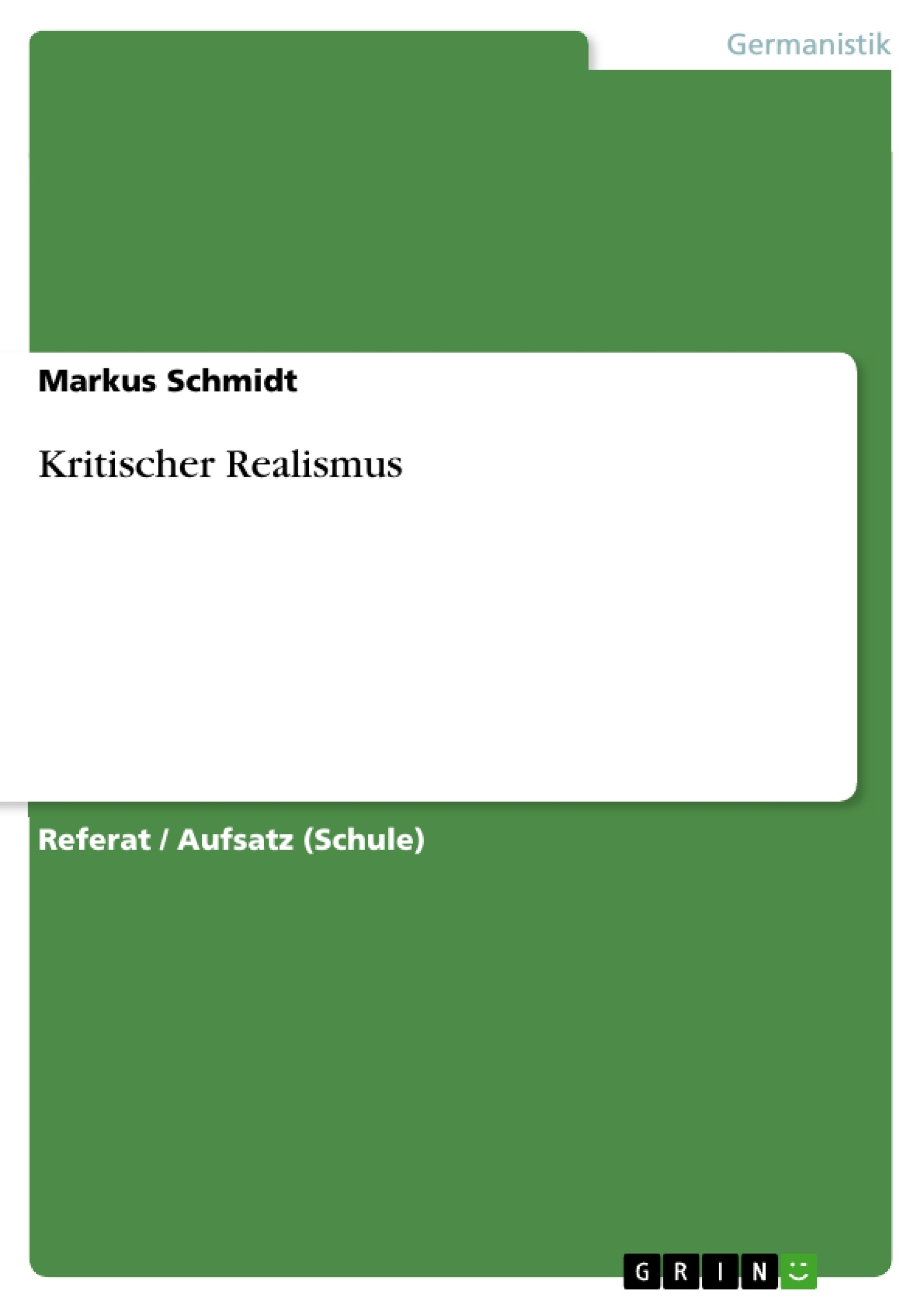Was bedeutet es, in einer Zeit des Umbruchs zu leben, in der die Ideale der Aufklärung auf die harte Realität der industriellen Revolution treffen? Diese Frage durchdringt die Werke des kritischen Realismus und des Vormärz, einer Epoche, die von politischer Unruhe und dem Aufbruch zu neuen Denkweisen geprägt war. Das vorliegende Werk nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise in das Deutschland des 19. Jahrhunderts, eine Zeit, in der Schriftsteller wie Georg Büchner und Heinrich Heine mit ihren Werken die gesellschaftlichen Missstände anprangerten und für eine gerechtere Welt kämpften. Erfahren Sie mehr über die Hintergründe des Realismus, seine philosophischen Wurzeln im Materialismus und seine Abgrenzung zur Romantik. Tauchen Sie ein in die Welt des "Jungen Deutschland", einer Bewegung, die mit ihren revolutionären Ideen die Zensurbehörden herausforderte und den Weg für eine neue literarische Strömung bereitete. Anhand von detaillierten Analysen von Büchners "Dantons Tod" und Heines politischer Lyrik werden die zentralen Themen und Motive dieser Epoche beleuchtet: die Entfremdung des Individuums, die Kritik an der herrschenden Ordnung und der Kampf für Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Entdecken Sie die Bedeutung des kritischen Realismus für das Drama des 19. Jahrhunderts und seine Auseinandersetzung mit den Konventionen der Zeit. Dieses Buch bietet Ihnen einen umfassenden Einblick in eine bewegende Epoche der deutschen Literaturgeschichte, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Es werden die Literaturverhältnisse, der Wirklichkeitsbezug und das Verhältnis zum poetischen Realismus erörtert. Die damalige Situation wird durch die Julirevolution, Zensur und die Karlsbader Beschlüsse verdeutlicht. Es wird auf die politischen Reden und Flugblätter eingegangen, sowie die Entwicklung des Romans. Die Texte von Büchner, Heine und anderen Autoren des Vormärz sind ein Spiegelbild ihrer Zeit und laden uns ein, über die Herausforderungen und Chancen des gesellschaftlichen Wandels nachzudenken. Lassen Sie sich von der kraftvollen Sprache und den provokanten Ideen dieser Schriftsteller inspirieren und entdecken Sie die Relevanz des kritischen Realismus für unsere heutige Gesellschaft. Es beinhaltet die Analyse des ,,Hessischen Landboten" und die schlesischen Weber. Tauchen Sie ein in eine aufregende Epoche der deutschen Geistesgeschichte und entdecken Sie die zeitlose Kraft der Literatur als Werkzeug des gesellschaftlichen Wandels.
Gliederung
1. Der Realismus allgemein / Eine kurze Betrachtung der Epoche
2. Zur (geistes)geschichtlichen Lage zu Beginn des 19. Jahrhunderts
3. Der ,,kritische Realismus" in der Literatur am Beispiel des Vormärz
3.1. Literaturverhältnisse
3.2. Kritischer Realismus und Wirklichkeitsbezug
3.3. Das ,,Junge Deutschland"
3.4. Das Verhältnis zum ,,poetischen Realismus"
4. Das Drama des 19. Jahrhunderts
5. Literarische Vertreter des kritischen Realismus / des Vormärz
5.1. Georg Büchner
5.1.1. "Der hessische Landbote"
5.1.2. "Dantons Tod"
5.2. Heinrich Heine
6. Quellenangabe
1. Der Realismus allgemein / Eine kurze Betrachtung der Epoche
Das 19.Jahrhundert ist durch zwei Strömungen geprägt. Zum einen durch den aufkommenden Nationalismus als Folge der napoleonischen Befreiungskriege und dem von Südamerika kommenden ,,politischen Liberalismus"; politisch sichtbares Zeichen ist die Entstehung der Nationalstaaten. Geistesgeschichtlich drückt sich diese Strömung im philosophischen Idealismus und der Romantik mit ihrer Rückbesinnung auf das deutsche Mittelalter aus. Auf der anderen Seite steht die industrielle Revolution mit all ihren Folgen: der Entstehung des Manchestertums und der Trade Unions in England, die Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiter und die Entstehung der Arbeitervereine in Deutschland, dem Niedergang des Handwerks aufgrund steigender Technisierung und der Entstehung und Verarmung des Proletariats.
Daraus ergibt sich eine gleichzeitige Vielfalt an literarischen Strömungen in dieser Epoche. Der Realismus, dessen Beginn bei ca. 1830 festgelegt wird und in Literatur sowie in Bildender Kunst bis in das 20.Jahrhundert hineinreicht, vereinigt den literarischen Vormärz, zu dem auch die politische Tendenzdichtung gehört, und den poetischen Realismus, dessen Blüte in den Jahren von 1840-1870 liegt und dessen Vertreter nicht mehr so radikal, fordernd und sarkastisch erscheinen.
Der Realismus versteht sich als Bewegung ohne feste Konturen und ohne theoretische und stilistische Geschlossenheit.
Die Realisten gehen von einer Orientierung an der objektiven Realität, d.h. der materiellen Welt außerhalb des menschlichen Bewusstseins, aus und nicht von der gedanklich- subjektiven.
Schon bei den antiken Griechen Aischylos, Sophokles, Euripides findet man realistische Züge.
Will man die Aussageabsicht der Realisten möglichst banal beschreiben, ist es die Darstellung und Kritik der zeitgenössischen Wirklichkeit im Hinblick auf eine ständige Bewegung in der Geschichte. Dies bedeutet eine schonungslose Analyse, bei der jegliche Idealisierung vermieden werden sollte.
2. Zur (geistes)geschichtlichen Lage zu Beginn des 19.Jahrhunderts
Das beginnende 19. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch das Vordringen des liberalen Gedankengutes, dessen geistiger Vater z.B. die Französische Revolution gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war. Hinzu kommt das Missverhältnis der romantisch-phantastischen Naturphilosophie und der exakten Naturwissenschaft.
Zunehmende Technisierung und der Wirtschaftsboom, die insbesondere von England her Zugang in Zentraleuropa fanden, entwurzelten und unterjochten die Industriearbeiterschaft. Außerdem ist im 19.Jahrhundert ein enormer Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen - die Bevölkerungszahl stieg von 25 Mio. (1820) auf 65 Mio. (1920). Karl Marx und Friedrich Engels gewannen mit ihren Ideen das Proletariat für sich; diese internationalisierten die Arbeiterschaft ebenso wie die aus ihrem Gedankengut entstandenen Parteien SPD und KPD, sodass sich bald sozialistische und nationale Parteien feindlich gegenüberstanden. Der Adel, der durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 seinen Anteil an der Regierung fast vollständig eingebüsst und der durch die Stein-Hardenbergischen Gesetze (Aufhebung der Leibeigenschaft) seine Herrenstellung auf dem Lande verloren hatte, besaß dennoch manche Vorrechte.
Dem Wiener Kongress 1814/15 kommt zudem auch eine enorme historische Bedeutung zu. Auf dem ersten gesamteuropäischen Kongress der neueren Geschichte wollte man eine Friedensordnung für Europa nach den napoleonischen Kriegen und stabile politische Verhältnisse schaffen. Dies geschah konkret mittels Unterstützung und Restauration der Monarchien und der Solidarität der Fürsten gegen revolutionäre Strömungen. Auf deutschem Gebiet entstand ein Fürstenbund von 35 Einzelstaaten, über den Österreich das geschäftsführende Präsidium innehatte.
Nirgends beschäftigte man sich mit der Frage der Staatsverfassung so gründlich wie in Frankreich, wobei man auf die Gedanken Voltaires und Rousseaus zurückgriff. Dabei bildeten sich europaweit vier Richtungen heraus: Die Reaktionäre, die die Verfassung zurückbilden wollten, die Konservativen, die danach strebten, die bestehenden Verfassungen zu bewahren, die Liberalen, die sie erweitern und die Radikalen, die sie durch eine Revolution beseitigen wollten.
Als der reaktionäre französische König Karl X., unterstützt von Adel und Kirche, im Jahre 1830 u.a. das eben gewählte Parlament auflöste, in dem die Liberalen die Mehrheit hatten, das Wahlrecht beschnitt und die Pressefreiheit aufhob, kam es in Paris zu einer Revolution (,,Julirevolution"). Bürgerliche, Intellektuelle und Arbeiter kämpften gemeinsam und setzten Louis Philippe als neuen König (,,Bürgerkönig") ein. Er regierte nach dem Prinzip der parlamentarischen Monarchie.
In Frankreich hatte das Finanzbürgertum gesiegt und ihr ,,Bürgerkönigtum" errichtet; soziale Not führte zu ersten Aufständen der Lohnarbeiter z.B. in Lyon. In England hatte die industrielle Revolution ihren Höchststand erreicht.
Auch in Deutschland belebte sich unter Einfluss der Pariser Ereignisse die politische Szene, so dass es Anfang der dreißiger Jahre zu Aktionen und Artikulationen politischer Programme kam. Man solidarisierte sich mit den Aufständischen im Ausland. Politisches Ziel der bürgerlichen Opposition war es, den 1815 durch den Wiener Kongress gegründeten Deutschen Bund (35 z.T. von ausländischen Fürsten gelenkte Territorien und 4 Freie Städte, insgesamt 39 Obrigkeiten) in einen deutschen Nationalstaat umzuwandeln und den aristokratischen Machtapparat zu beseitigen.
Der Deutsche Bund- sein einziges Organ war der Bundestag in Frankfurt- war ein föderalistisches Bündnis unter Fürsten, in dem sich die Regierungen einander ihre Selbständigkeit und Herrschaft garantierten. Nur in Sachsen-Weimar, Bayern, Württemberg und Hessen-Darmstadt kamen Verfassungen zustande, die immerhin die Entwicklung eines bescheidenen politischen Lebens ermöglichten.
Die 1819 von der ,,Heiligen Allianz" der Fürsten erlassenen Karlsbader Beschlüsse ,,zur Untersuchung demagogischer und revolutionärer Umtriebe" waren das eigentliche Grundgesetz des Bundes: eine Handhabe zur Unterdrückung jeglicher politischer Regung mittels Zensur, Verboten und Überwachungen durch Polizei und die ,,Zentraluntersuchungskommission".
Die politische Struktur stand im Widerspruch zur wirtschaftlichen Entwicklung. Das mit dem wirtschaftlichen Erstarken gewachsene Klassenbewusstsein des Bürgertums trat von Anfang an mit dem Anspruch nationaler Interessen auf. Dabei war vorausgesetzt, dass die Forderung nach einem Nationalstaat ungehemmte Erwerbstätigkeit einschloss.
Ebenso charakteristisch für die bürgerliche Opposition ist das Vertrauen in die politisch- publizistische Aufklärung als Mittel der Veränderung gesellschaftlicher Zustände. Man forderte Pressefreiheit, die Aufhebung des Verbots, in Zeitungen und Journalen über politische Angelegenheiten zu berichten und zu ihnen Stellung nehmen zu können. Als Antwort des von Metternich gesteuerten Deutschen Bundes folgten bald weitere Unterdrückungsmaßnahmen.
Sie besagten die Verschärfung der Zensur, die Auflösung aller politischen Vereine, die Überwachung der Universitäten, das Verbot von öffentlichen Reden, Versammlungen und Volksfesten.
Heinrich Heine schrieb in seiner Vorrede zu den ,,Französischen Zuständen":
,,Nie ist ein Volk von seinen Machthabern grausamer verh öhnt worden. Wenn ihr aber auch mit Zuversicht auf knechtische Unterwürfigkeit rechnen durftet, so hattet ihr doch kein Recht, uns für Dummk öpfe zu halten,... ein Volk, welches das Pulver erfunden hat und die Buchdruckerei und die >Kritik der reinen Vernunft<. Diese unverdiente Beleidigung, dass ihr uns für noch dümmer gehalten, als ihr selber seid, und euch einbildet, uns täuschen zu können, das ist die schlimmste Beleidigung, die ihr uns zugefügt in Gegenwart der umstehenden V ölker..."
(H. Heine: Französische Zustände; Werke und Briefe in zehn Bänden, Bd. 4, S.370)
Innerhalb weniger Jahre emigrierten ca. hundertachtzigtausend Menschen, darunter auch viele Schriftsteller, z.B. HEINE, BÜCHNER, HERWEGH, MARX, FREILIGRATH, WEERTH. Die gescheiterte bürgerliche Revolution von 1848 führte einen Rückzug des Bildungsbürgertums von der politischen Szene herbei, was zum Ende der Epoche des kritischen Realismus führte. Nachfolgende Schriftsteller finden im poetischen Realismus ihre literarische Heimat.
3. ,,Der kritische Realismus" in der Literatur am Beispiel des Vormärz
3.1. Literaturverhältnisse
Die weltgeschichtlichen Ereignisse seit der Revolution von 1789 und die wesentlichen weltanschaulich-philosophischen Schlussfolgerungen daraus finden bei den Schriftstellern des kritischen Realismus enorme Beachtung, besonders jene Erfahrung, dass die Geschichte der Menschheit durch die Französische Revolution nicht zu größerer Vollkommenheit fortgeschritten war, dass ,,Freiheit" und ,,Gleichheit" weder erkämpft, noch in realer ,,Brüderlichkeit" aufgegangen waren.
Diese Erkenntnis war von deprimierender Wirkung; sie spiegelt sich in der gesamten europäischen Literatur wider.
Aufgrund dieser Erfahrungen blieben die großen Schriftsteller des 19.Jahrhunderts bemüht, die Stellung des Menschen in einer neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit auszuloten. Eine zeittypische Reaktion auf die geschichtliche Desillusionierung war der ,,Weltschmerz", jenes noch romantische und doch schon in Gesellschaftskritik und Politisierung umschlagende Leiden an einer Wirklichkeit, in der sich erträumte Ideale nicht erfüllt hatten. Heine erfasste die geschichtliche Situation: ,,Die sch önen Ideale von politischer Sittlichkeit, Gesetzlichkeit, Bürgertugend, Freiheit und Gleichheit, die rosigen Morgenträume des achtzehnten Jahrhunderts,..., da liegen sie nun zu unseren F üß en, zertrümmert, zerschlagen, wie die Scherben von Porzellankannen, wie erschossene Schneider..."
(H. Heine: Brief vom 13.2.1852; Werke und Briefe in zehn Bänden, Bd.9)
In den europäischen Ländern, in denen sich der Kapitalismus durchgesetzt hatte oder sich durchzusetzen begann, wurde die Unvereinbarkeit von humanistischem Ideal und Wirklichkeit, die daraus folgende Verwandlung der Illusion in Desillusion zum unterschiedlich aufgenommenen und gestalteten Thema der Literatur. Aktivistische Literaturprogramme unterschiedlicher Radikalität sollten helfen, die aufgekommenen politischen und sozialen Probleme zu lösen.
Die industrielle Revolution führte zu technischen Neuerungen, die eine rapide Steigerung der Buch- und Zeitschriftenproduktion nach Titeln und Auflagen ermöglichten. Die Schnelldruckpresse (1911 von F. König erfunden) steigerte die Druckkapazität bis 1840 um mehr als das Zehnfache gegenüber dem Handdruckverfahren; die dampfbetriebene Papiermaschine (1818) verdoppelte die Produktion; 1843 begann man Papier aus Holz und nicht wie bisher nur aus Textilien herzustellen. Nicht zuletzt bewirkte das rasch wachsende Eisenbahnnetz einen schnelleren Buch- und Zeitschriftentransport.
Dies alles begünstigte das Entstehen großer Verlagsunternehmen, die das Buch für breitere und neue soziale Schichten erschwinglich machten.
Beim Absatz von Literatur waren große Veränderungen vorgegangen; der Hang zum Lesen war tiefer in die Bevölkerung vorgedrungen. Dazu hatte z. T. die Schulpflicht beigetragen, die in fast allen deutschen Territorien seit Anfang des Jahrhunderts bestand. Das Bildungswesen spielte allerdings eine zwiespältige Rolle. Humboldts Bestrebungen blieben, wie das Werk anderer preußischer Reformer, ein Teilerfolg; sie wirkten sich vor allem auf die neuhumanistischen Gymnasien und die sog. ,,Realschulen" aus, die Elementarschulen blieben davon fast unberührt. Die Schulzeit sah hier recht trist aus. Schlechtbezahlte Lehrer, überfüllte, meist einklassige Schulen vermittelten ein ,,Bildungsniveau", das über die elementare Lese-, Schreibe- und Rechenfähigkeit kaum hinausging (nur wer keine Buchstaben schreiben und Worte buchstabieren konnte, wurde in die Rubrik ,,ohne Schulbildung" eingestuft). Die Kinder der Arbeiter, Tagelöhner, Kleinbauern mussten für den Unterhalt der Familie aufkommen und konnten teils gar nicht, teils nur unregelmäßig am Unterricht teilnehmen.
In Städten und Fabriken wurden deshalb Abend-, Sonntags- und Feiertagsschulen eingerichtet, welche die Kinder nach elf- bis vierzehnstündiger Arbeit (!) besuchen durften oder sogar sollten.
Bei allen Einschränkungen war der allgemeine Schulzwang eine der Vorraussetzungen für eine breitere gesellschaftliche Wirksamkeit der Literatur.
Die Karlsbader Beschlüsse hatten für sämtliche Zeitungen und Zeitschriften sowie für alle Druckschriften unter zwanzig Bogen (=320 Seiten) die Vorzensur verordnet. Am strengsten kontrolliert wurden Zeitungen und Zeitschriften, u.a. durch Änderungen und Streichungen im Text. Verbote wurden von den Landesregierungen verhängt und galten nur für das betreffende Territorium, was Ausweichmöglichkeiten bot. Viele Autoren waren jedoch gezwungen, unter einem Pseudonym zu schreiben oder zu emigrieren. Eine weitere Zensur ergab sich aus der Vorschrift, dass jedes fertige Druckerzeugnis erst nach Freigabe und einer vorgeschriebenen Wartezeit auf den Markt gebracht werden durfte. Unabhängig davon konnte jedes bereits erschienene Buch eingezogen oder verboten werden. Manche Verleger profitierten zuweilen von dem Verbot eines Buches, weil dies die wirksamste Werbung war. Die Unterdrückung und Verfolgung der fortschrittlichen Literatur hemmte die freie Entfaltung des Verhältnisses von Schriftsteller zum Publikum, zumal viele Schriftsteller ins Exil gezwungen wurden. Ihre Abwanderung schwächte zwar die deutschen oppositionellen Gruppen, ermöglichte jedoch ein Einwirken von außen, u.a. durch Exilzeitschriften und Exilverlage, die ihre Produktion nach Deutschland einschleusten.
3.2. kritischer Realismus und Wirklichkeitsbezug
Als Ausgangspunkt für das Schaffen der Realisten muss ein genau bestimmtes Geschichtsund Wirklichkeitsbild betrachtet werden. Danach ist jede Kunst realistisch, ,, die zunächst darauf ausgeht, die Dinge in ihrer wesenhaften Realität zu geben, Welt und Menschen, Natur und Leben so darzustellen, wie sie sich ihrem Wesen und ihrer Idee, ihrer Seele und ihren Charakter nach offenbaren,..."
(Sigisbert Meier: Der Realismus als Prinzip der schönen Künste, S.9)
Der Realismus mit seiner objektiven Darstellung des Zeitgenössischen ist ferner gekennzeichnet durch Gottferne (Atheismus), Entfremdung und Zusammenhangslosigkeit, die sich in allegorischer, satirischer oder grotesker Darstellungsweise widerspiegeln. In der realistischen Literatur geht es nicht um Versöhnung oder Einheit, sondern vielmehr um deren Versagen und um den endgültigen Verlust von Gott, Idee oder Sinn, an deren Stelle das Nichts getreten ist.
Für den Realisten ist der Mensch deshalb ein Narr, der verloren ist in der bösen Welt; das Leben bedeutet ständig neue Desorientierung.
Der Realismus ist didaktisch, lehrhaft und reformierend und will die historische Wirklichkeit sittlich und ästhetisch interpretieren bzw. künstlerisch bewältigen.
Im Gegensatz zur Romantik ist es die Intention der realistischen Dichtung, in Stoffen und Formen, Themen und Problemstellungen, die Grenzen zu berücksichtigen, die dem Menschen im Rahmen seiner Erfahrungswelt gegeben sind. Die Realisten schildern den realen Alltag, soziale Begebenheiten, sowie die damals aktuelle politische Situation. Der Mensch als Individuum wird einer kritischen Betrachtung unterzogen; beschrieben werden seine Interessen, sein Verhalten, seine Gefühle. Charakteristisch für literarische Werke des Realismus ist das Aufgreifen von krassen Gegensätzen oder extremen Situationen. Diese sehr handlungsorientierte Literatur bezieht sich immer auf ihre Gegenwart; unterschiedlichste Motive werden verarbeitet, wobei sich mit ihnen direkt auseinandergesetzt wird.
Die Exaktheitsforderung der Realisten führt zu einer dem Detail zugewandten Wirklichkeitsdarstellung.
Durch eine deutliche, scharfe, derbe Sprache oder durch Ironie und Sarkasmus formulieren die Schriftsteller ihre kritischen Gedanken oft sehr treffend. Realisten spielen mit der Sprache und verwenden diese sehr bildhaft und anschaulich.
Sie bringen so z.B. ihre Ablehnung des platten spießbürgerlichen Alltags oder ihre Kritik am nackten Profitinteresse des Finanzbürgertums zum Ausdruck.
Als philosophische Basis dient, nicht wie in der Romantik der Idealismus, sondern der Materialismus.
Alle Erscheinungen der Natur und des Geistes werden auf materielle Vorgänge zurückgeführt. Der Materialismus verneint deshalb die Existenz Gottes; er geht davon aus, dass das greifbar wirklich Gegebene das Wesentliche ist und nicht wie im Idealismus das hinter ihm verborgene Sein.
Aus dem Studium der Geschichte und der Betrachtung der wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten schlussfolgert man, dass die Existenz des Menschen sein Bewusstsein bestimmt. ,,Man ist ein Kind seiner Zeit."
Die Literatur bekommt eine ausdrücklich gesellschaftliche Funktion; sie soll politische, pädagogische Ideen vermitteln. Dazu besinnt man sich auf rhetorisch gute und öffentlich wirksame Literaturformen; so werden unterschiedliche Stilformen je nach Publikum und Wirkungsabsicht angewandt: in Beschreibungen stehen Predigteinlagen wie z.B. in J.GOTTGELFs Dorfgeschichten; abstrakte Reflexionen unterbrechen Erzählungen wie in H.HEINEs Reisebildern.
Das literarische Genregefüge, die Stoffwahl und Schreibweise entfernten sich von den klassischen Kunstidealen. Die Verbindung von populärer Form und aufklärend - politischem Inhalt erwies sich als literarisches Schießpulver. Die oppositionellen Schriftsteller wählten v.a. solche Genres und Formen, die in Journalen Platz fanden, sich zum Ideenschmuggel eigneten und eine breite Publikumswirksamkeit versprachen: das Feuilleton, den Bericht, die Novelle, den Roman, die Reise- und Memoirenliteratur, die Rezension, ... Von der Prosa vor allem - weniger von der Lyrik und nicht von der Dramatik - versprach man sich politisierende Wirkung. So zeigt die Prosa der dreißiger Jahre insgesamt ein stark reflexionsbeladenes Gepräge. Sie folgt, wie die Prosa der Romantiker, keinen vorgegeben Gattungsmerkmalen, lässt diese vielmehr verschwimmen, ist formlos und subjektiv aus Absicht: ein Gestrüpp zur Täuschung der Zensur und zum Versteck subversiver Ideen. Die experimentelle Methode der Schriftsteller unterstützt das Beobachterverhalten der Leser; sie sind aufgefordert den Text zu entschlüsseln.
Enorme Bedeutung kommt in dieser Zeit auch den politischen Reden und Flugblättern zu. Flugblätter oder Flugschriften sind publizistische Mittel sozial unterprivilegierter Gruppen, denen andere Mittel gesellschaftlicher Kommunikation nicht zur Verfügung stehen. Sie dienen zur Meinungsäußerung und sind ein konkreter Aufruf zum Handeln. Auch die literarische Gattung des Romans entwickelt sich weiter. An Stelle des ,,Romans des Nacheinanders" trat der ,,Roman des Nebeneinanders"; im Mittelpunkt steht nicht mehr nur ein einziger Protagonist, sondern das gesamte zeitgenössische Leben - Individuen werden in einem vielgestaltigen Zeitabschnitt unter die Lupe genommen. Die Romanhandlung wechselt oft den Schauplatz, was die Vielschichtigkeit des Lebens untermalt.
Das Selbst- und Literaturverständnis der Schriftsteller war v.a. politischer Art: Er sei ,, ein Vorkämpfer der jungen oder neuen Zeit ..., es gebe nichts H öheres, als die Gegenwart zu begreifen, um sich ihr handelnd für alle Zukunft zu widmen ..."
(Conversationslexikon der Gegenwart. Leipzig 1838/1841; Bd.4, S.460-461)
BÜCHNER kam über revolutionäre Aktionen überhaupt erst zur Literatur; auch HEINE forderte vom Schriftsteller, er müsse ,,Künstler, Tribüne und Apostel" in einem sein. BÖRNE verpflichtete sich ausschließlich der Politik.
Der Schriftsteller dieses neuen Typs ist v.a. Journalist, zumindest jemand, der mit Journalenals Herausgeber, Redakteur, Autor- zu tun hat. Er strebt nicht nach >ewiger Poesie<, er will die neuen Zeitideen öffentlich machen.
3.3. Das ,,Junge Deutschland"
Als Folge restaurativer Unterdrückung waren nach 1830 in mehreren europäischen Staaten politische Bünde entstanden (,,Junges Polen", ,,Junges Irland", u.a.). Die jungdeutsche Bewegung, ein lockerer Zusammenschluss von Literaten, z.B. HEINE, GUTZKOW, LAUBE, WIENBARG, MUNDT, KÜHNE, führte die Ansätze der bisherigen Dichtung fort. Charakteristisch sind eine in die Tagespolitik eingreifende Literatur und zahlreiche neue publizistische Formen, wie die agitatorische Lyrik von GEORG HERWEGH, F.FREILIGRATH und A.H.H. von FALLERSLEBEN oder das politische Feuilleton von H.HEINE.
1835 wurden sämtliche ihrer Schriften verboten. Ein Dekret des Deutschen Bundes verpflichtete alle Regierungen, ,,gegen die Verfasser, Verleger, Drucker und Verbreiter der Schriften der unter der Bezeichnung, das ,Junge Deutschland' oder die ,Junge Literatur', bekannten literarischen Schule die Straf- und Polizeigesetze ihres Landes ,,, nach ihrer vollen Strenge in Anwendung zu bringen, auch die Verbreitung dieser Schriften ... mit allen ihren gesetzlich zu Gebote stehenden Mitteln zu verhindern". Die Begründung lautet: Das Junge Deutschland sei bemüht, ,,die christliche Religion auf die frecheste Weise anzugreifen, die bestehenden sozialen Verhältnisse herabzuwürdigen und alle Zucht und Ordnung zu zerst ören". (10.12.1835)
Der Schlag traf ein. Er unterband den Versuch oppositioneller deutscher Schriftsteller, sich zu organisieren. Die rückhaltlose Hinwendung zur Gegenwart, die verwässerte Aufnahme sozialistischer Ideen, die schockierende Offenheit, mit der sie sexuelle und andere Zeitfragen (Juden- und Frauenemanzipation) behandelten, die Bejahung der neuen Technik usw., all das ließ die Jungdeutschen als Fürsprecher der Befreiung von gesellschaftlichen und moralischen Zwängen erscheinen. Aber sie waren keine Revolutionäre, sondern liberale Fortschrittler, die, an den Aufklärungsoptimismus des 18.Jahrhunderts anknüpfend, an ein Fortschreiten im Bewusstsein durch gezielten Einsatz neuer, moderner Ideen, durch Aktualität oder Abstoßung von Traditionen glaubten.
Da die Zensur direkte politische Äußerungen in der Presse verhinderte, machten sie die Prosa zu ihrem Mittel, vor allem Roman und Novelle zu Organen ihrer Debatten über Kunst, Religion, Philosophie und Literatur.
Die Hauptleistung des ,,Jungen Deutschland" lag in dem Wiederbeleben der Kritik, in dem Streben nach geistiger Erneuerung und dem Kampf gegen das politische Erstarren.
3.4. Das Verhältnis zum ,,poetischen Realismus"
Nicht immer folgen politischen Ereignissen unmittelbare Veränderungen in der Literatur. Die Niederlage der revolutionären Bewegung 1848/49 leitete jedoch einen tiefgreifenden Wandel nicht nur in der Literatur, sondern im gesamten geistigen und politischen Leben der Gesellschaft ein. So setzte in der Literatur mit der Zerschlagung der revolutionären Bewegung und der erneuten politischen Entmündigung des Bürgertums ein rapider Schwund der weltliterarischen Bedeutung ein. Erst mit den Werken des späten FONTANE fand sie wieder Anschluss an die europäische literarische Entwicklung.
Die Schriftsteller des poetischen Realismus kamen zu einem neuen Verständnis der Literatur, für das nicht mehr das Eingreifen in öffentliche Angelegenheiten im Mittelpunkt stand, sondern die Bewahrung der humanen Persönlichkeit.
Die führenden Autoren der Zeit nach 1849, die Prosaschriftsteller, begriffen sich als Realisten. Sie verfolgten jedoch eine besondere Form realistischer Schreibweise und Theorie, den ,,Poetischen Realismus", dessen Ansätze schon im Vormärz zu verzeichnen waren. Das Programm des nachrevolutionären poetischen Realismus zielte nicht, wie schon gesagt, auf eine schonungslose Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit, sondern auf die ,,Mitte zwischen der objektiven Wahrheit in den Dingen und dem, was unser Geist gezwungen ist, hineinzulegen. Die poetischen Realisten schildern Lebensbereiche nichtentfremdeten menschlichen Daseins, ohne deren Zerstörung unnachsichtig zu kritisieren. In ihrem Werk findet man jedoch noch immer ein ständiges Miteinander poetisch-realistischer und kritisch-realistischer Züge, wenn auch die Grundsätze des poetischen Realismus überwiegen.
Waren im Vormärz Weltschmerz, Ironie und Satire vorherrschend, so wurde jetzt, mit der Wendung zum Objektiven, das tendenziös Politische verworfen. Als dominierendes literarisches Gestaltungsprinzip des poetischen Realismus gilt der Humor. Er kann als versöhnendes Element eingesetzt werden, zugleich jedoch auch als Mittel der Distanzierung; er kann sich, wie bei RAABE oder FONTANE, zur Ironie verschärfen. Die Novelle erlebt in der Epoche des poetischen Realismus eine beachtliche Blüte. Man muss natürlich von einem Weiterwirken des Vormärz in der poetisch-realistischen Dichtung sprechen; der Einfluss eines H.HEINE ist z.B. kaum zu übersehen. Wohl setzten sich die poetischen Realisten nicht für die Arbeiterschaft oder die schlesischen Weber ein, aber dort, z.B. in seinen Reisebildern, wo sich seine Interessen mit denen der poetischen Realisten überlagern, kann HEINE gewissermaßen als Vorbild dienen. Die poetischen Realisten lehnen den Detailrealismus ihrer Vorgänger ab, und umgekehrt akzeptieren sie die Mittel eines HEINE, ohne sich seinen Werten und Zielen anzuschließen. Sie nehmen sich die Freiheit alles in ihr Kunstwerk aufzunehmen und ebenso alles Nichtpassende oder Zufällige aus einem Kunstwerk auszuschließen. Ihre Themen sind weitgefasster, doch ihre Sprache weit weniger derb und sarkastisch.
4. Das Drama des 19. Jahrhunderts
Aus der Romantik hervorgegangen war die Gattung der ,,Schicksalsdramen", die nur noch äußerlich an die Idee der klassischen Schicksalstragödie anknüpft. Das Schauspiel kommt dem Bedürfnis nach Sensation, nach einer Abkehr von dem pathetisch-sittlichen Ernst der klassischen Tragödie, den man in der Gegenwart nirgendwo findet, und nach Bühnenwirksamkeit entgegen. Man versteigt sich auch ins Mythisch-Heroische und kostümiert große historische Ereignisse, und immer wieder sind Rühr- und Familienstücke zu sehen, in denen banale Alltäglichkeiten zu moralisch-edelmütigen Szenen aufgedonnert werden. Dies bedeutet eine Flucht vor der gesellschaftlichen Misere in eine fiktive, weitgehend problementleerte Theaterwelt.
Die Schicksalstragödie ist eine Theatermode, die von ,,ernsten" Dichtern ergebnislos mit der damals allgemein beliebten Methode der Parodie bekämpft wurde.
Die Bühnen zu Beginn der dreißiger Jahre - entweder Hof- oder Vorstadttheater - bieten getrennte Spiele für ,,die Oberen" und für das Volk. Beide erweisen sich überwiegend als ungeeignet, künstlerische Ansprüche durchzusetzen; sie folgen entweder eigenen Interessen oder sind dem Geschäft ausgeliefert.
Der einzig große Dramatiker des Jahrhundertbeginns, Kleist, war unbeachtet geblieben. Was ist von solchen Bühnen für GRABBE, BÜCHNER, HEBBEL oder GRILLPARZER zu erwarten, Autoren, die, im historischen oder Gegenwartsstoff, zeitgenössische gesellschaftliche Probleme realistisch zu gestalten versuchten.
Der künstlerisch anspruchsvolle Dramatiker des Vormärz steht vor der Alternative, wenn nicht ,,Lesedramen", so doch Dramen zu schreiben, die allenfalls gelesen, jedoch nicht gespielt werden, oder Lieferant von konventionellen Stücken zu sein. GRILLPARZERs Rückzug vom Theater und die Nichtbeachtung BÜCHNERs sind dafür Beispiele. Diese blamable Situation forderte eine Debatte, die Formulierung künstlerischer Forderungen an Bühne und Dramatik heraus, zumal den meisten Autoren des Realismus das Drama als höchste literarische Gattung galt.
Die Diskussion kreist v.a. um das politische Theater und das aktuelle Zeit- und Tendenzstück. Als Ergebnis der Debatten entsteht schließlich eine sogenannte Kompromissdramaturgie: ein Produkt sowohl staatlicher Restriktionen als auch der Unausgereiftheit gesellschaftlicher Zielvorstellungen.
Diese war für manchen Autor, der wie HEBBEL oder GRILLPARZER nach der künstlerischen Einheit von Idee und Gestaltung strebte, nicht akzeptabel.
Viele Dramen entstanden in dieser Zeit, die jedoch kaum oder erst viel später Beachtung fanden.
5. Literarische Vertreter des kritischen Realismus/des Vormärz
5.1. Georg Büchner 1813-1837
Am 17. Oktober 1813 wird Georg Büchner in Goddelau bei Darmstadt geboren. Er studiert Medizin und Naturwissenschaften, erst in Straßburg und dann in Gießen. Büchner ist begeistert von der Julirevolution 1830; er gründet 1834 nach französischem Vorbild die ,,Gesellschaft der Menschenrechte". Nach der Flugschrift ,,Der hessische Landbote" (1834) und nachdem die Organisation verraten worden war, kehrte Büchner in sein Elternhaus zurück, agierte aber immer noch für die Revolution. In dieser Zeit entstand das Drama ,,Dantons Tod", die einzige Dichtung, die zu seinen Lebzeiten veröffentlicht wurde. Dem steckbrieflich Verfolgten gelang die Flucht nach Straßburg. Hier und ab 1836 in Zürich begann er, als Privatdozent an der philosophischen Fakultät, eine überaus fruchtbare wissenschaftliche und literarische Tätigkeit: er beendete seine Dissertation, schrieb das Lustspiel ,,Leonce und Lena" (1836), die Novelle ,,Lenz" (gedr.1839), den ,,Woyzeck", uvm. Büchner starb am 21.Februar 1837 im Alter von 23 Jahren an einer Typhusepidemie.
5.1.1. ,,Der hessische Landbote"
Im Jahre 1834 verfasste Büchner die Flugschrift ,,Der hessische Landbote". Sie hatte den Zeck, den Bauern ihre unerträgliche Lage bewusst zu machen.
Die Losung der Französischen Revolution aufnehmend verkündet Büchner den Hütten Frieden und den Palästen Krieg. Statt über Verfassungsfragen zu sprechen, argumentiert er mit einer Statistik, die den Bauern vorrechnet, was ihnen abgepresst wird. Er appelliert an die materiellen Interessen und der Gerechtigkeitssinn der Ausgeplünderten und Besitzlosen:
,,Geht einmal nach Darmstadt und seht, wie die Herren sich für euer Geld dort lustig machen, und erzählt dann euern hungrigen Weibern und Kindern, dass ihr Brot an fremden Bäuchen herrlich angeschlagen sei ... ,, (G. Büchner: Dichtungen; Der hessische Landbote, S.180)
Der zweite Teil der Schrift skizziert den Geschichtsprozess zwischen 1789 und 1830, aus dem Büchner die Notwendigkeit einer Revolution ableitet. Die soziale und politische Analyse verbindet sich in seiner Flugschrift mit dichterischem Wort. Präzises Zahlenmaterial unterstützt seine Beweisführung; die Flugschrift ist ebenfalls mit zahlreichen Gleichnissen, Metaphern und Gleichnissen gespickt. Die Bauern werden in leidenschaftlichen, sich auf ihre Erlebnis- und Denkweise beziehenden, biblischen, archaischen Sprache angeredet: ,,Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag: sie wohnen in sch önen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache; das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker ... Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag ... sein Leib ist eine Schwiele, sein Schwei ß ist das Salz auf dem Tische der Vornehmen ... Hebt die Augen auf und zählt das Häuflein eurer Presser, die nur stark sind durch das Blut, das sie euch aussaugen, und durch eure Arme, die ihr ihnen willenlos leiht. Ihrer sind vielleicht 10 000 im Gro ß herzogtum und eurer sind es 700 000, und also verhält sich die Zahl des Volkes zu seinen Pressern auch imübrigen Deutschland.
Wohl drohen sie mit dem Rüstzeug und den Reisigen der K önige, aber ich sage euch: Wer das Schwert erhebt gegen das Volk, der wird durch das Schwert des Volkes umkommen ..."
(G. Büchner: Dichtungen; Der hessische Landbote, S.175/176, S.186)
5.1.2. ,,Dantons Tod"
In der Geschichte der deutschen dramatischen Literatur markieren Büchners Stücke eine neue Entwicklungsstufe: die Überwindung des klassischen und romantischen Dramenmodells durch Stücke, die nicht ,,Marionetten mit himmelblauen Nasen und affektiertem Pathos", sondern ,,Menschen von Fleisch und Blut" vorführen.
(G. Büchner an die Familie. Brief v. 28.7.1835; Werke und Briefe, S.422)
Epochal neu ist die Durchleuchtung sozialer Widersprüche. Um den Wahrheitsgehalt seiner Erkundungen zu stärken, benutzte Büchner sowohl für den ,,Danton", als auch für den ,,Woyzeck" Quellen und historisch-biographische Beschreibungen; ein früher Vorstoß zum Dokumentarischen im Drama.
Die Geschichte der Französischen Revolution lieferte den Stoff für ,,Dantons Tod". Nach ihrem Studium bekannte er: ,, Ich fühle mich vernichtet unter dem Fatalismus der Geschichte... der Einzelne nur Schaum auf der Welle, die Gr öß e ein blo ß er Zufall, die Herrschaft des Genies ein Puppenspiel, ein lächerliches Ringen gegen ein ehernes Gesetz, er zu erkennen das H öchste, es zu beherrschen unm öglich...".
(G. Büchner an seine Braut. Brief vom November 1833, S.395)
In tiefer Verzweiflung über jenes ,,eherne Gesetz", forschte er nach den Triebkräften des historischen Prozesses und der Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte, damit zugleich nach Wegen für die Lösung der politisch-sozialen Probleme seiner Zeit. In diesem Sinne deutete Büchner den Protagonisten seines Erstlingsdramas: gegen die Dynamik der Geschichte versagt der Einzelwille. Vergebens kämpft Danton gegen das sinnlose Blutvergießen des Revolutionstribunals; seine Bemühungen werden missgedeutet; durch sie verdächtig geworden, verfällt er selbst der Guillotine.
Obwohl der Dichter durchaus subjektiv bei der Auswahl der historischen Geschehnisse verfährt, um seiner gerecht zu werden, beherrscht ihn der Wille zur historischen Objektivität so sehr, dass er ganze Partien aus den Reden des Robespierre den Quellenwerken entnimmt und sie wörtlich in das Drama eingliedert. Nur die Nebenfiguren und Volksszenen sind freie Erfindungen des Dichters.
Die Auseinandersetzung zwischen Jakobinern und Girondisten bildet den historischen Bezugspunkt. Im Verhalten Dantons und Robespierres spiegelt Büchner die Kämpfe innerhalb der fortgeschrittensten Fraktion und sucht nach Antworten für eigenes revolutionäres Handeln. Danton ahnt, dass die Revolution nicht die sozialen Probleme des Volkes lösen wird. Er resigniert und stellt sich gegen die ,,Revolutionsführer": diese wollen die Früchte der Revolution genießen, während große Bevölkerungsmassen hungern; Danton bleibt hinter der Revolution zurück und weiß, sie wird ihn, den gewesenen Revolutionär, zermalmen. Aber auch Dantons Gegenspieler scheitern.
Dass er seiner Titelgestalt - Gegensatz zum historischen Danton - Einsicht in die Konsequenz der Revolution vermittelt, unterstreicht den Modellcharakter des Stückes als Diskussionsfeld zur Klärung von Problemen der Revolution, wie sie seit dem Juli 1830 aufgeworfen waren. Man spürt, das hier nicht Leben abgeschildert wird. Das Zufällige verschwindet, die Gestalten treten aus sich heraus und offenbaren ihr Innersten bei jedem banalen Anlass. ,,Danton Tod" ist ein Stück geschichtlich auswegsloser Tragik von großer Sprach- und Bildkraft, eine der tiefsten Analysen des Themas Revolution und Revolutionär in der Dramatik. Es bietet Debatten über die Hintergründe und Widersprüche die sich im Verlauf der Revolution auftun.
5.2. Heinrich Heine 1797-1865
Heinrich Heine wurde 1797 als Sohn eines Kleinkaufmanns in Düsseldorf geboren. Nach dem Schulbesuch gab man Heine zu einem seinem Onkel Salomon nach Hamburg in die Banklehre. Nachdem er ein für ihn eingerichtetes Warengeschäft in Konkurs gebracht hatte, gestattete die Familie eine akademische Ausbildung, zwar nicht das Studium der Geschichte oder Literatur, sondern das der Rechte, an dem er bis zum Göttinger Doktorexamen (1825) festhielt. In Berlin verkehrte er Salon der Rahel Varnhagen, er lernte das literarische Leben einer werdenden Großstadt kennen, hörte Hegel, traf u.a. mit W. von Humboldt, D. Grabbe, A. von Arnim zusammen. Heine versuchte gesellschaftlich Fuß zu fassen, trat zum Christentum über, blieb aber doch, verdächtigt wegen erster Publikationen, ein Außenseiter; ein bürgerliches Amt stand ihm nicht offen. Die Julirevolution befreite ihn, den auf die Unterstützung des Onkels auch später noch angewiesenen Schriftsteller jedenfalls von der Wahl zwischen geistiger Verkümmerung und polizeilicher Verfolgung: Heine ging ins Pariser Exil.
Der Streit um Heine in der Literaturwelt, der schon zu Lebzeiten des Dichters begann, gehört zu seinen wichtigsten Wirkungen.
Er band seine entschiedene Gesinnung nicht an die Zielstellungen des Bürgertums; er wollte formale Erstarrungen aufbrechen: durch einen Witz und ironische Pointierungen in seinen Werken, die gesellschaftskritische Dimensionen annahmen, durch die Umwandlung alter Genres, die unter seiner Feder revolutionäres politisches und geistesgeschichtliches Bewusstsein transportierten. Er wehrte sich sowohl gegen eine gesellschaftliche Entmündigung der Kunst, als auch gegen deren Einengung auf nur politische Zwemargin-top:0in;margin-right:24.3pt;margin-bottom:0in;margin-left:20.5pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:19.5pt;text-autospace:none;">Die Pariser Julirevolution ließ Heine auf eine Änderung der deutschen Verhältnisse hoffen, doch übersiedelte er, wie schon erwähnt, im Mai 1831 nach Paris, um der Verfolgung zu entgehen und in der Hauptstadt der Revolution dem Atem der Weltgeschichte nahe zu sein. Heine, der nun für den deutschen wie für den französischen Leser schreibt, gelingt es, einen festen Platz im französischen Kulturleben zu erringen. Die beiden Hauptlinien seines Schaffens, die Lyrik und die zum fiktiven tendierende Prosa, setzt er mit wechselnder Intensität fort.
Heines Zeitgedichte, oft Meisterwerke der politischen Satire, sind ein Appell an den Deutschen, sich aus seinem Winterschlaf zu erheben. Daneben stehen Verse, in denen der Emigrant sich wehmütig an die Heimat, die Freunde erinnert, wie z.B. ,,Nachtgedanken":
,,Denk ich an Deutschland in der Nacht...". In den Umkreis der Zeitgedichte gehören auch die Versdichtungen Heines ,,Atta Troll. Ein Sommernachtstraum" (1843) und ,,Deutschland. Ein Wintermärchen" (1844). Hatte Heine im ,,Atta Troll" die Rechte des Geistes gegen die Angriffe durch eine beschränkte Zeitgenossenschaft verteidigt, so zielte seine Satire ,,Deutschland. Ein Wintermärchen" unmittelbar auf den politischen Zustand in Deutschland hin.
Die satirischen Mittel des Poems, die Heine als ,,politisch-romantisch bezeichnet, setzen sarkastisch Ironie und Pathos, Spott und Zorn, Lachen und Trauer, Phantasie und Realität zu einem Ganzen zusammen.
Mitte der vierziger Jahre setzte ein Wandlungsprozess im Schaffen Heines ein, der wesentlich von seiner Krankheit verursacht war. Im Mai 1848 begannen die schweren acht Jahre der ,,Matratzengruft", wie er sein Siechtum nannte. Fast völlig erblindet, allen Schmerzen zum Trotz, setzte der Künstler nicht nur seine künstlerische Arbeit fort, sondern er intensivierte sie: im letzten Jahrzehnt entstand ein Drittel seiner Versdichtungen und Prosaschriften. Die Pariser Februarrevolution von 1848 und die folgenden Ereignisse konnte er nur noch vom Krankenlager aus verfolgen.
Neu ist in Heines Schaffen z.B.: das Genre der satirischen Tierparabel. Heine lässt ,,Die Wanderratten" (1855) auf eine profitgierige Bürgerwelt los: eine Verspottung bürgerlicher Ängste vor dem Verlust des Eigentums durch den unaufhaltsamen Siegeszug hungriger Ratten.
Heinrich Heine
Die schlesischen Weber
Im düsteren Auge keine Träne, Ein Fluch dem falschen Vaterlande, sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne: wo nur gedeihen Schmach und Schande, Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wo jede Blume früh geknickt, wir weben hinein den dreifachen Fluch - wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt - Wir weben, wir weben! Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten Das Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht, in Winterskälte und Hungersnöten; wir weben emsig Tag und Nacht - wir haben vergebens gehofft und geharrt, Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt - wir weben hinein den dreifachen Fluch - Wir weben, wir weben! Wir weben, wir weben!
Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst,
und uns wie Hunde erschießen lässt -
Wir weben, wir weben!
(e. Juni 1844)
(Das Gedicht ,,Die schlesischen Weber" entstanden unter dem Eindruck der Weberrevolution in Peterswaldau und Langenbielau im Juni 1844, schildert die aufständischen Weber nicht als Mitleid erregende Hungerleider, sondern las Totengräber, die ihren der alten Ordnung, die ihren Fluch über Gott, König und ,,Altdeutschland" sprechen.)
6. Quellenangabe
- Taschenhandbuch zur Geschichte; Überblick und Grundbegriffe Paderborn 1996, Schroedel
- Heinrich Heine: Werke und Briefe in zehn Bänden; Hg. v. H. Kaufmann Berlin 1961
- Kurze Geschichte der deutschen Literatur Berlin 1990, Volk und Wissen
- Roy C. Cowen: Der poetische Realismus - Kommentar zu einer Epoche München 1985, Winkler Verlag
- Deutschstunden/ Lesebuch Berlin 1991, Cornelsen
- Egon Ecker: Epochen deutscher Literatur - Realismus des 19. und 20. Jahrhunderts Hollfeld 1986, C. Bange Verlag
- Sigisbert Meier: Der Realismus als Prinzip der schönen Künste München 1900
- Georg Büchner: Dichtungen Leipzig 1972, Reclam Verlag
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Realismus im Allgemeinen, und wie wird die Epoche kurz betrachtet?
Der Realismus im 19. Jahrhundert ist geprägt vom aufkommenden Nationalismus und dem politischen Liberalismus, aber auch von der industriellen Revolution mit ihren sozialen Folgen wie Ausbeutung und Verarmung. Der Realismus vereint den literarischen Vormärz mit politischer Tendenzdichtung und den poetischen Realismus, wobei der Realismus sich als Bewegung ohne feste Konturen versteht. Er orientiert sich an der objektiven Realität und strebt eine schonungslose Analyse und Kritik der zeitgenössischen Wirklichkeit ohne Idealisierung an.
Wie war die (geistes)geschichtliche Lage zu Beginn des 19. Jahrhunderts?
Das 19. Jahrhundert war geprägt vom Vordringen liberalen Gedankenguts, zunehmender Technisierung, einem enormen Bevölkerungszuwachs und dem Aufstieg des Proletariats. Der Wiener Kongress 1814/15 versuchte, eine Friedensordnung für Europa zu schaffen, während sich in Frankreich verschiedene Richtungen in Bezug auf die Staatsverfassung herausbildeten. Die Julirevolution 1830 in Paris beeinflusste auch die politische Szene in Deutschland, wo bürgerliche Opposition die Umwandlung des Deutschen Bundes in einen Nationalstaat forderte. Die Karlsbader Beschlüsse unterdrückten jegliche politische Regung durch Zensur und Überwachung.
Was versteht man unter dem "kritischen Realismus" in der Literatur am Beispiel des Vormärz?
Der kritische Realismus in der Literatur des Vormärz befasst sich mit den weltgeschichtlichen Ereignissen seit der Französischen Revolution und den daraus resultierenden philosophischen Schlussfolgerungen, insbesondere der Desillusionierung über die unerfüllten Ideale von Freiheit und Gleichheit. Die Schriftsteller des kritischen Realismus bemühten sich, die Stellung des Menschen in einer neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit auszuloten, wobei der "Weltschmerz" eine typische Reaktion auf die geschichtliche Desillusionierung war. Die industrielle Revolution ermöglichte eine rasante Steigerung der Buch- und Zeitschriftenproduktion, jedoch behinderten die Karlsbader Beschlüsse die freie Entfaltung der Literatur.
Wie manifestiert sich der kritische Realismus im Wirklichkeitsbezug?
Der kritische Realismus strebt eine objektive Darstellung der zeitgenössischen Wirklichkeit an, gekennzeichnet durch Gottferne, Entfremdung und Zusammenhangslosigkeit. Er ist didaktisch, lehrhaft und reformierend und will die historische Wirklichkeit sittlich und ästhetisch interpretieren. Im Gegensatz zur Romantik berücksichtigt er die Grenzen der menschlichen Erfahrungswelt und schildert den realen Alltag, soziale Begebenheiten und die aktuelle politische Situation. Die Schriftsteller verwenden eine deutliche, scharfe, derbe Sprache, Ironie und Sarkasmus, um ihre kritischen Gedanken auszudrücken.
Was ist die Bedeutung des "Jungen Deutschland"?
Das "Junge Deutschland" war ein loser Zusammenschluss von Literaten, die die Ansätze der bisherigen Dichtung fortführten. Charakteristisch war eine in die Tagespolitik eingreifende Literatur und zahlreiche neue publizistische Formen. 1835 wurden sämtliche ihrer Schriften verboten, da sie angeblich die christliche Religion angriffen, die sozialen Verhältnisse herabwürdigten und alle Zucht und Ordnung zerstören wollten. Die Hauptleistung des "Jungen Deutschland" lag in dem Wiederbeleben der Kritik, in dem Streben nach geistiger Erneuerung und dem Kampf gegen das politische Erstarren.
Wie ist das Verhältnis zum "poetischen Realismus"?
Die Niederlage der revolutionären Bewegung 1848/49 leitete einen tiefgreifenden Wandel in der Literatur ein. Die Schriftsteller des poetischen Realismus verfolgten eine besondere Form realistischer Schreibweise und Theorie, bei der nicht mehr das Eingreifen in öffentliche Angelegenheiten im Mittelpunkt stand, sondern die Bewahrung der humanen Persönlichkeit. Sie strebten nach der "Mitte zwischen der objektiven Wahrheit in den Dingen und dem, was unser Geist gezwungen ist, hineinzulegen". Während im Vormärz Weltschmerz, Ironie und Satire vorherrschend waren, wurde jetzt das tendenziös Politische verworfen, und der Humor galt als dominierendes literarisches Gestaltungsprinzip.
Wie sah das Drama des 19. Jahrhunderts aus?
Aus der Romantik ging die Gattung der "Schicksalsdramen" hervor, die nur noch äußerlich an die Idee der klassischen Schicksalstragödie anknüpfte. Die Bühnen boten getrennte Spiele für "die Oberen" und für das Volk, die jedoch überwiegend ungeeignet waren, künstlerische Ansprüche durchzusetzen. Die künstlerisch anspruchsvollen Dramatiker des Vormärz standen vor der Alternative, entweder "Lesedramen" zu schreiben oder Lieferanten von konventionellen Stücken zu sein. Als Ergebnis der Debatten entstand schließlich eine Kompromissdramaturgie, die für manche Autoren nicht akzeptabel war.
Wer waren literarische Vertreter des kritischen Realismus/des Vormärz?
Zu den literarischen Vertretern des kritischen Realismus/des Vormärz gehören Georg Büchner (1813-1837) mit seinen Werken "Der hessische Landbote" und "Dantons Tod" sowie Heinrich Heine (1797-1865) mit seiner Lyrik und Prosa, die gesellschaftskritische Dimensionen annahmen.
Was ist die Bedeutung von Georg Büchners "Der hessische Landbote"?
"Der hessische Landbote" ist eine Flugschrift von Georg Büchner aus dem Jahr 1834, die den Zweck hatte, den Bauern ihre unerträgliche Lage bewusst zu machen. Büchner verkündet den Hütten Frieden und den Palästen Krieg und appelliert an die materiellen Interessen und den Gerechtigkeitssinn der Ausgeplünderten und Besitzlosen.
Welche Themen behandelt Georg Büchners "Dantons Tod"?
Büchners Stück "Dantons Tod" markiert eine neue Entwicklungsstufe in der deutschen dramatischen Literatur, die die Überwindung des klassischen und romantischen Dramenmodells durch Stücke, die Menschen von Fleisch und Blut vorführen. Es thematisiert die Durchleuchtung sozialer Widersprüche im Kontext der Französischen Revolution und die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte.
Was sind die wichtigsten Aspekte von Heinrich Heines Werk?
Heinrich Heine leistete einen bedeutenden Beitrag zur deutschen Literatur, indem er formale Erstarrungen aufbrach und alte Genres umwandelte, um revolutionäres politisches und geistesgeschichtliches Bewusstsein zu transportieren. Er wehrte sich sowohl gegen eine gesellschaftliche Entmündigung der Kunst als auch gegen deren Einengung auf nur politische Zwecke. Seine Zeitgedichte und satirischen Werke sind ein Appell an die Deutschen, sich aus ihrem Winterschlaf zu erheben, während er sich in anderen Versen wehmütig an die Heimat erinnert.
Was sind die Quellen für diese Informationen?
Die Informationen stammen aus verschiedenen Quellen, darunter:
- Taschenhandbuch zur Geschichte; Überblick und Grundbegriffe Paderborn 1996, Schroedel
- Heinrich Heine: Werke und Briefe in zehn Bänden; Hg. v. H. Kaufmann Berlin 1961
- Kurze Geschichte der deutschen Literatur Berlin 1990, Volk und Wissen
- Roy C. Cowen: Der poetische Realismus - Kommentar zu einer Epoche München 1985, Winkler Verlag
- Deutschstunden/ Lesebuch Berlin 1991, Cornelsen
- Egon Ecker: Epochen deutscher Literatur - Realismus des 19. und 20. Jahrhunderts Hollfeld 1986, C. Bange Verlag
- Sigisbert Meier: Der Realismus als Prinzip der schönen Künste München 1900
- Georg Büchner: Dichtungen Leipzig 1972, Reclam Verlag
- eigene Aufzeichnungen
- Quote paper
- Markus Schmidt (Author), 2000, Kritischer Realismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100106