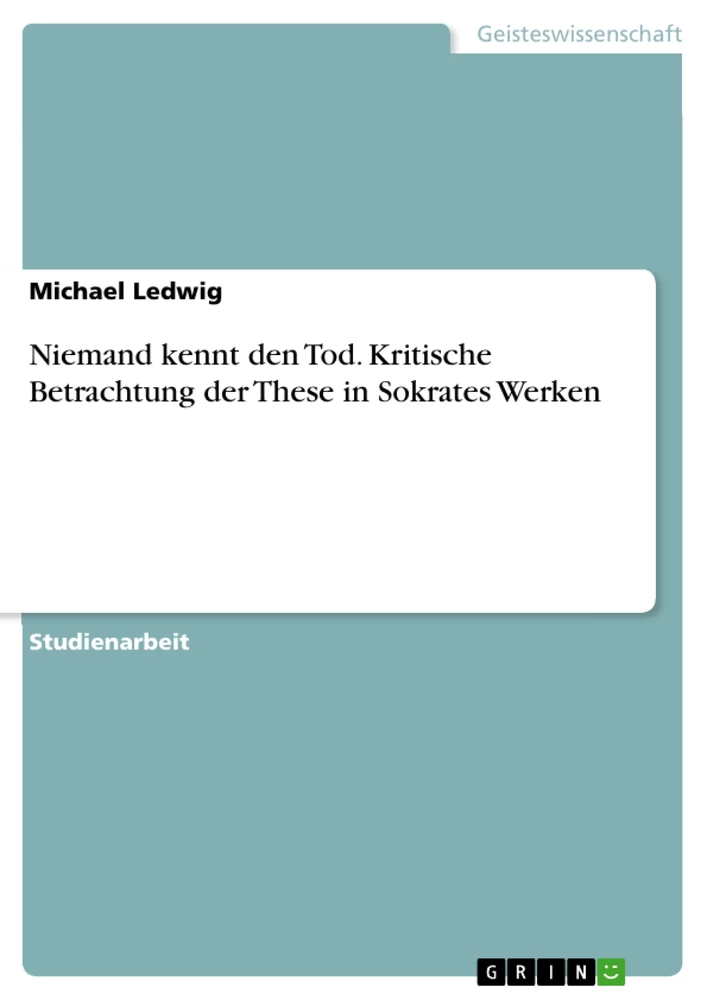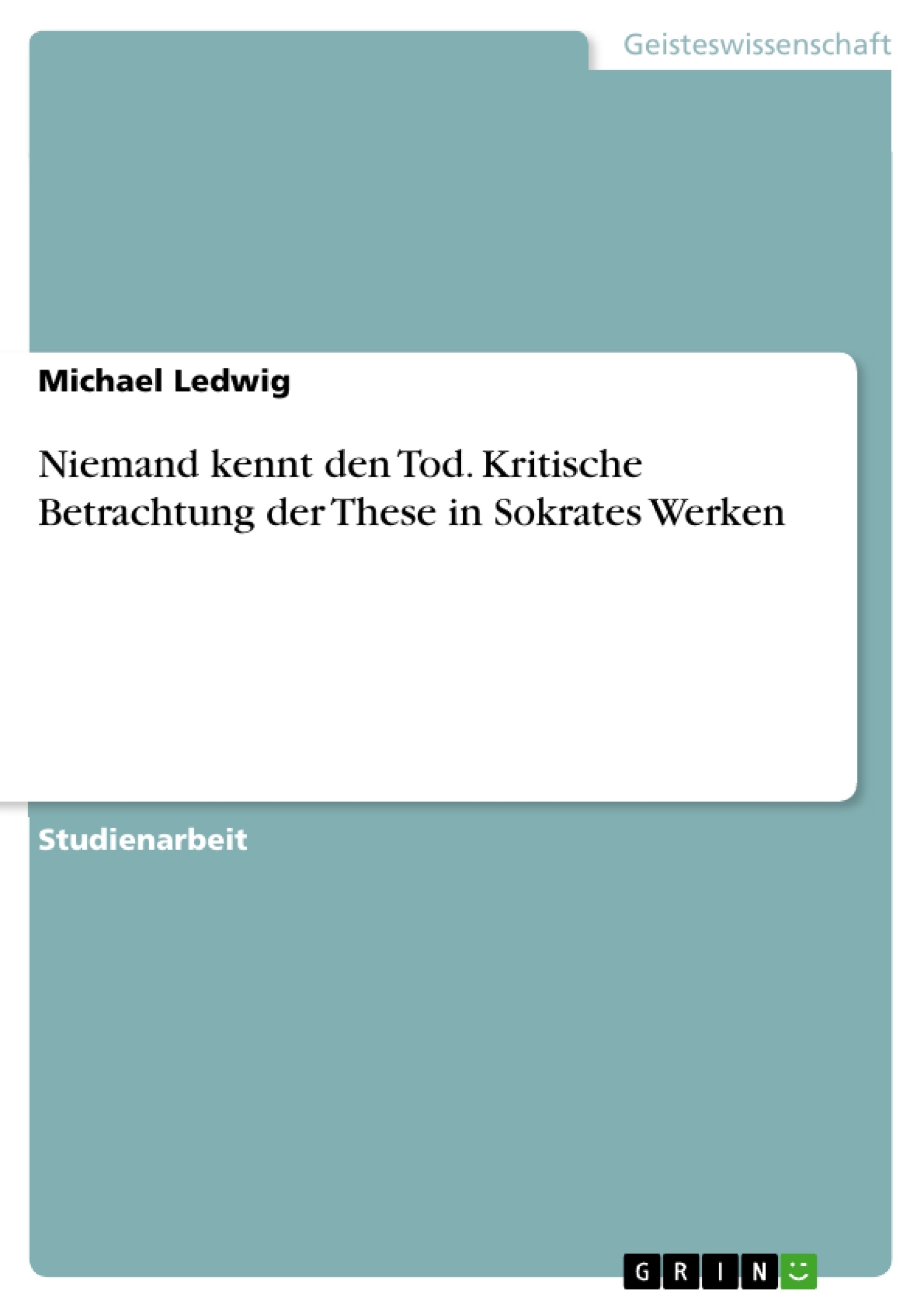In dieser Hausarbeit soll versucht werden, Argumente zu finden, die Sokrates These, dass niemand den Tod kenne, zu untermauern. Um die Hausarbeit nicht ausufern zu lassen, beschränkt sich der Autor auf Platons Werke "Gorgias", "Apologie des Sokrates", und "Phaidon". Diese drei Schriften Platons scheinen aus philosophischer Sicht genügend Antworten auf die Themenfrage zu geben.
Das Thema des Sterbens beziehungsweise des Todes hat die Menschheit zu allen Zeiten beschäftigt. In sehr vielen wissenschaftlichen Abhandlungen wird sich dieses Themas angenommen. Ein meiner Meinung nach sehr aufschlussreiches Beispiel liefert die Untersuchung von Todesbildern als Gegenstand eines DFG-Forschungsprojektes unter der Leitung von Armin Nassehi und Georg Weber, die 150 Interviews, teils mit Experten, teils mit betroffenen Menschen geführt haben. Irmhild Saake thematisiert die Ergebnisse dieser Interviews in ihrem Essay "Gegenwarten des Todes im 21. Jahrhundert".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Argumente im Gorgias
- Gespräch mit Polos
- Gespräch mit Kallikles
- Mythos
- Argumente in der Apologie
- Weisheit bei Sokrates
- Stellung des Themenzitats in der Apologie
- Vorstellungen vom Tod bei Sokrates
- Argumente im Phaidon
- Einleitung des Hauptgespräches
- Beweise für die Unsterblichkeit der Seele
- Ideenlehre
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Platons Werke "Gorgias", "Apologie des Sokrates" und "Phaidon" auf Argumente, die Sokrates' These stützen, dass der Tod möglicherweise nicht das größte Übel, sondern ein Geschenk sein könnte. Die Arbeit konzentriert sich auf die philosophischen Auseinandersetzungen und die Darstellung des Todes in den jeweiligen Dialogen.
- Die Natur des Todes und das menschliche Unwissen darüber
- Das Konzept von Gerechtigkeit und Unrecht im Kontext des Todes
- Die Bedeutung der Seelenheil und der jenseitigen Gerechtigkeit
- Die Rolle der Rhetorik und Philosophie im Umgang mit dem Tod
- Das Verhältnis von Körper und Seele im Verständnis des Todes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Todes und seiner Bedeutung für die Menschheit ein. Sie verweist auf aktuelle Forschungsarbeiten zum Thema Todesvorstellungen und stellt Sokrates' Zitat aus der Apologie als zentralen Ausgangspunkt der Arbeit vor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Platons "Gorgias", "Apologie" und "Phaidon" um Argumente zu finden, die das Zitat unterstützen. Die Einleitung begründet die Auswahl dieser drei Werke und skizziert den methodischen Ansatz der Untersuchung.
2.0 Argumente im Gorgias: Dieses Kapitel analysiert die Argumente im Gorgias, die sich mit der Frage nach dem größten Übel auseinandersetzen. Es gliedert sich in drei Unterkapitel, die jeweils verschiedene Aspekte der Argumentation beleuchten. Die Diskussionen Sokrates' mit Polos und Kallikles bilden den Schwerpunkt, wobei unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit und einem guten Leben miteinander konfrontiert werden.
2.1 Gespräch mit Polos: Im Dialog mit Polos verteidigt Sokrates vehement die These, dass Unrecht leiden besser sei als Unrecht tun. Er argumentiert, dass die freiwillige Hinnahme von Strafe zur Reinigung der Seele und somit zum Seelenheil beiträgt. Die Vorstellung eines jenseitigen Gerichts wird angedeutet, was den Tod in einem neuen Licht erscheinen lässt. Die Redekunst wird in diesem Kontext als Mittel zur Aufklärung von Verbrechen und Erlangung des Seelenheils dargestellt.
2.2 Gespräch mit Kallikles: Das Gespräch mit Kallikles präsentiert eine Gegenposition zu Sokrates' Ansicht. Kallikles vertritt die These, dass der Stärkere das Recht habe, mehr zu besitzen und seine Begierden ungehemmt auszuleben. Sokrates kontert mit dem Fassgleichnis, das die unterschiedlichen Arten des jenseitigen Daseins veranschaulicht und den Weg zur Seelenruhe aufzeigt.
Schlüsselwörter
Tod, Sokrates, Platon, Gorgias, Apologie, Phaidon, Gerechtigkeit, Unrecht, Seelenheil, Jenseits, Rhetorik, Philosophie, Leib-Seele-Problem, Glück, Unsterblichkeit der Seele.
Häufig gestellte Fragen zu Platons Dialogen (Gorgias, Apologie, Phaidon)
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Platons "Gorgias", "Apologie des Sokrates" und "Phaidon", um Argumente zu finden, die Sokrates' These stützen, dass der Tod möglicherweise nicht das größte Übel, sondern ein Geschenk sein könnte. Der Fokus liegt auf den philosophischen Auseinandersetzungen und der Darstellung des Todes in den jeweiligen Dialogen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Natur des Todes und das menschliche Unwissen darüber, das Konzept von Gerechtigkeit und Unrecht im Kontext des Todes, die Bedeutung der Seelenheil und der jenseitigen Gerechtigkeit, die Rolle der Rhetorik und Philosophie im Umgang mit dem Tod sowie das Verhältnis von Körper und Seele im Verständnis des Todes.
Welche Platonschen Dialoge werden untersucht?
Die Hausarbeit untersucht drei Platonsche Dialoge: "Gorgias", "Apologie des Sokrates" und "Phaidon".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Analyse der Argumente in den drei Dialogen ("Gorgias", "Apologie", "Phaidon") und einen Schluss. Jedes Kapitel zu den einzelnen Dialogen ist weiter unterteilt, um spezifische Aspekte der Argumentation zu beleuchten (z.B. Sokrates' Gespräche mit Polos und Kallikles im Gorgias).
Was ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Die Einleitung beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf einer detaillierten Analyse der philosophischen Argumente in den drei Dialogen basiert. Der zentrale Ausgangspunkt ist ein Zitat Sokrates' aus der Apologie.
Welche Schlüsselkonzepte werden in den Dialogen untersucht?
Schlüsselkonzepte sind unter anderem Tod, Gerechtigkeit, Unrecht, Seelenheil, Jenseits, Rhetorik, Philosophie, Leib-Seele-Problem, Glück und die Unsterblichkeit der Seele.
Was wird im Kapitel über den Gorgias analysiert?
Das Kapitel zum Gorgias analysiert die Argumente, die sich mit der Frage nach dem größten Übel auseinandersetzen. Es konzentriert sich auf die Dialoge Sokrates' mit Polos und Kallikles, wobei unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit und einem guten Leben konfrontiert werden. Die Rolle der Rhetorik und die Vorstellung eines jenseitigen Gerichts werden ebenfalls behandelt.
Was wird im Kapitel über die Apologie analysiert?
Das Kapitel zur Apologie untersucht die Weisheit bei Sokrates, die Stellung des zentralen Thesenzitat in der Apologie und Sokrates' Vorstellungen vom Tod.
Was wird im Kapitel über den Phaidon analysiert?
Das Kapitel zum Phaidon analysiert die Einleitung des Hauptgespräches, die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele und die Ideenlehre Platons im Kontext des Todes.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen auf Basis der Analyse der drei Dialoge hinsichtlich der These, dass der Tod nicht das größte Übel sein muss. (Die genaue Schlussfolgerung wird im nicht präsentierten Schlussabschnitt der Arbeit detailliert dargestellt.)
- Quote paper
- Michael Ledwig (Author), 2018, Niemand kennt den Tod. Kritische Betrachtung der These in Sokrates Werken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1000916