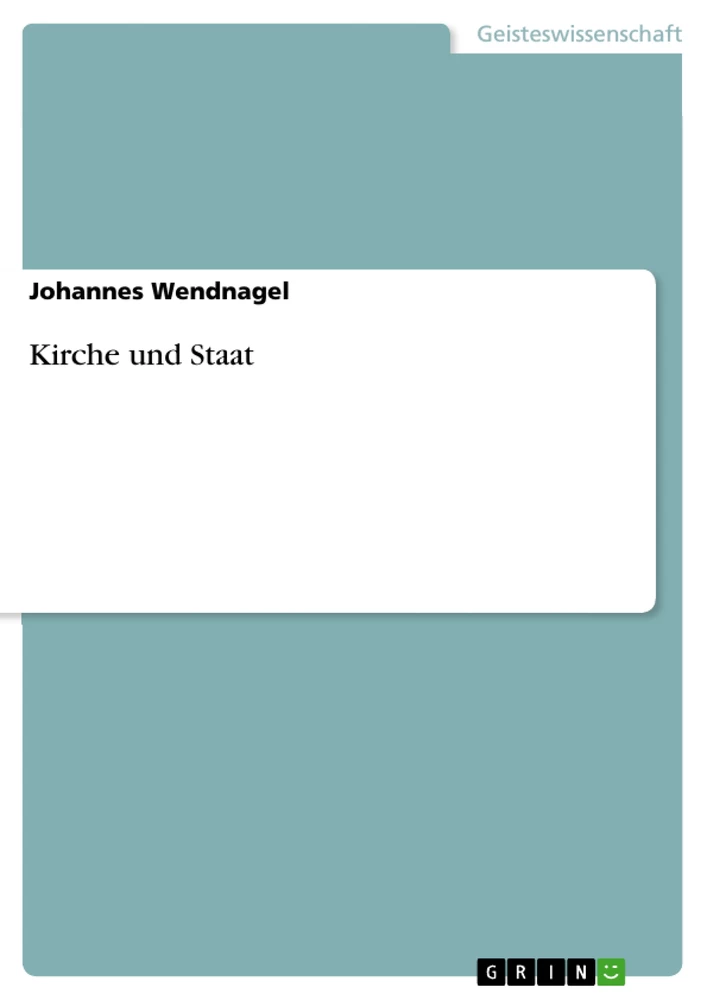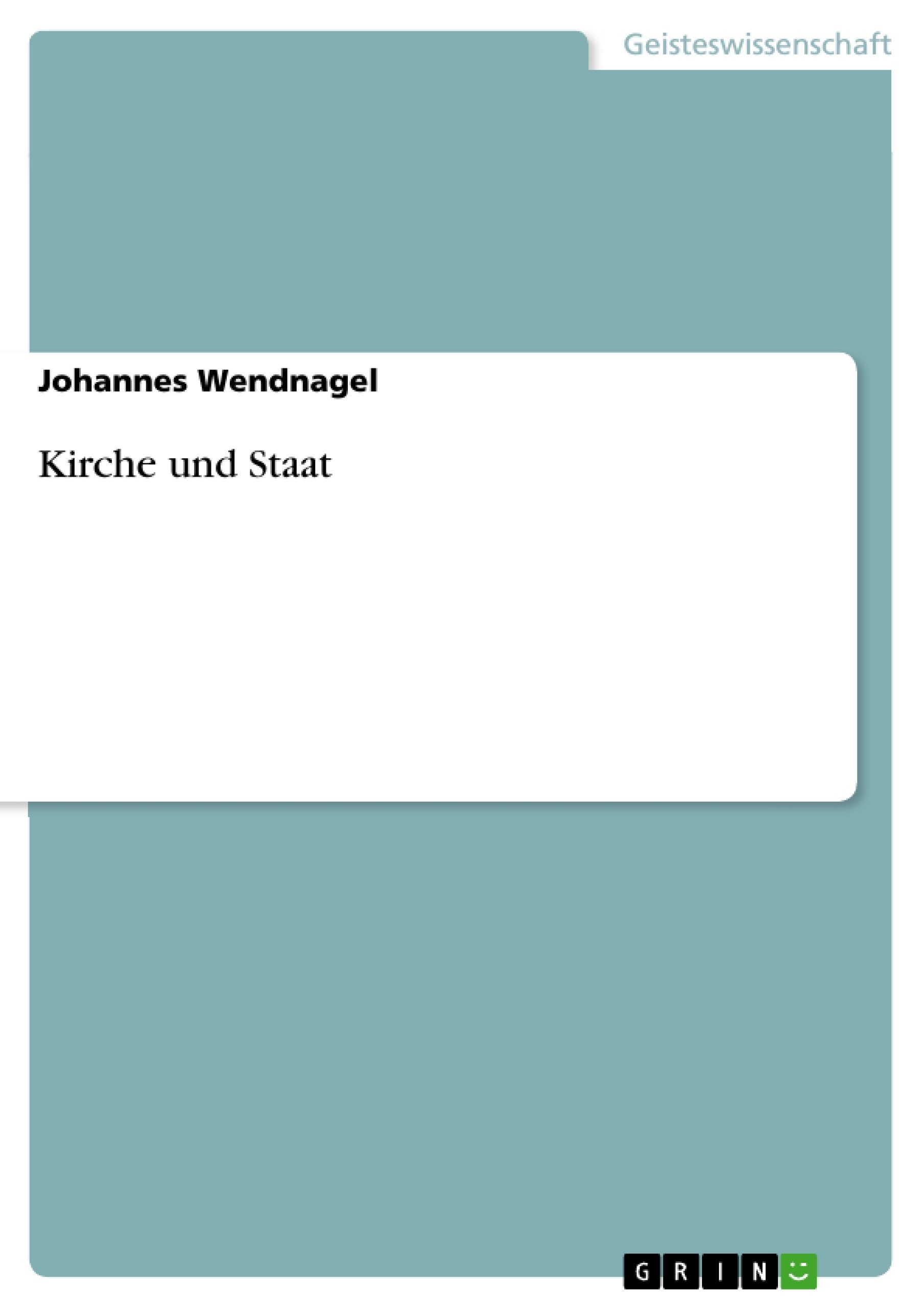Sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse habe ich Ihren Beitrag gelesen: "Pro und Contra: Gräbt sich die evangelische Kirche durch ihr politisches Engagement das eigene Grab?" Alle mit diesem Thema zusammenhängenden Probleme ergeben sich daraus, dass Kirche und Politik unbestreitbar, historisch und dogmatisch, sowohl fundamental aufeinander bezogen als auch fundamental voneinander unterschieden sind. Alle zu diesem Thema vertretenen Meinungen unterscheiden sich nur durch verschiedene Gewichtungen dieser beiden Prinzipien. Da beide Prinzipien unbestreitbar sind, miteinander aber im Widerstreit liegen, ist der Streit zwischen Kirche und Politik prinzipiell unaufhebbar. Über die Etablierung weniger argumentativer Eckwerte ist nicht hinauszukommen. Beiliegende Thesen, die nach monatelanger Diskussion entstanden sind, machen einen Versuch damit.
Mit freundlichen Grüßen
(Johannes Wendnagel)
Thesen zum Verhältnis von Kirche und Staat (Politik)
1. Durch alle Zeiten hindurch bildet für die christliche Kirche wie für den Staat ihr gegenseitiges Verhältnis ein grundlegendes Problem.
2. Dieses grundlegende Problem findet seine Erklärung darin, dass Kirche und Staat, spätestens nach der neuzeitlichen Trennung von imperium und sacerdotium, gleichermaßen in einem Verhältnis unbestreitbarer fundamentaler Bezogenheit aufeinander und einem Verhältnis unbestreitbarer fundamentaler Unterschiedenheit voneinander zu existieren und sich nach Möglichkeit zu vertragen gezwungen sind.
2.1. Die unbestreitbare fundamentale Bezogenheit von Kirche und Staat besteht grundsätzlich darin, dass Kirche und Staat beides Institutionen innerhalb derselben Welt und ihrer Strukturen sind und sich dabei prinzipiell an ein und dieselben Personen (Adressatenkongruenz) richten.
2.2. Die unbestreitbare fundamentale Unterschiedenheit von Kirche und Staat besteht grundsätzlich darin, dass die Kirche ein über die Welt und ihre Strukturen hinaus, auf Gott, weisendes Glaubensbekenntnis zum autoritativen Denkens- und Handlungsmaßstab hat, während der weltanschaulich weitgehend neutrale Staat nach Maßgabe innerweltlicher, das Ganze des politischen Entscheidungsfeldes betreffender Regeln politischer Vernunft für Recht, Frieden, einen fairen Ausgleich aller Interessen und damit für das Wohl aller seiner Bürger zu sorgen und also unter Androhung und Ausübung von Gewalt zu handeln hat.
2.2.1. Die Regeln politischer Vernunft kommen nicht aus dem Evangelium und können nicht aus dem Evangelium kommen, denn sie sind nicht die Fragen des Evangeliums. Sie kommen aus der gewachsenen Vielfalt unserer Geschichte und den Grundstrukturen dieser Welt. Als solche sind sie kategorial anders orientiert als die Fragen des Evangeliums, sodass sie ihnen zum Teil sogar stracks zuwiderlaufen (cf.: Matth. 5,38f (Bergpredigt) und Röm 13,3-4).
2.2.2. Die aus der Vielfalt unserer Geschichte und aus den Grundstrukturen dieser Welt stammenden Regeln politischer Vernunft fussen im Wesentlichen auf folgenden, durch das Evangelium nicht einholbaren Prinzipien: Gerechtigkeit (iustitia distributiva) im Sinne von gerechtem Interessenausgleich aller und im Sinne von Recht und Gesetz, Sicherheit, Leistung (und Gegenleistung), Verdienst, Verhältnismässigkeit, Überprüfbarkeit, Kommunikabilität und Kontinuität (kein Anspruch auf systematische Vollständigkeit).
2 2. 3. Ein ebenso typisch neuzeitliches, wie unverzichtbares Kriterium politischen Handelns, das mit dem Absolutheitsanspruch des Evangeliums unvermeidlich in Konkurrenz tritt, ist der demokratische Konsens, der gleichermassen die Interessenlage aller in Einklang zu bringen hat. Der moderne Staat des demokratischen Konsenses hat sich mit innerer Notwendigkeit aus dem objektiven (nicht subjektiven!!) Wahrheitsverlust in der Geistesgeschichte der letzten dreihundert Jahre ergeben. Diese Entwicklung ist irreversibel.
2. 3. Geradezu zu einem Antagonismus wird das von fundamentaler Bezogenheit und Unterschiedenheit und damit dem Zwang, sich zu vertragen, gekennzeichnete Verhältnis zwischen Kirche und Staat von Seiten der Kirche dadurch, dass sie mit Lehre und Leben Anspruch auf alle Menschen und auf den ganzen Menschen erhebt und dabei gleichzeitig die Freiheit von Lehre und Leben vom Staat fordert.
2.4. Geradezu zu einem Antagonismus wird das von fundamentaler Bezogenheit und Unterschiedenheit und damit dem Zwang, sich zu vertragen, gekennzeichnete Verhältnis von Kirche und Staat von Seiten des Staates dadurch, dass er als Herr der weltlichen Ordnung von allen seinen Bürgern gleichermaßen Loyalität und Gehorsam gegenüber sich und seinen Gesetzen als Bedingung der Möglichkeit seines Bestehens und der Wohlfahrt seiner Bürger fordert und fordern muss.
2.5. Dieser Antagonismus ist aufgrund der fundamentalen Unterschiedenheit von Kirche und Staat prinzipiell unaufhebbar und er ist aufgrund ihrer fundamentalen Bezogenheit unausweichlich. Er muss ausgehalten werden.
2.5.1. Je mehr das aus dem Selbstverständnis der Kirche resultierende Verständnis der Aufgaben des Staates und das aus dem Selbstverständnis des Staates resultierende Verständnis der Aufgaben der Kirche differieren, desto schärfer und konfliktträchtiger wird der Antagonismus. Dem jeweils anderen jegliche Urteilskompetenz abzusprechen, führt in eine den Antagonismus ins Unerträgliche steigernde Sackgasse.
2. 6. Das Wort ächristliche Politikä ist in diesem Sinne eine contradictio in adjecto
2. 7. Demgemäss beruht die Idee einer genuin christlichen Politik ebenso auf einem klassisch und typisch schwärmerischen Fehlurteil, wie die Idee eines genuin kirchlichen Staates. Dies gilt auch und gerade dann, wenn, wie im mittelalterlichen Corpus Christianum, eine weitgehende personelle und organisatorische Einheit beider besteht.
2. 7. 1. Etwa als genuin christlich empfundene Entscheidungsvorgaben haben nur dann Aussicht auf Durchsetzung, wenn sie auch unter dem Kriterium der politischen Vernunft, denen das Ganze des politischen Entscheidungsfeldes grundsätzlich unterworfen sein muss, vertretbar sind. Sie hören dadurch auf, genuin christlich zu sein.
2. 7. 1.1. Beispiel: Eine etwa als genuin christlich empfundene, faktisch bereits erhobene Forderung nach Verhundertfachung der Entwicklungshilfe für die Dritte Welt würde und müsste, selbst bei unterstellter Christlichkeit, an den innerweltlichen Regeln politischer Vernunft scheitern.
2. 7. 2. Es besteht auf dem Gebiet der politischen Meinungs- und Willensbildung kein prinzipieller Unterschied zwischen einem Christen in der Politik und einem Christen in der Kirche.
2. 7. 3. Einen formalen Prüfstein für politische Forderungen aus den Reihen der Christen in der Kirche stellt der probehalber vorgenommene Rollentausch mit den Christen in der Politik dar (angenommen, ich wäre Finanzminister...).
2. 8.Nicht nur schwärmerisch, sondern auch unredlich ist es, jeweils als christlich empfundene Entscheidungsvorgaben, etwa aus einer persönlichen Auslegung der Bergpredigt resultierend, dem sich häufig ebenso als Christ verstehenden Politiker mit dem Absolutheitsanspruch des Evangeliums zur Verwirklichung vorzuschreiben, ohne die jeweils in Frage kommenden Regeln politischer Vernunft in Rechnung zu stellen. Eine solche Position verwirkt dadurch ihren Anspruch auf Berücksichtigung. Sie kann nicht ernstgenommen werden. Paart sich solches Schwärmertum mit einem keinen Widerspruch duldenden Sendungsbewusstsein, so wird es geradezu unerträglich.
2. 9. Den Verfassern des Neuen Testamentes war dieser Sachverhalt nicht fremd. Deshalb haben die beiden theologischen Grundeinsichten der Wesensverschiedenheit von Kirche und Staat und der grundsätzlichen Gehorsamspflicht gegenüber dem Staat auch der Kirche ihren Ursprung im Neuen Testament.(cf.: Mk 12, 13-17 par; Röm 13, 1-7; 1. Petr 2, 13-25)
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Thesen zum Verhältnis von Kirche und Staat (Politik)?
Die zentralen Thesen behandeln die fundamentale Bezogenheit und Unterschiedenheit von Kirche und Staat, die sich aus der gemeinsamen Existenz in derselben Welt und der unterschiedlichen Ausrichtung (Glaube vs. politische Vernunft) ergeben. Der Text argumentiert, dass das Verhältnis von Kirche und Staat durch einen unaufhebbaren Antagonismus gekennzeichnet ist, der ausgehalten werden muss. Zudem wird die Idee einer genuin christlichen Politik als widersprüchlich betrachtet.
Worin besteht die fundamentale Bezogenheit von Kirche und Staat?
Die fundamentale Bezogenheit besteht darin, dass Kirche und Staat beides Institutionen innerhalb derselben Welt und ihrer Strukturen sind und sich dabei prinzipiell an ein und dieselben Personen (Adressatenkongruenz) richten.
Worin besteht die fundamentale Unterschiedenheit von Kirche und Staat?
Die fundamentale Unterschiedenheit besteht darin, dass die Kirche ein über die Welt hinausweisendes Glaubensbekenntnis hat, während der Staat nach Maßgabe innerweltlicher Regeln politischer Vernunft für Recht, Frieden und das Wohl aller Bürger zu sorgen hat, notfalls auch unter Androhung und Ausübung von Gewalt.
Was sind die Regeln politischer Vernunft und woher kommen sie?
Die Regeln politischer Vernunft kommen nicht aus dem Evangelium, sondern aus der gewachsenen Vielfalt unserer Geschichte und den Grundstrukturen dieser Welt. Sie umfassen Prinzipien wie Gerechtigkeit, Sicherheit, Leistung, Verhältnismässigkeit, Überprüfbarkeit, Kommunikabilität und Kontinuität.
Warum ist das Verhältnis zwischen Kirche und Staat durch einen Antagonismus gekennzeichnet?
Der Antagonismus entsteht dadurch, dass die Kirche mit Lehre und Leben Anspruch auf alle Menschen und auf den ganzen Menschen erhebt und gleichzeitig die Freiheit von Lehre und Leben vom Staat fordert, während der Staat von allen seinen Bürgern Loyalität und Gehorsam gegenüber seinen Gesetzen fordert.
Warum ist die Idee einer "christlichen Politik" laut dem Text problematisch?
Die Idee einer genuin christlichen Politik wird als "contradictio in adjecto" und als schwärmerisches Fehlurteil betrachtet, da politische Entscheidungen unter dem Kriterium der politischen Vernunft vertretbar sein müssen und somit nicht genuin christlich sein können.
Welche Rolle spielt das Neue Testament im Verständnis des Verhältnisses von Kirche und Staat?
Die Verfasser des Neuen Testamentes waren sich der Wesensverschiedenheit von Kirche und Staat bewusst. Die beiden theologischen Grundeinsichten der Wesensverschiedenheit von Kirche und Staat und der grundsätzlichen Gehorsamspflicht gegenüber dem Staat haben ihren Ursprung im Neuen Testament (Mk 12, 13-17 par; Röm 13, 1-7; 1. Petr 2, 13-25).
Kann sich Politik in einem völlig wertneutralen Raum abspielen?
Nein, Politik kann sich nicht in einem völlig wertneutralen Raum abspielen. Sie ist in ihrem Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess immer schon von bestimmten Grundwerten geleitet, die von der Gesellschaft und auch von den Kirchen beeinflusst werden.
- Quote paper
- Johannes Wendnagel (Author), 2000, Kirche und Staat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100067