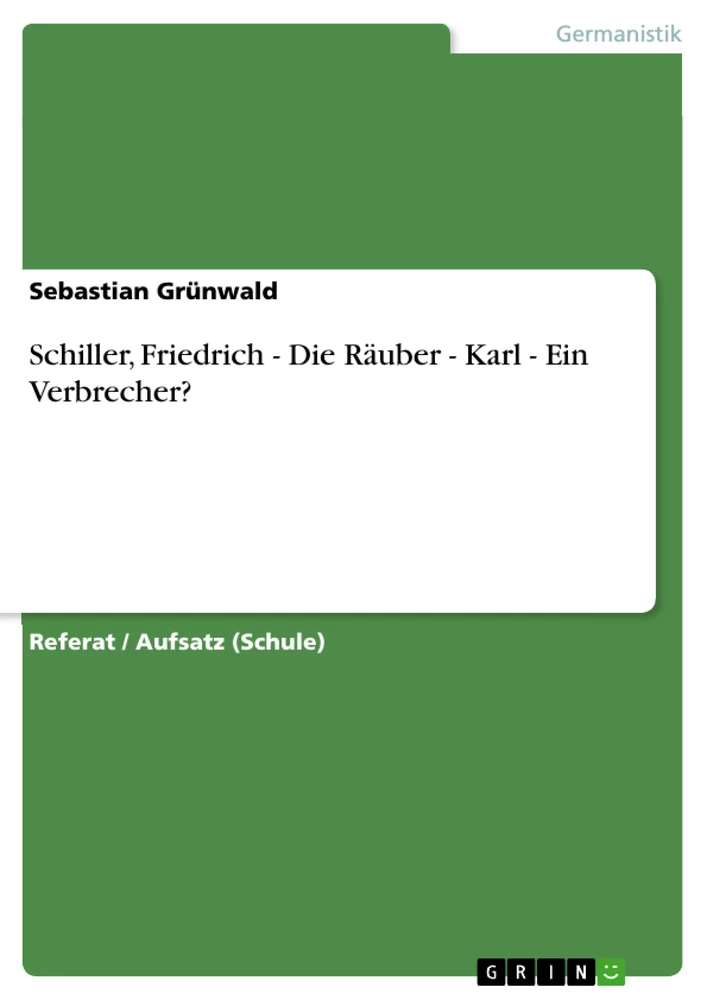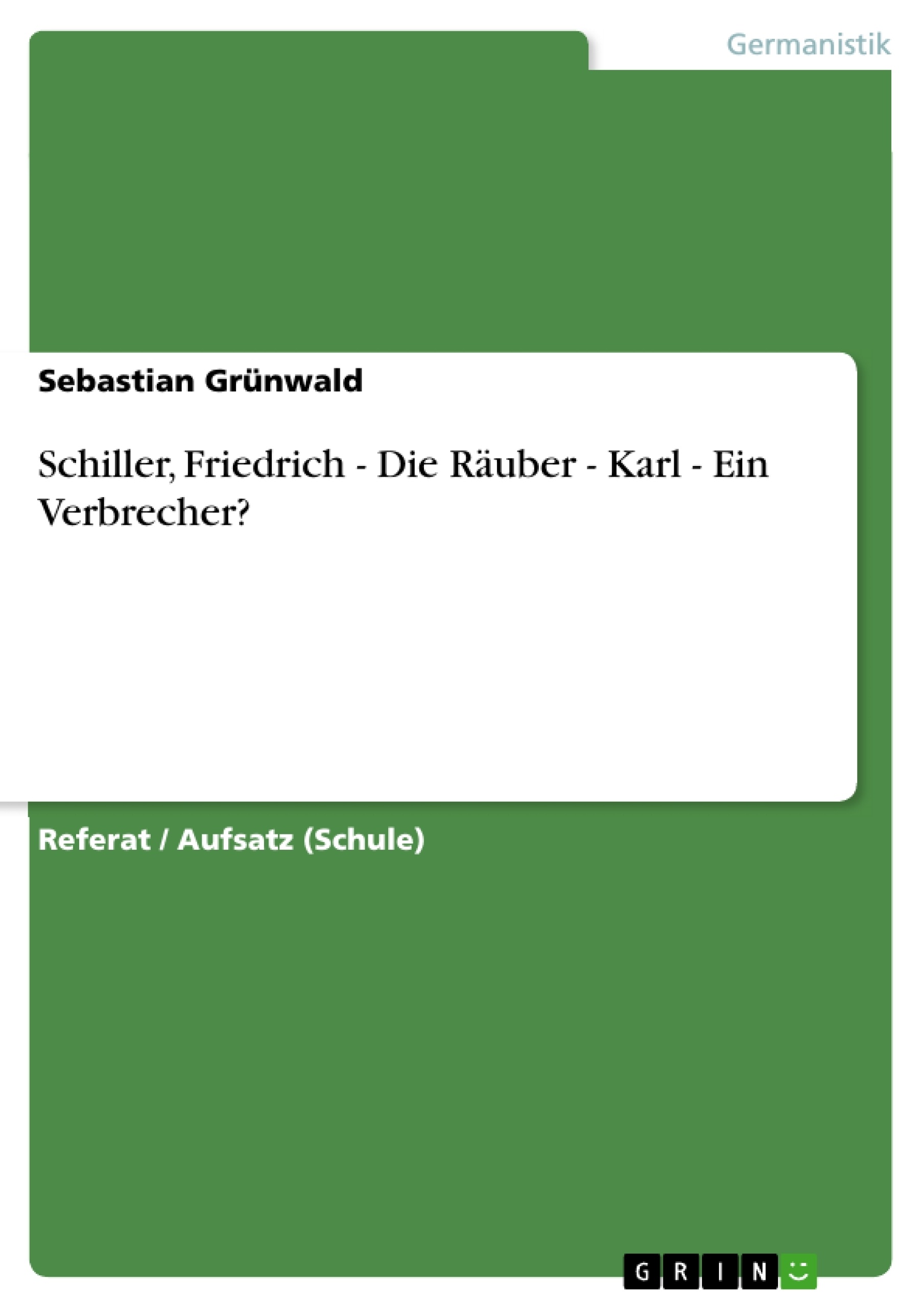Was, wenn die Wurzel allen Übels nicht im Handeln eines Einzelnen liegt, sondern in einem Geflecht aus verweigerter Liebe und blindem Autoritätsglauben? Friedrich Schillers "Die Räuber", ein Schlüsselwerk des Sturm und Drang, stürzt uns mitten in einen verheerenden Vater-Sohn-Konflikt, der die moralischen Grundfesten einer ganzen Gesellschaft in Frage stellt. Im Zentrum steht Karl Moor, der charismatische, aber von seinem Vater verstoßene Sohn, der sich einer Räuberbande anschließt und zum Rächer der Entrechteten wird. Doch ist er wirklich ein Verbrecher, oder vielmehr ein tragischer Held, getrieben von den Ungerechtigkeiten einer Welt, die ihn verraten hat? Sein Bruder Franz, hässlich und von väterlicher Liebe ausgeschlossen, spinnt ein Netz aus Intrigen und Grausamkeiten, um Karl zu vernichten und das Erbe an sich zu reißen. Ist er der wahre Schurke des Dramas, oder ein Produkt seiner lieblosen Erziehung? Diese packende Analyse beleuchtet die komplexen psychologischen Hintergründe der Figuren und enthüllt, wie die verhängnisvolle Dynamik innerhalb der Familie Moor zu einem Strudel aus Gewalt, Verrat und schließlich zur Selbstzerstörung führt. Dabei wird die Frage aufgeworfen, inwieweit die Erziehung und das soziale Umfeld die Entwicklung eines Menschen prägen und ob es überhaupt möglich ist, sich den Zwängen der Gesellschaft zu entziehen. Schillers "Die Räuber" ist mehr als nur ein spannendes Drama; es ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Themen Freiheit, Gerechtigkeit und der Suche nach dem Sinn des Lebens. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für die Abgründe der menschlichen Seele und die gesellschaftlichen Ursachen von Kriminalität interessieren. Entdecken Sie die vielschichtigen Charaktere und die zeitlose Relevanz dieses Klassikers der deutschen Literatur, der auch heute noch zum Nachdenken über die Verantwortung von Eltern und die Konsequenzen von Ausgrenzung anregt. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Recht und Unrecht verschwimmen und die Grenzen zwischen Gut und Böse neu definiert werden. Erleben Sie die Wucht des Sturm und Drang, einer Epoche, die den Aufbruch zu neuen Ufern wagte und die Fundamente der alten Ordnung erschütterte. Begleiten Sie Karl auf seinem Weg von einem idealistischen Jüngling zu einem gejagten Räuberhauptmann und stellen Sie sich die Frage: Wer ist hier wirklich schuldig? Eine literarische Reise, die Sie so schnell nicht vergessen werden!
Die Räuber -- Karl - Ein Verbrecher?
Hausaufsatz
11. Klasse Note: 1-2
Während des 18. Jahrhunderts vollzieht sich in Deutschland, sowie auch in vielen weiteren Teilen Europas wie Frankreich und England, ein starker Umbruch sowohl politischen, literarischen als auch philosophischen Denkens. Aus der Aufklärung und der Rokokodichtung entwickelt sich etwa ab 1765 eine Epoche, die später als ,,Sturm und Drang" bekannt werden sollte. Auslöser dafür ist hauptsächlich eine Bewegung der jungen Generation mit dem Wunsch, sowohl irdisch als auch geistig frei zu sein. Neben dem durch Jean-Jacques Rousseaus geprägten Leitprinzip ,,Zurück zur Natur!" wird für die Stürmer und Dränger somit auch die Auflehnung gegen äußere Zwänge zu einem Grundprinzip. Diesmal wird - zumindest auf der Bühne und in der Literatur - jedoch nicht nur der Machtmißbrauch des Adels angeklagt, sowie es für die Epoche des Aufklärung typisch ist. Der Sturm und Drang richtet sich gegen jede Art der Bevormundung, darunter insbesondere die Bevormundung des Vaters gegenüber dem Sohn. Somit wird der Sturm und Drang etwa ab 1770 zu einem Leitmotiv für die Auflehnung der Söhne gegen ihre Väter. Die Epoche endet 1781 mit Friedrich von Schillers (1759-1805) ,,Die Räuber" . Angeregt durch Christian Friedrich Daniel Schubarts (1739-1791) Werk ,,Zur Geschichte des menschlichen Herzens" verarbeitet er hier als 20-jähriger seine Vorstellung von Freiheit und Bekämpfung von Unterdrückung: Im Mittelpunkt steht ein Vater/Sohn Konflikt zwischen dem alten Grafen von Moor und seinen zwei Söhnen: Der kräftige, intelligente Karl, der ein ausschweifendes Leben geführt hat, sowie sein mißgestalteter, gewissenloser Bruder Franz, der Karl so sehr haßt, dass er das Bittschreiben Karls, nach Hause kehren zu dürfen, fälscht und damit den Vater veranlasst, Karl zu verstoßen, welcher zum Hauptmann einer Räuberbande wird. Die Literaturhistoriker Ernst und Erika von Borries haben sich dieses Themas angenommen und sind zu dem Schluß gelangt, dass an und für sich der Vater schuld an der tragischen Entwicklung seiner beiden Söhne sei.
,,Den Jüngeren machte er zum Verbrecher, da er ihm seine Liebe verweigerte, denälteren, weil er ihn erst verzärtelte und dann blind und tö richt verstieß." meinen die beiden Literaturhistoriker. Für den gewöhnlichen Betrachter scheint diese Aussage nicht völlig einleuchtend. Ist es also wirklich der Vater, der für die ,,Vernichtung" seiner beiden Söhne verantwortlich ist?
Wenn die von Borries davon ausgehen, Karl werde durch die Hand des Vaters ein Verbrecher, so stellt sich erst einmal die Frage, inwiefern Karl im Stück die Figur eines Verbrechers darstellt. Natürlich wird er, als er sich zum Hauptmann wählen läßt, rein theoretisch zur Figur eines Schurken. An und für sich verschreibt sich Der Räuber Moor aber weiterhin der Gerechtigkeit. ,,Sag ihnen, mein Handwerk ist Wiedervergeltung - Rache ist mein Gewerbe." (S. 71) meint er in II,3 im Dialog mit einem Pater, der die Taten der Räuberbande anklagt. Karl ist also nicht direkt ein Bösewicht, sondern ein Kämpfer für die Gerechtigkeit: Er bestiehlt nur die reichen Fürsten und Bischöfe. Ungerechtigkeit erduldet er nicht. ,,Laßdich nimmer unter meiner Bande sehen!" (S. 65) befiehlt er in II,3 Schufterle und schliesst ihn so kurzerhand aus der Bande aus, als dieser wohlwollend über seine Mordtaten erzählt. Im späteren Verlauf des Stückes zeigt sich die gute Seite Karls noch deutlicher. So schenkt er großzügig dem gebrechlichen Hausknecht Daniel einen Sack voll Geld und wenn man von einem Attentat auf eine Stadt absieht, das auch nur notwendig war, um den Räuber Roller vor dem Galgen zu bewahren, so wird Karl selbst nie zu einem Mörder. Selbst als er seinen Vater im 5. Akt in einem dunklen Verließ wiederfindet, wo in Franz gefangenhält, entschließt er sich niemals, Franz töten zu lassen. ,,Aber ich sage dir, ich schärf es dir hart ein, liefr' ihn mir nicht tot! Dessen Fleisch will ich in Stücken reißen und hungrigen Geiern zu Speise geben, der ihm nur die Haut ritzt oder ein Haar kränkt!" (S. 118) sagt er mahnend zu Schweizer. Er steht also fest zu seinen Prinzipien, niemand zu töten, solange es nicht tatsächlich notwendig erscheint, und sich nur das Notwendigste zu nehmen. Obwohl diese Tatsachen Karl durchaus in einem positiven Licht erscheinen lässt, macht er dennoch den großen Fehler, anzunehmen, ,,dass sich die Ungerechtigkeit in der Welt durch Gewalt beseitigen lasse, aber schließlich einsehen muss, dass er sich getäuscht hat" (Q: Texte und Methoden, S. 187). ,,Es ist aus! - Ich wollte umkehren und zu meinem Vater gehn, aber der im Himmel sprach, es soll nicht sein." (S. 137) . meint er in der letzten Szene, als er die Rückkehr in ein Leben mit seiner Braut Amalia für aussichtslos hält. Indem er am Ende einem namenlosen Hungerleider das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld zu verdienen gibt, gibt er auch der Weltordnung ihr Recht zurück.
Von diesen Standpunkten aus betrachtet ist es wohl falsch, Karl als einen Verbrecher zu bezeichnen. Verbrecher halten sich nicht an moralische Vorschriften. Die Funktion des Verbrechers scheint eigentlich mehr sein Bruder Franz zu übernehmen.
Auf den ersten Blick wirkt die Stellung zwischen Franz und Karl wie eine typische Antagonist-Protagonist Konstellation: Franz ist der klassische Gegenspieler zu Karl und der alte Moor lediglich eine alte, gebrechliche, zur Ausführung der Pläne von Franz notwendige Figur ohne wirkliche Einflußnahme auf das Geschehen. Die Stellung von Franz als Schurke wird dem Betrachter gleich gegen Ende von I,1 klar. Franz liest den gefälschten Brief über das angeblich auf Karl ausgesetze Kopfgeld vor, fällt seinem Vater um den Hals und meint zu ihm noch: ,,O, daßer Moors Namen nicht trüge! daßmein Herz nicht so warm für ihn schlüge! Die gottlose Liebe, die ich nicht vertilgen kann, wird mich noch einmal vor Gottes Richterstuhl anklagen." (S. 8). Doch bereits als Franz allein ist und hämisch meint ,,Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt, daßich nicht Herr bin. Herr mußich sein, daßich das mit Gewalt ertrotze, wozu mir die Liebenswürdigkeit gebricht" (S. 15) werden seine bösen Absichten deutlich: Er hat vor, um jeden Preis seinen Bruder ,,vom Herzen des Vaters loszulö sen" (S. 12) . Im weiteren Verlauf des Stückes wird der schlechte Charakter von Franz noch verstärkt. So versucht Franz in I,3 die Braut Karls, Amalia, für sich zu gewinnen und in III,1 möchte er Amalia sogar gewaltsam zu seiner Mätresse machen.
,,Und wir vermö gen doch wirklich die Bedingungen des Lebens zu verlängern, warum sollten wir sie nicht auch verkürzen kö nnen?" (S. 37) meint er nachdenkend und scheinbar völlig gewissenlos in II,1, als er auf die Idee kommt, den nahenden Tod des alten Grafen zu beschleunigen indem er Herrmann beauftragt, dem alten Grafen die Nachricht zu übermitteln, er selbst hätte Karl ,,auf der Walstatt den Geist aufgeben sehen." (S. 41) . Als der alte Graf bei dieser Nachricht in Ohnmacht fällt und von Franz schon für tot gehalten wird, wirkt Franz fast schon wie ein Psychopath als er ruft: ,,Nun sollt ihr den nackten Franz sehen und euch entsetzen!" (S. 51) . Die Gewissenlosigkeit Franz steigert sich noch weiter bis in IV,5, als sich herausstellt, das Franz seinen Vater im Hungerturm gefangenhält sowie sie sich auch im IV. Akt in der 2. Szene zeigt, als er aus Angst vor Karl diesen einfach töten lassen will: ,,Bei deinem Gehorsam befehl' ich dir, morgen darf der Graf nimmer unter den Lebendigen wandeln." (S. 94) meint er gewissenlos zu Daniel.
Aus heutiger Sicht betrachtet könnte man Franz also wohl die Schuld für die ,,Vernichtung" der beiden Söhne zuschieben: Schließlich scheint er - neben Spiegelberg - der Auslöser dafür zu sein, dass Karl zu einem Räuberhauptmann wird. Zu dem Zeitpunkt, als Karl sich in I,2 seiner Räuberbande Treue bis in den Tod schwört, ist der dramatische Ausgang des Stückes bereits vorprogrammiert. Doch ist Franz dann auch rückwirkend für seine eigene Vernichtung verantwortlich, als er sich durch schlechtes Gewissen und Panik selbst erdrosselt? Um die Meinung der Literaturhistoriker völlig beurteilen zu können, muß man sich überlegen, ob Menschen von Geburt auf schlecht sein können. Geht man nicht davon aus und zieht nun noch die Erziehung als eine wichtige Grundlage des Sturm und Drangs in Betracht so eröffnet sich ein neues Bild: Schiller stellt hier zwei unterschiedliche Brüder gegenüber: Franz, der unmoralische, rationelle, ungläubige Mensch sowie Karl, eine Kraftkerl, ein Rächer der moralischen Weltordnung. Es wird offensichtlich, dass beide Brüder unterschiedlich erzogen wurden. Bereits in II,2, als der alte Moor ,,Garstiger Franz!" (S. 42) ausruft, zeigt sich die Ablehnung des Vaters gegenüber seinem jüngeren Sohn und weiter in V,2: ,,Warum ließich mich doch durch die Ränke eines bö sen Sohnes betö ren?" (S. 132) . Der Vater verweigert Franz Liebe und Zuneigung. Nun ist es zwar nicht klar, ob Franz von Kindheit auf an ein schlechter Mensch war - dann nämlich wäre die Haltung des Vaters noch zu verstehen gewesen - aber wenn Rousseau in seinem Sturm und Drang Werk É mile meint, ,,dass der natürliche Mensch durch seinen Instinkt richtig geleitet wird, sodass Kind keinem Zwang gehorchen, sondern seine geistigen und kö rperlichen Fähigkeiten frei entfalten soll." (Q: Texte und Methoden, S. 184) so kann man davon ausgehen, dass der Vater Franz wohl aufgrund seines Äusserem nicht geliebt hat: Ein schwächlicher, hässlicher Sohn ziehmt sich nicht für einen Grafen. Franz war also immer der Unterdrückte, der nicht Beachtete, dem es nicht möglich war, in einer natürlichen Familie mit Liebe und Geborgenheit, die für die Zeit des Sturm und Drangs solch große Bedeutung erlangt hat, aufzuwachsen. Er kann sich nicht frei entfalten und zu einem Genie entwickeln wie sein Bruder. In ihm entwickelt sich stattdessen Haß und ein rationales, berechnendes Denken.
Anders bei seinem Bruder Karl. Diesen hat sein Vater immer geliebt, was sich ganz deutlich in V,2 zeigt, als der alte Graf ohne es zu wissen die Liebe zu seinem älteren Sohn gesteht: ,,O mein Karl! mein Karl! wenn du um mich schwebst im Gewand des Friedens!" (S. 131) . Karl ist also der einzige Sohn, dem sein Vater Liebe entgegen gebracht hat, der sich in seiner Familie frei zu einem Genie, zu einem Kraftkerl, wie er sich später bezeichnen wird, entwickeln konnte. Er wird zu einem Mensch, der versucht, die Welt mit seinen moralischen Grundprinzipien zu verändern. ,,Mir ekelt vor meinem tintenklecksenden Säkulum, wenn ich in meinem Plutarch lese von großen Menschen" (S. 15) spricht er zu Spiegelberg und spielt damit deutlich auf den Geniekult der Stürmer und Dränger an. Nach den Vorbild der alten griechischen und römischen Sagen will er die Welt verändern. Er muß dafür jedoch in Kauf nehmen, Böses zu tun und das führt letztendlich zu seiner Vernichtung. Allerdings ist das nicht seine eigene Schuld. Wenn Benno von Wiese schreibt, dass ,,(...) er viel lieber das Idyll der väterlichen Haine gewählt (...) hätte (...)" (Q: von Wiese: Friedrich Schiller, S. 148) , so er hat er damit Recht: Karl möchte gerade nach seinem wilden Leben zurückkehren als ihm durch das blinde Handeln seines Vaters der Weg dafür versperrt wird: Ihm bleibt keine andere Wahl, als sich - teils durch die Verführung Spiegelbergs - der Räuberbande als Hauptmann anzuschliessen. Dass er dieser Aufgabe nicht gewachsen ist, bemerkt er allerdings erst zum Schluß, als ihm aufgrund seiner Prinzipien keine Möglichkeit mehr für einen Rückweg geboten wird. Als moralisch verantwortungsbewusster Kraftkerl stellt er sich dem Gericht, während der Rationalist Karl sich ,,feige" selbst erdrosselt.
Der alte Graf von Moor handelt also zweimal völlig unverantwortlich: Zum ersten Mal, als er seine Aufgabe als Vater mißachtet und Franz die väterliche Liebe entzieht und zum zweiten Mal, als er blindlings noch nicht einmal selbst den von Franz gefälschten Brief liest, sondern sofort seinen Sohn verstößt. Als in ihm im II. Akt Reuhe aufsteigt, ist es für eine Rettung schon viel zu spät.
In wie weit ist nun die Deutung der beiden Literaturhistoriker einleuchtend? Es ist richtig, wenn behauptet wird, der Vater habe in seiner Aufgabe als Erzieher versagt, wenn man sich das Werk in einen historischen Zusammenhang im Bezug auf die Epoche betrachtet; heutzutage würde der Betrachter wohl anders reagieren. In Zusammenhang mit dem Sturm und Drang ist die Deutung jedoch durchaus plausibel. Dass liebevolle Erziehung, wie sie zum Beispiel in Ausschnitten in Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) ,,Die Leiden des jungen Werthers" beschrieben wird, notwendig ist, damit sich ein Kind frei zu einem natürlichen Individum, eventuell auch zu einem Genie , entwickeln kann ist genauso einleuchtend, wie die Tatsache, dass ein plötzliches Verweigern dieser Liebe zu ungeahnten Konsequenzen führen kann. Davon auszugehen, ein Mensch ohne liebevolle Erziehung werde gleich zu einem Schurken, der selbst vor Mord nicht zurückschreckt, scheint wage, zumal in Schillers Werk ja keine Ansätze über die Thematik der Erziehung zu finden sind. Natürlich besteht diese Möglichkeit, jedoch scheint Schiller hier wohl mehr auf den dramaturgischen Effekt geachtet als sich um die psychologischen Folgen einer falschen Erziehung Gedanken gemacht zu haben. Franz ist notwendig als Protagonist zu Karl und bildet dabei den klassischen Bösewicht, der auf den ersten Blick als eigentlicher Schuldiger für den Ausgang des Stückes verantwortlich gemacht werden könnte, auf den zweiten Blick sich jedoch durchaus als jemand herausstellt, dem durch verweigerte väterliche Liebe keine Chance auf ein besseres Leben gewährt wurde. Besonders wird das in den letzten Szenen, in denen er, obwohl er ungläubig ist, verzweifelt um Gnade und Vergebung betet deutlich: ,,Ich bin kein gemeiner Mö rder gewesen, mein Herrgott (...)" (S. 129) bittet er und man könnte als Betrachter fast schon Beileid empfinden, verstärkt noch dadurch, dass ihm bis zuletzt nicht vergeben wird. Bei genauer Betrachtung stellt also letztendlich der alte Moor die Weichen für das Geschehen, zumindest diejenigen für Karl.
Widersinnig scheint lediglich die Annahme der von Borries, dass Karl ein Verbrecher sei.
Durch die für Schiller unangenehme Jugend - er wurde beispielsweise gezwungen in die ihm widerstrebende Militärschule einzutretten - lässt sich eine Verbindung und Identifikation mit Karl als Genie und Kraftkerl mit Schiller vermuten. Ein Kraftkerl ist jedoch nichts Negatives: Er versucht die Welt - von seinem Gefühl geleitet - nach seinen moralischen Wertevorstellungen ins Positive zu verändern. Auch Karl versucht dies, wenn es ihm auch nicht ganz gelingt, Böses völlig zu vermeiden. Da er all seine Taten mit seinem Gewissen letztendlich nicht vereinbaren kann, sieht er keinen anderen Ausweg mehr, als sich der Justiz zu stellen und das macht ihn letztendlich mehr zu einem ,,edlen" Räuber als zu einem Verbrecher.
Besonders in Betracht auf die Aspekte der Erziehung bietet Schillers ,,Die Räuber" ein Stück, das auch heute noch Anknüpfungspunkte modernen Bewußtseins liefert. Schliesslich haben sich nicht nur während der Epoche des Sturm und Drangs Jugendliche nach Freiheit gesehnt und sich gegen die Autorität aufgelehnt - man beachte zum Beispiel nur mal die Grundsätze der Jugend während der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Somit ist bietet das Werk mit der Thematik des ,,Eltern/Kind" Konflikts ein stetig aktuelles Thema, von dem sich Jugendliche wie Erwachsene gleichermassen angezogen fühlen. Das erklärt womöglicherweise auch die Tatsache, dass die Stücke des Sturm und Drangs auch heute noch gern und häufig aufgeführt werden.
Primärliteratur:
Die Räuber von Friedrich von Schiller (erstmals im Jahre 1776 erschienen), Philipp Reclam Jun. Ausgabe 1962, Stuttgart
Sekundärliteratur:
(1) Texte und Methoden: Lehr und Arbeitsbuch Deutsch, herausgegeben von Hermann Stadler, Cornelsen Verlag , Ausgabe 1992, Berlin - benutzt für Textstellen aus Rouseaus Émile sowie für Daten über Friedrich Schiller
Häufig gestellte Fragen zu "Die Räuber -- Karl - Ein Verbrecher?"
Worum geht es in dem Hausaufsatz?
Der Hausaufsatz analysiert Friedrich Schillers "Die Räuber" im Kontext der Sturm und Drang Epoche, wobei der Fokus auf der Frage liegt, ob Karl Moor als Verbrecher bezeichnet werden kann und inwieweit die Erziehung durch seinen Vater eine Rolle bei der tragischen Entwicklung der Brüder spielt.
Welche historischen Hintergründe werden im Aufsatz beleuchtet?
Der Aufsatz beleuchtet den politischen, literarischen und philosophischen Umbruch des 18. Jahrhunderts in Deutschland, insbesondere die Entstehung der Sturm und Drang Epoche aus der Aufklärung und Rokokodichtung. Zentrale Themen wie der Wunsch nach Freiheit, die Rückkehr zur Natur und die Auflehnung gegen Autoritäten werden thematisiert.
Welche Rolle spielt der Vater-Sohn-Konflikt in "Die Räuber"?
Der Vater-Sohn-Konflikt zwischen dem alten Grafen von Moor und seinen Söhnen Karl und Franz steht im Mittelpunkt der Analyse. Der Aufsatz untersucht, wie die unterschiedliche Behandlung der Söhne durch den Vater deren Entwicklung beeinflusst hat und inwieweit der Vater für das tragische Schicksal der Söhne verantwortlich ist.
Inwiefern wird Karl Moor als Gerechtigkeitskämpfer dargestellt?
Der Aufsatz argumentiert, dass Karl Moor nicht einfach als Verbrecher dargestellt werden kann, sondern als ein Kämpfer für Gerechtigkeit, der Ungerechtigkeit nicht erduldet und nur die Reichen bestiehlt. Seine Prinzipien und sein Handeln werden im Kontext seiner moralischen Vorstellungen analysiert.
Wie wird Franz Moor im Aufsatz charakterisiert?
Franz Moor wird als der Antagonist zu Karl dargestellt, der durch Neid, Hass und Gewissenlosigkeit motiviert ist. Der Aufsatz untersucht, wie Franz' Handlungen zur Eskalation des Konflikts beitragen und inwieweit er als Auslöser für Karls Weg zum Räuberhauptmann angesehen werden kann.
Welchen Einfluss hatte die Erziehung auf die Entwicklung von Karl und Franz?
Der Aufsatz betont die Bedeutung der Erziehung im Kontext des Sturm und Drang und argumentiert, dass die unterschiedliche Erziehung von Karl und Franz maßgeblich deren Charakter und Schicksal beeinflusst hat. Karl erhielt väterliche Liebe und konnte sich frei entwickeln, während Franz die Liebe des Vaters verweigert wurde und somit Hass und ein rationales Denken entwickelte.
Wie bewertet der Aufsatz die Schuld des Vaters an der Tragödie?
Der Aufsatz kommt zu dem Schluss, dass der alte Graf von Moor durch seine mangelnde Liebe zu Franz und seine blinde Verstoßung von Karl eine entscheidende Rolle bei der tragischen Entwicklung der Söhne gespielt hat. Sein Verhalten wird als unverantwortlich und als Ursache für das Unglück der Familie Moor dargestellt.
Welche Sekundärliteratur wird im Aufsatz verwendet?
Der Aufsatz greift auf Sekundärliteratur zurück, insbesondere auf "Texte und Methoden: Lehr und Arbeitsbuch Deutsch" und "Friedrich Schiller" von Benno von Wiese, um die Analyse zu untermauern und den historischen Kontext zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Sebastian Grünwald (Author), 2000, Schiller, Friedrich - Die Räuber - Karl - Ein Verbrecher?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100031