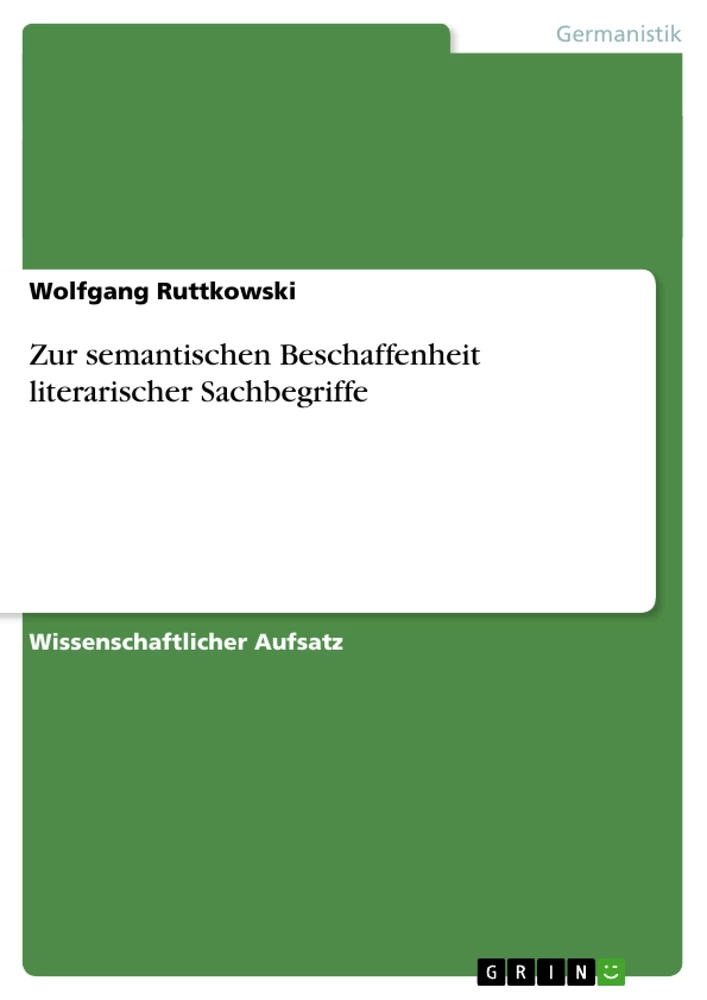Inhalt
I. Einleitung:
1) Das Problem der Verflechtung von "Halbsynonymen"
2) in verschiedenen Anwendungsbereichen
3) durch Neuschöpfung von Begriffen durch verschiedene Schulen
4) als Verschärfung des allgemeinen Problems geisteswissenschaftlicher Begriffe
Il. Sinnverwandte Begriffe in einer Sprache:
1) "einfache Synonyme"
2) mehrere Versionen eines Begriffs
3) eingegrenzte Bedeutungen
4) pejorative Bedeutungseingrenzung
Ill. Sinnverwandte Begriffe in mehreren Sprachen:
1) einfachster Fall: aus einer Sprachwurzel
2) übersetzte: Akzeptanz von Übersetzungen
3) obskure nachbarsprachliche
4) geographisch und kulturell entlegene und dennoch geläufige
5) falsche Erwartungen an übersetzte Begriffe
6) literarische Sonderbedeutung allgemeinsprachlicher Begriffe
IV Spezielle Probleme:
1) "Echte" Synonyme?
2) Fließende Übergänge zwischen "Fremdworten" und "Lehnworten"
3) Gelegentliche Bevorzugung von Fremdworten und ihre Gründe
4) Das Problem der Auffächerung von Begriffen in Literaturlexika
5) Der Bedeutungswandel von Gattungsnamen
6) Homonyme
(Zuerst als Vortrag vor dem Jap. Germanistenverband, Chuo Daigaku Tokyo, 6.6.1998)
1) Beim Zusammenstellen der Sachbegriffe für zwei Literaturwörterbücher (zuerst ein dreisprachiges und dann ein siebensprachiges[i]) fiel mir die besonders starke semantische Verflechtung dieser Begriffe auf. Mit "Verflechtung" meine ich ein Netz von "Halbsynonymen", das die säuberliche Abgrenzung und Definition solcher Begriffe erschwert, besonders in mehrsprachigen Lexika.
Dieses Problem ist in der japanischen Literaturwissenschaft mindestens so stark ausgeprägt wie in den europäischen[ii], also nichts Neues. Wir machen es uns aber nicht klar, wenn wir nur mit einzelnen Sachbegriffen umgehen. Erst wenn wir diese voneinander abgrenzen müssen, wird es uns bewusst. Beispiel: Wenn wir entscheiden müssen, ob verwandte Begriffe, als Synonyme, unter ein Stichwort gehören, oder ob sie getrennt aufgeführt werden müssen.
2) Das Problem der "Verflechtung" besteht auch für die verschiedenen Anwendungsbereiche literarischer Sachbegriffe in ganz verschiedenem Maße[iii]. Besonders charakterisiert es die Begriffe, die Todorov[iv] als "historische" bezeichnet (z. B. Gattungs- und Epochennamen). Westliche metrische und rhetorische Begriffe werden von diesem Problem dagegen weniger betroffen und moderne sogen. "systematische" Oberhaupt nicht.
3) Das beste Beispiel für das Dilemma ist der Gattungsbegriff selbst[v] und seine Abgrenzung gegen verwandte Begriffe wie "Genre", „Art", „Typ", "Schreibweise", "Textsorte", "Grundbegriff, -haltung und -struktur"[vi]. An diesem Beispiel sieht man auch bereits einen Grund für die Sprachverwirrung: jede "Schule" der Germanistik und Linguistik hat den Ehrgeiz, ihre eigenen Begriffe für mehr oder weniger gleiche Phänomene einzufahren. (Das Wort "Grundbegriffe" erinnert sofort an Staiger und die immanente Interpretationsschule; "Textsorte" und "Schreibweise" sind modernere Begriffe etc.) Ich sage nicht, dass diese Begriffe aus verschiedenen Schulen genau das gleiche meinen! Natürlich setzen sie verschiedene Akzente. Und darin liegt eben das Problem. Man kann sich in jedem einzelnen Falle fragen, ob es wirklich notwendig war, neue Begriffe einzuführen, oder ob die herkömmlichen auch gereicht hätten.
4) Das Problem ist natürlich zugleich ein allgemeines "geisteswissenschaftlicher" (oder sollten wir sagen: "geistes vor wissenschaftlicher"?) Begriffe: im Unterschied zu denen der exakteren Naturwissenschaften erlauben sie zumeist keine klaren Abgrenzungen. Sie setzen eher Akzente[vii]. (Dazu gibt es bereits eine ausgiebige Sekundärliteratur.)
Komplikationen, die bereits innerhalb und zwischen den europäischen Terminologien auftauchen (und das heißt: zwischen Terminologien, die mehr oder weniger aus einer kulturellen Tradition erwachsen sind), werden noch viel offenkundiger, wenn man über den eigenen Kulturkreis hinausschaut.
Anschließend möchte ich einige Modellfälle für solche Komplikationen vorführen und durch Diagramme graphisch veranschaulichen. (Ich beanspruche nicht, dass diese Zusammenstellung vollständig ist.) Die Kreise in den Diagrammen stellen Bedeutungsbereiche dar, und zwar werden deutsche Begriffe durch ungebrochene Kreise dargestellt, fremdsprachliche durch gebrochene; tatsächlich "synonyme" Begriffe durch konzentrische Kreise gleicher Größe (man wird sehen, dass dies kaum vorkommt), sogen. "Halbsynonyme" oder "teilweise synonyme" durch a-konzentrische Kreise (der Bedeutungsumfang deckt sich nur teilweise). Umfassendere Begriffe werden durch größere Kreise dargestellt und eingegrenztere Begriffe durch kleinere. -
Das Problem bei einer solchen graphischen Veranschaulichung ist jedoch, dass diese Kreise nur einen grob hinweisenden Charakter haben können. Im literaturwissenschaftlichen Sprachgebrauch steht nicht jedes Mal fest, wie weit sich die Kreise decken (d.h. wie viel die Begriffe jeweils gemeinsam haben) und wie groß, im Bedeutungsumfang, jeder im Verhältnis zu den andern sein sollte. Außerdem kann natürlich jeder dieser (Begriffs)Kreise im Zentrum seines eigenen Umfeldes von (Unter)Begriffen stehen. Nicht immer kann man "Bedeutungshierarchien" feststellen.
[...]
[i] Literaturwörterbuch (mit Robin E. Blake, Bern: Francke 1966) und Nomenclator Litterarius (mit Christine De Vos, Patrick De Jaegher, William Langebartel, Gerald J. MacDonald, Akira Yamamoto, Bern: Francke 1980).
[ii] In Hisamatsu Sen'ichis Vocabulary of Japanese Literary Aesthetics (Tokyo: Centre for East Asian Cultural Studies 1963) finden sich häufig resignierende Wendungen wie "Originally ... From the Heian Period on, it was used to express ... As an aesthetic concept, it stands for ... or, at times, for ... Its specific connotation changes from ... to...”.
[iii] Vergl. Werner Strube: "Sprachanalytisch-philosophische Typologie literaturwissenschaftlicher Begriffe" in Zur Terminologie der Literaturwissenschaft (Hg. Christian Wagenknecht, Stuttgart: Metzler 1988) 35-49.
[iv] Introduction a la litterature fantastique (Paris 1970) S.7ff.
[v] Vergl. Klaus Hempfer: Gattungstheorie (München 1973).
[vi] Vergl. Emil Staiger: Grundbegriffe der Poetik (Zürich 1946 u.ö.) und mein Buch Die literarischen Gattungen: Reflexionen über eine modifizierte Fundamentalpoetik (Bern: Francke 1968).
[vii] Über die Eigenart geisteswissenschaftlicher und besonders literaturwissenschaftlicher Begriffe vergl. Hempfer (Anm.4, S.14f.). Ihre Folgen für den Sprachgebrauch der Literaturwissenschaft wurden am eindrucksvollsten und an vielen instruktiven Beispielen dargestellt von Harald Fricke in Die Sprache der Literaturwissenschaft (München 1977).
-
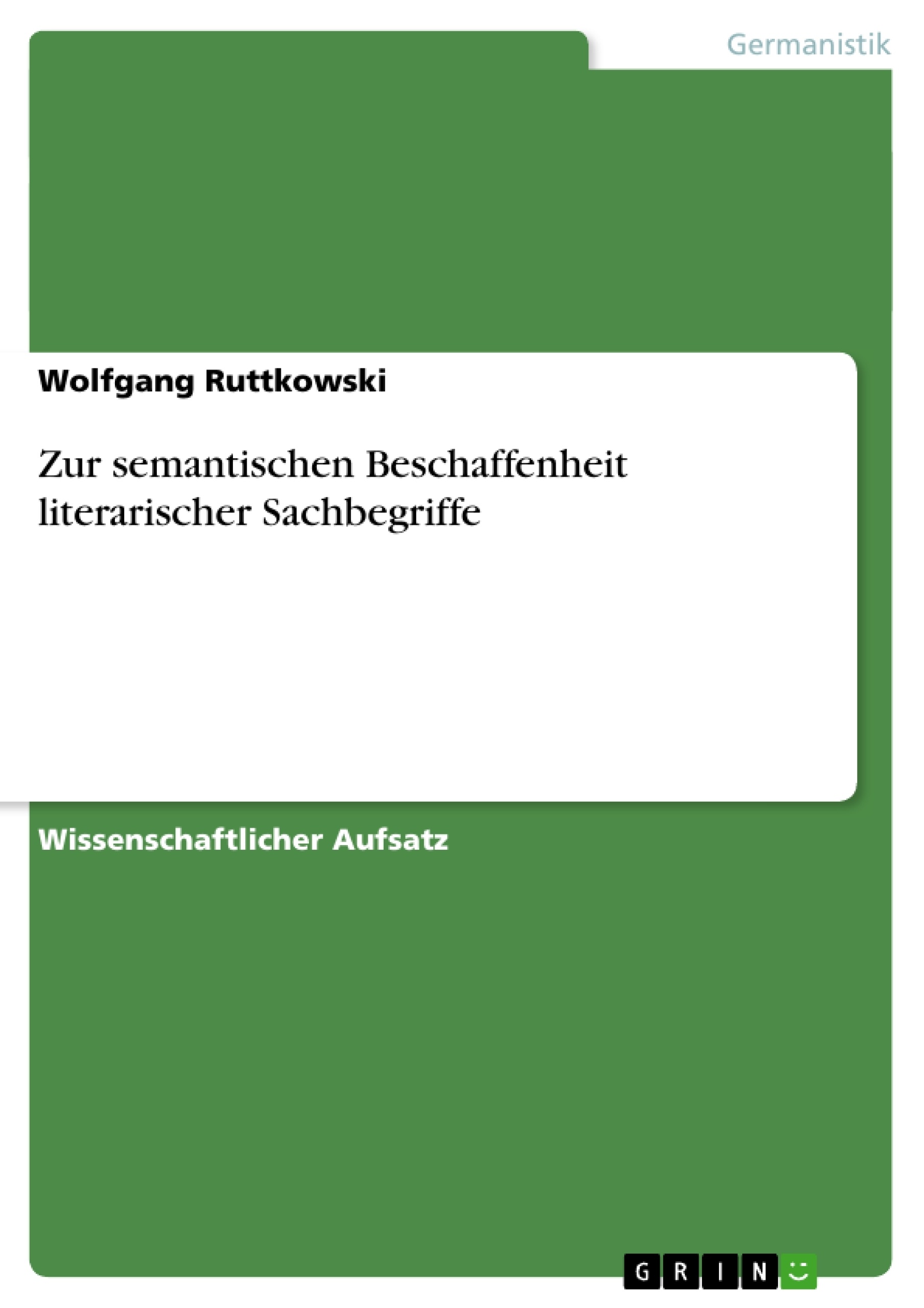
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.