Leseprobe
Inhalt
Abkürzungen
I. Vorbemerkungen
1. Die Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert
1.1. August Schleicher
2. Schleicher und die rekonstruierte idg. Ursprache
2.1. Die Notwendigkeit von Rekonstruktion und deren Kennzeichnung
2.2. Die 'Fabel in indogermanischer Ursprache'
2.2.1. Schleichers Originalversion der Fabel von 1868
2.2.2. Delbrücks 'Korrekturen' von 1880
2.2.3. Hirts Version von 1939
2.2.4. Lehmann und Zgustas Version von 1979
2.2.5. Peters' Version von 1980
2.3. Schrieb Schleicher seinen Rekonstrukten Realitätswert zu?
2.4. Schleicher und die 'Unversehrtheit' der Ursprache
3. Die Schleichersche Stammbaumtheorie und das 'Leben' von Sprache
4. Abschließende Bemerkungen
Appendix A – Abbildungen
Appendix B – Quellen
Appendix C – Sekundärquellen
Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
I. Vorbemerkungen
Eine der vielleicht wichtigsten Persönlichkeiten der indogermanistischen Sprachwissenschaft ist August Schleicher. Sein Name taucht in Zusammenhang mit vielen methodischen Neuerungen auf, die aus der Linguistik nicht mehr wegzudenken sind, wie z.B. der Rekonstruktion von Grundformen. In etwa ebenso häufig findet sein Name allerdings auch in Verbindung mit Irrtümern der früheren Linguistik Erwähnung.
Die vorliegende Arbeit wird sich nun damit beschäftigen, wie viel von dem, was August Schleicher – im positiven oder negativen Sinn – zugeschrieben wird, tatsächlich der Realität entspricht.
Zu diesem Zweck ist die Arbeit wie folgt gegliedert: Einleitend wird ein kurzer Überblick über die Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts gegeben, es folgt eine kurze Biographie August Schleichers. Anschließend wird das wohl meistdiskutierte seiner Werke, nämlich seine Fabel in idg. Grundsprache, mitsamt einigen neueren Versionen betrachtet. Im Anschluß daran wird der Fragestellung nachgegangen, welche der Schleicher zugeschriebenen Errungenschaften oder Irrtümer tatsächlich auf ihn zurückgehen.
1. Die Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert
Das 19. Jahrhundert war für die Linguistik im allgemeinen ein sehr produktives, für die Indogermanistik im speziellen vergleichbar mit einer zweiten Geburtsstunde, nachdem im vorangehenden Jahrhundert von Sir William Jones die Verwandtschaft des Sanskrit mit einigen europäischen Sprachen erkannt worden war. Vor allem im Bereich der Methodik brachte das 19. Jahrhundert viele Neuerungen für Linguistik und Indogermanistik.
Im Jahr 1816 versuchte Franz Bopp1 (1791-1867) den wissenschaftlichen Beweis einer Verwandtschaft der sog. idg. Sprachen untereinander zu erbringen, indem er ihre Grammatiken vergleichend nebeneinanderstellte.
Den Grundstein für die moderne Art diachroner Sprachbetrachtungen legte Jakob Grimm (1785-1863) mit seiner Deutschen Grammatik, die 1819 und in den darauffolgenden Jahren entstand.
Die erste Professur, die sich mit den idg. Sprachen beschäftigte, wurde 1821 in Berlin eingerichtet und mit Franz Bopp besetzt. Sie war als Professur für „Orientalische Litteratur und Allgemeine Sprachkunde“ ausgeschrieben und noch v.a. auf Sanskrit spezialisiert.
A.F. Pott führte mit seinen Etymologischen Forschungen von 1833-36 eine neue, wissenschaftlichere Methode der Etymologie ein, die v.a. streng den Lautwandel der Sprachen beachtete.
In seinem Compendium von 1861 führte August Schleicher die Rekonstruktion und die Stammbaumtheorie in die Sprachwissenschaft ein.
Sein Schüler Johannes Schmidt entwickelte aus dieser schließlich die sogenannte Wellendarstellung2.
Und das sind nur einige der wichtigsten Neuerungen in der Sprachwissenschaft, die aus diesem Jahrhundert stammen. Sie alle aufzuzählen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, doch mag ersichtlich geworden sein, wie kreativ und ergiebig diese Zeit war und in welchem Rahmen Schleichers ebenfalls sehr produktives Schaffen zu betrachten ist.
Um einen besseren Eindruck von seiner Persönlichkeit zu erhalten, folgt hier eine Kurzbiographie Schleichers.
1.1. August Schleicher
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
August Schleicher wurde am 19. Februar 1821 als Sohn des Arztes Johann Gottlieb Schleicher und dessen Frau Henriette in Meiningen geboren. Bereits ein Jahr später zog die Familie nach Sonneberg bei Coburg, wo Schleicher aufwuchs.
In seiner Jugend befaßte er sich u.a. mit Musik und Naturbeobachtungen.
Von Ostern 1835 bis zum He]rbst 1840 besuchte er das Gymnasium in Coburg und erhielt dort u.a. von Direktor Forberg Privatunterricht in der arabischen Sprache.
Vom Herbst 1840 bis Ostern 1841 studierte er in Leipzig Theologie, wechselte dann aber nach Tübingen, wo er sich allerdings immer mehr von diesem Fach entfremdete und sich statt dessen mit Hegelscher Philosophie, Sanskrit, Persisch und semitischen Sprachen beschäftigte. Er studierte bei dem Sanskritisten Lassen, dem Romanisten Diez und dem klassischen Philologen Friedrich Ritschl.
Seit 1846 war er als Dozent an der Universität Bonn tätig, wo er allerdings nur wenige Vorlesungen hielt, sondern vielmehr eifrig seine eigenen Kenntnisse zu erweitern suchte.
Im Jahr 1850 trat Schleicher eine Professur in Prag an, wo er allerdings nicht recht glücklich wurde. Daher folgte er gerne einer Einladung nach Jena im Jahr 1857, wo ihm eine Stelle an der Universität in Aussicht gestellt wurde. Allerdings kam es nie zu einer Universitätsanstellung Schleichers in Jena.
Seit 1858 war er korrespondierendes Mitglied der russischen Akademie der Wissenschaften, eine Berufung nach Petersburg lehnte er jedoch ab, vielleicht aufgrund der schlechten Erfahrungen, die er in Prag gemacht hatte.
In den Jahren 1856 bis 1868 gab er gemeinsam mit Adalbert Kuhn die Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebieteder arischen, celtischen und slawischen Sprachen heraus.
Am 6. Dezember 1868 erlag er – wohl aufgrund seines äußerst intensiven Arbeitens geschwächt – einer Lungenentzündung.
Zu seinen wichtigsten Werken zählen Die Formenlehre der kirchenslavischen Sprache von 1852, das Handbuch der litauischen Sprache von 1856/57 und das Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen von 1861.
2. Schleicher und die rekonstruierte idg. Ursprache
2.1. Die Notwendigkeit von Rekonstruktion und deren Kennzeichnung
Im Zusammenhang mit Schleichers Rekonstrukten trifft man gelegentlich auf die Aussage, Schleicher habe nicht nur als erster aktiv Rekonstruktion sprachlicher Formen betrieben, sondern auch als erster die Notwendigkeit von Rekonstruktion erkannt. Dabei wird gerne auf sein Compendium verwiesen3 oder auf seine Formenlehre der kirchenslavischen Sprache von 1852, in deren Vorrede er schreibt:
„Bei dem vergleichen von sprachformen zweier verwanten sprachen suche ich vor allem die verglichenen formen beide auf ire mutmaszliche grundform, d.i. die gestalt, die sie abgesehen von den späteren lautgesetzen haben müssen, zurückzufüren oder doch überhaupt auf eine gleiche stufe der lautverhältnisse zu bringen.[...]“4
Doch laut Holger Pedersen5 wurde bereits vor Schleicher auf diese Notwendigkeit hingewiesen, und zwar bereits im Jahre 1837 durch Theodor Benfey. In dessen Rezension von Potts Etymologischen Forschungen bemängelt er, daß Pott die Formen der idg. Sprachen mit denen des Sanskrits vergleicht. Benfey ist der Ansicht, das Sanskrit möge zwar als bis dahin älteste bekannte idg. Sprache dem ursprünglichen Zustand am nächsten stehen, doch habe es trotzdem „in vielen einzelnen Punkten eigentümliche Abschwächungen oder Übergänge, durch welche es ursprüngliches eingebüsst hat“6. Zudem gibt er einige Beispiele, welche „die Nothwendigkeit, bei der Lautvergleichung über den vorliegenden Zustand des Sanskrits hinauszugehen“, hervorheben sollen.7 Demnach fordert er, daß zumindest Vorstufen des Sanskrits rekonstruiert werden sollen. Einige Seiten später fordert er sogar, nicht das Sanskrit – oder Vorstufen desselben – als Referenzpunkt beim Vergleichen zu nutzen, sondern anhand aller vorhandenen Sprachzeugnisse durch Vergleich eine Grundform zu rekonstruieren:
„[...] Bei weitem klarer würde uns das lautliche Verhältnis dieser Sprachen entgegentreten, wenn der Verfasser [Pott] nicht den Zustand des Sanskrits, wie wir es kennen, zum Regulativ genommen hätte, sondern diese Sprachen sich gegenseitig regulierten.[...]“8
Demnach war August Schleicher tatsächlich nicht der erste, der die Notwendigkeit von Rekonstruktion erkannte und darauf hinwies. Ihm gebührt dagegen der Verdienst, als erster diese Methode konsequent angewendet und sie dadurch als neue Technik in die Sprachwissenschaft eingeführt zu haben.
Desweiteren wird Schleicher gerne die Einführung des Asteriskus < * > zur Kennzeichnung rekonstruierter Formen zugeschrieben. So sprach laut Koerner 1976 Otto Jespersen 1921 vom „ingenious device, due to Schleicher, of denoting such [reconstructed] forms by means of a preposed asterisk to distinguish them from forms actually found“9 und W. Keith Percival habe 1969 daran erinnert, „that Schleicher introduced the use of starred forms into Indo-European linguistics“10. Auch Koerner selbst gesteht, diese Meinung noch in einem Aufsatz von 1972 vertreten zu haben.
Zweifelsfrei benutzt Schleicher in seinem Compendium einen Asteriskus zur Kennzeichnung rekonstruierter Formen – mit Ausnahme der durch „idg.“ oder „ur-idg.“ als rekonstruiert gekennzeichneten Grundformen –, doch war er nicht der erste, der diese Art der Markierung verwendete. Koerner11 weist darauf hin, daß bereits vor dem Erscheinen von Schleichers Compendium von Hans Conon von der Gabelentz (1807-74) und Julius Loebe (1805-1900) in ihrem Glossarium der Gothischen Sprache von 1843 ein Stern zur Markierung theoretisch wahrscheinlicher, aber nicht oder nur in Komposita oder Ableitungen belegter Formen benutzt wurde. In ebendiesem Werk wird auch das Kreuz- Zeichen zur Markierung unwahrscheinlicher Formen eingeführt. Gabelentz und Loebe haben es „für zweckmäßig erachtet, solche Wörter, welche als (wirklich oder angeblich) gothisch von griechischen oder römischen Schriftstellern angeführt werden, [...] nicht wegzulassen, sondern mit einem † zu bezeichnen“12. Und obwohl sie es „bedenklich [fanden], auf solche einfache, ganz imaginäre Würzel zurückzugehen, wie [Eberhard Gottlieb] Graff [1780-1841] nach indischen Mustern in seinem [Althochdeutschen]Sprachschatz [Berlin, 1834-42] aufstellt“13, konnten sie dennoch
„nicht umhin, in vielen Fällen zwar für uns verlorene, aber doch als bestehend denkbare Stammwörter [...] aufzustellen, aus welchen eine Anzahl vorhandener Wörter abgeleitet erschienen, oder einfache Wörter anzunehmen, welche nur noch in Zusammensetzung vorkommen.“14 Solche im Prinzip rekonstruierten Formen kennzeichneten sie mit einem Sternzeichen.15
Koerner weist darauf hin, daß – offenbar unabhängig von Gabelentz und Loebe – auch Theodor Benfey (1809-1881) zu Beginn des zweiten Teils seiner Sanskritgrammatik bemerke: „durch *** bezeichne ich hypothetische Formen.“16 Allerdings habe Benfey in seinen ersten Beiträgen in Kuhns Zeitschrift17 keine Besternung verwendet, obwohl er auch dort häufig auf die Sanskritgrammatik verwiesen habe. Der erste seiner Beiträge in Kuhns Zeitschrift, in dem er besternte Formen aufführt, erscheint erst 185818. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte schon ein anderer besternte Formen in Kuhns Zeitschrift eingeführt: Leo Meyer (1830-1910) nahm bereits 1857 in einem Aufsatz in Kuhns Zeitschrift19 Bezug auf BenfeysSanskritgrammatikundverwendeteBesternungundDoppelbesternungzurKennzeichnung nicht oder nur indirekt belegter Formen.
[...]
1 Franz Bopp, ÜBER DAS CONJUGATIONSSYSTEM DER SANSKRITSPRACHE IN VERGLEICHUNG MIT JENEM DER GRIECHISCHEN, LATEINISCHEN, PERSISCHEN UND GERMANISCHEN SPRACHE. NEBEN EPISODEN DES RAMAJAN UND MAHABHARAT IN GENAUEN METRISCHEN ÜBERSETZUNGEN AUS DEM ORIGINALTEXT UND EINIGEN ABSCHNITTEN AUS DEN VEDA'S , Frankfurt 1816.
2 Johannes Schmidt, DIE VERWANDTSCHAFTSVERHÄLTNISSE DER INDOGERMANISCHEN SPRACHEN , Weimar 1872.
3 Schleicher 1876, S. 8/9 Anm. (Alle Angaben beziehen sich auf die vierte Auflage des Compendiums von 1876, die in unserer Bibliothek vorliegt.)
4 Delbrück 1880, S. 47/48.
5 Pedersen 1931, S. 267.
6 Benfey 1837, S. 5.
7 ibidem, S. 7.
8 ibidem, S. 9/10.
9 Jespersen 1921, S. 81 (vgl. Koerner 1976, S. 185).
10 Percival 1969, S. 417/18.
11 Koerner 1976.
12 Gabelentz/Loebe 1843, S. vi-vii.
13 ibidem.
14 ibidem.
15 ibidem.
16 Benfey, Theodor, VOLLSTÄNDIGE GRAMMATIK DER SANSKRITSPRACHE , 1852, S. 71, Anm. 1. (vgl. Koerner 1976, S. 186).
17 Aufgrund des höheren Bekanntheitsgrades dieses Namens ziehe ich ihn an dieser Stelle dem Titel „ZEITSCHRIFT FÜR VERGLEICHENDE SPRACHFORSCHUNG “, der in der Bibliographie verwendet wird, vor.
18 Benfey, Theodor, EINIGE URSPRÜNGLICHE CAUSALIA AUSBILDUNGEN DURCH SANKSKRITISCH PAYA, Kuhns Zeitschrift 70, S. 50-61, 1858.
19 Meyer, Leo, DAS SUFFIX KA IM GOTHISCHEN , Kuhns Zeitschrift 6, S. 1-10, 1857.
- Arbeit zitieren
- Christiane Gante (Autor:in), 2003, August Schleicher und die indogermanische Ursprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/115247
Kostenlos Autor werden
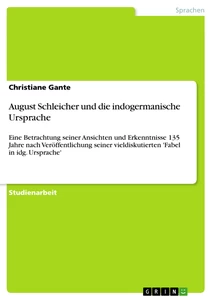
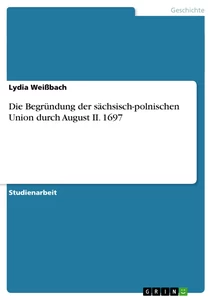


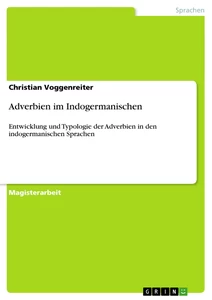

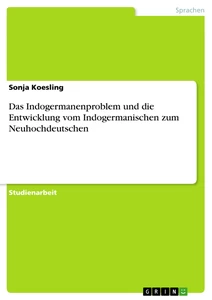
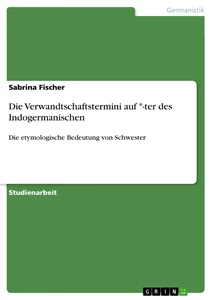
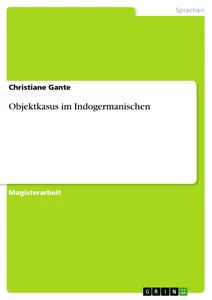
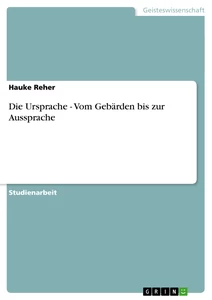

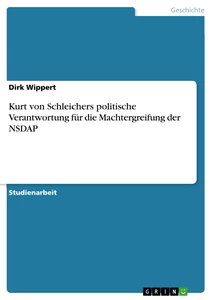
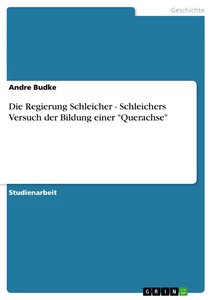
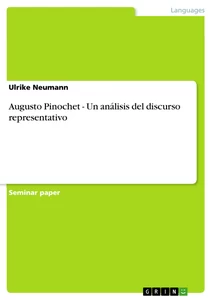
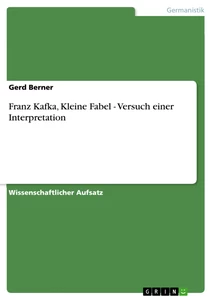
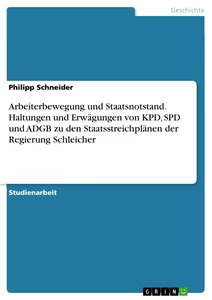
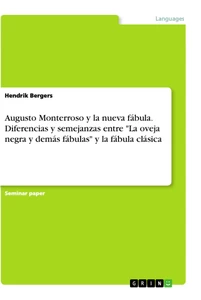


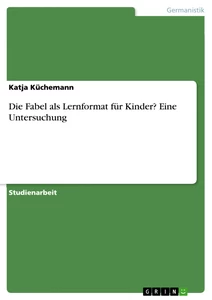
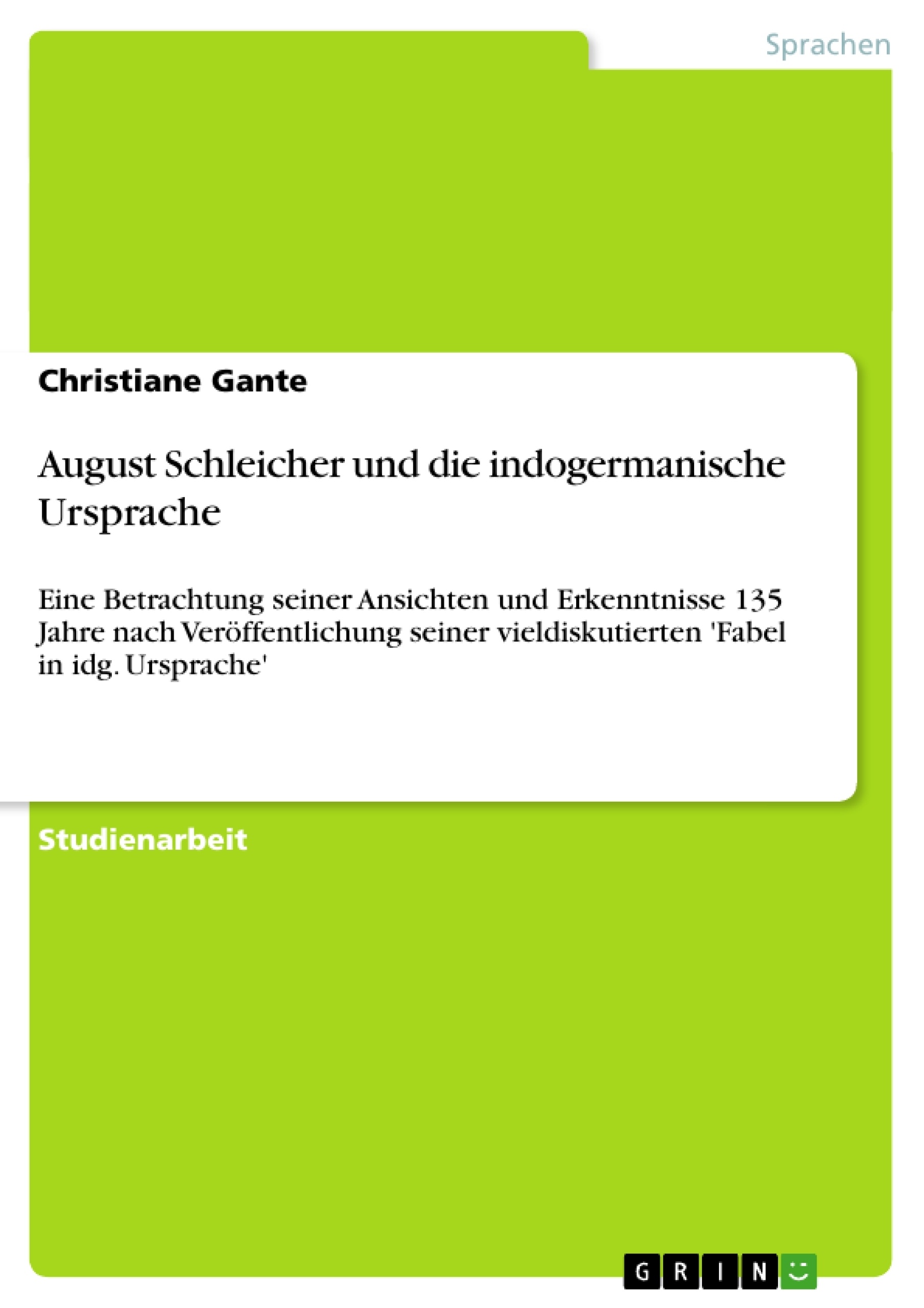

Kommentare