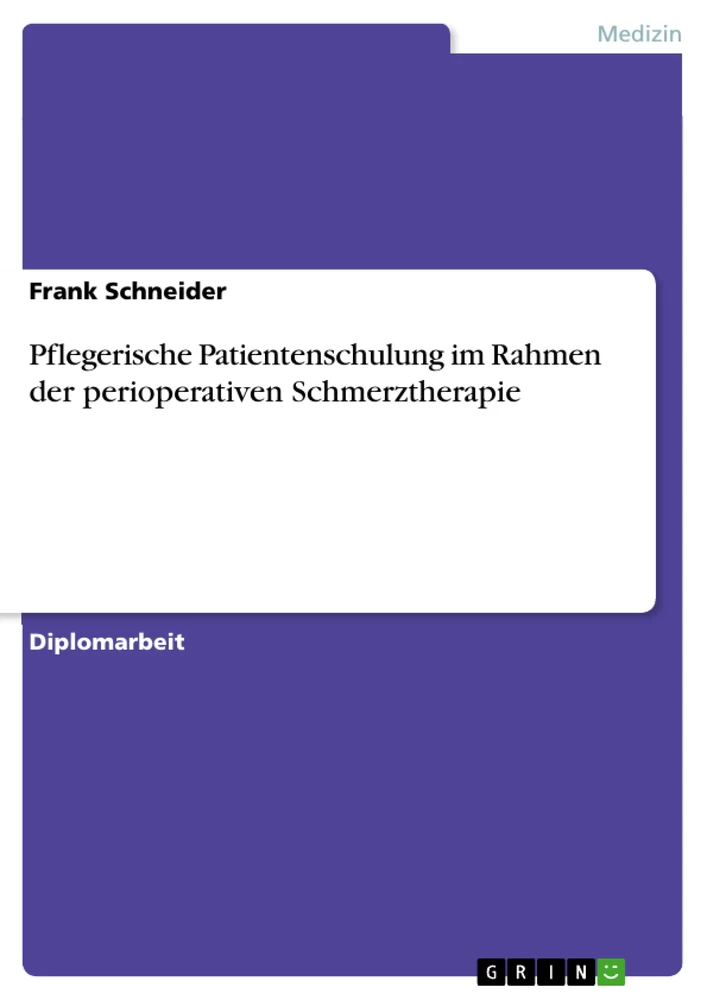In der Chirurgie haben Schmerzen eine zentrale Bedeutung. Zum einen gelten sie als einer der Hauptauslöser für den Patienten, um sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Zum anderen können Schmerzen die Diagnostik, Therapie und den Heilungsprozess erschweren oder sogar verhindern.
Schmerzprävention und -therapie stellen daher, neben anderen Parametern, eine der Voraussetzungen für eine effiziente und erfolgreiche chirurgische Krankenbehandlung dar.
Die Komplexität und Individualität des Schmerzerlebens machen einen übergreifenden Ansatz notwendig, der nicht nur die medizinische Diagnose fokussiert, sondern auch die Bedürfnisse des Patienten integriert.
Insbesondere in der postoperativen Phase spielt die Mitarbeit des Patienten eine bedeutende Rolle. Zum einen bestimmen seine Schmerzäußerungen Art und Inhalt der Behandlung; zum anderen kann er durch sein eigenes Verhalten einen Beitrag zur Schmerzreduktion leisten. Damit der Patient in der Lage ist, dies zu erfüllen, benötigt er verständliche Informationen, Beratung und Schulung. Ziel soll ein mündiger Patient sein, der seine persönlichen Ressourcen zum Gelingen der Behandlung zur Verfügung stellen kann. Hierfür bieten sich präoperative Schulungen und Beratungen an, durch die der Patient spezifische Informationen erhält und Verhaltensmaßnahmen einüben kann. Durch den ständigen Kontakt des Patienten zum Pflegepersonal und die damit verbundenen Austauschbeziehung, sind hier die Pflegefachkräfte besonders gefordert.
In der vorliegenden Studie sollen deshalb die Auswirkungen einer präoperativen Patientenschulung auf die perioperative Schmerzsituation des Patienten und dessen Zufriedenheit untersucht werden. Dabei werden zwei Schulungsformen in Betracht gezogen. Zum einen die individuelle Schulung im Rahmen eines pflegerischen Beratungsgesprächs und zum anderen die allgemeine Informationsvermittlung in Form einer pflegerischen Aufklärungsbroschüre.
Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der beiden Schulungsformen und deren Effekte auf den Behandlungsverlauf darzustellen, um abschließend eine Empfehlung für die praktische Umsetzung von schmerztherapeutischen Patientenschulungen auf chirurgischen Bettenstationen begründen zu können.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Vorbemerkungen
1 Forschungsidee
2 Patientenschulung und -beratung
2.1 Definition
2.2 Ziel und Zweck der Patientenedukation
2.2.1 Erhöhung der Selbstpflegefähigkeit
2.2.2 Erhöhung der Partizipationsfähigkeit
2.2.3 Kritische Auseinandersetzung
2.3 Schulungs- und Beratungsmethoden
2.4 Patientenschulung als Aufgabe der Pflegefachkräfte
2.4.1 Pflegerische Praxis
2.4.2 Aspekte aus dem Krankenpflegegesetz
2.4.3 Standpunkte nationaler und internationaler Verbände
2.4.4 Auffassungen in der Pflegewissenschaft
3 Schmerz
3.1 Definition
3.2 Schmerzarten und -formen
3.3 Das Schmerzerlebnis
3.3.1 Schmerzbeeinflussende Faktoren
3.3.2 Schmerzwahrnehmung
3.4 Diagnostik
3.4.1 Anamnese
3.4.2 Schmerzbeschreibung
3.4.3 Schmerzmessung
4. Schmerztherapie
4.1 Bedeutung in der perioperativen Phase
4.2 Medikamentöse Methoden
4.2.1 Therapie chronischer Schmerzen
4.2.2 Therapie akuter Schmerzen
4.3 Nicht medikamentöse Methoden
4.4 Kreislauf der Schmerztherapie
4.4.1 Diagnose
4.4.2 Therapie
4.4.3 Symptomkontrolle
4.4.4 Anpassung von Diagnose und Therapie
5 Mögliche Effekte präoperativer Informationen
5.1 Einfluss auf die Angst
5.2 Erhöhung der Partizipationsfähigkeit
5.3 Erhöhung der Selbstpflegekompetenz
5.4 Psychologische Effekte
6 Zentrale Fragestellung und Forschungsziel
7 Studiendesign
7.1 Rahmenbedingungen
7.1.1 Untersuchungsumfeld
7.1.2 Schmerzerfassung und -therapie im Feld
7.2 Empirische Methode
7.2.1 Aufteilung in Vergleichsgruppen
7.2.2 Ein- und Ausschlusskriterien
7.2.3 Methoden und Datenerhebungsverfahren
8 Ethische Überlegungen
8.1 Unterstützung durch das direkte Untersuchungsumfeld
8.2 Einverständnis der Befragten
8.3 Anonymität der Datenerhebung
8.4 Aufwand für die Teilnehmer
8.5 Sinnhaftigkeit der Untersuchung
9 Gütekriterien
9.1 Reliabilität
9.2 Validität
9.3 Objektivität
10 Planung der Patientenschulungen
10.1 Standardisierung des Aufklärungsgespräches
10.2 Erstellung der Broschüre
11 Pretests
11.1 Fragebogen
11.2 Aufklärungsgespräch
11.3 Broschüre
12 Datenerfassung und Aufbereitung
12.1 Auswertungsgesamtheit
12.2 Datenverarbeitungstechnik
12.3 Datenauswertung
13 Ergebnisse
13.1 Zusammensetzung der Vergleichsgruppen
13.2 Fragenkomplex A
13.3 Fragenkomplex B
13.4 Fragenkomplex C
14 Dateninterpretationen
14.1 Auswirkungen der Schulungen auf das Befinden
14.2 Auswirkungen der Schulungen auf die Schmerzintensität
14.3 Auswirkungen auf die Bewertung des therapeutischen Teams
14.4 Auswirkungen auf die Beurteilung der Partizipationsmöglichkeiten
14.5 Auswirkungen auf die Selbstpflegekompetenz
15 Empfehlung für die pflegerische Praxis
16 Persönliche Betrachtungen und Ausblicke
Literaturverzeichnis
Broschürenverzeichnis
Anhang
Anhang 1: Schmerzskala des Kreiskrankenhaus Grevenbroich
Anhang 2: Kurvenblatt des Kreiskrankenhaus Grevenbroich
Anhang 3: Patientenfragebogen
Anhang 4: Formular „Patientenanamnese“
Anhang 5: Verhaltensregeln für die Pflegekraft beim Aufklärungsgespräch
Anhang 6: Checkliste des pflegerischen Aufklärungsgesprächs
Anhang 7: Patientenbroschüre
Anhang 8: Detaillierte Datenaufbereitung
Fragenkomplex A
Fragenkomplex B
Fragenkomplex C
Fragenkomplex Anamnese
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Gleichgewicht als Ziel der Pflege
Abb. 2: Gate-Control-Theorie
Abb. 3: WHO-Stufenschema
Abb. 4: Kreislauf des Schmerzprozesses
Abb. 5: Gleichgewicht durch Therapie und Beratung
Abb. 6: Aufteilung der Studiengruppen
Abb. 7: Ein- und Ausschlussverfahren
Abb. 8a: Testhalbierungsreliabilität in der Kontrollgruppe
Abb. 8b: Testhalbierungsreliabilität in der Visitengruppe
Abb. 8c: Testhalbierungsreliabilität in der Broschürengruppe
Abb. 9: Bildung der Auswertungsgesamtheit
Abb. 10: Bildung der Auswertungsgesamtheit (prozentuale Verteilung)
Abb. 11: Zusammensetzung der drei Patientengruppen
Abb. 12: Durchschnittliche Verteilung von Alter, Geschlecht und BMI
Abb. 13: Verteilung des OP-Risikos nach ASA-Kriterien
Abb. 14: Verteilung der Operationsgruppen nach Häufigkeit
Abb. 15: Präoperative Emotionen (Frage 1)
Abb. 16: Ursachen präoperativer Ängste (Frage 2)
Abb. 17: Beantwortung präoperativer Fragen (Frage 3)
Abb. 18: Wirkung der Aufklärungen (Frage 4)
Abb. 19: Bevorzugte Informationsquellen (Frage 5a und 5b)
Abb. 20: Verlauf der Schmerzintensitäten (Frage 6)
Abb. 21: Verständlichkeit der Schmerztherapie (Frage 7a)
Abb. 22: Spezifisches Fachwissen des Personals (Frage 7c)
Abb. 23: Behandlungssouveränität des Pflegepersonals (Frage 7d)
Abb. 24: Beachtung geäußerter Schmerzen (Frage 7e)
Abb. 25: Beachtung der Individualität (Frage 7f)
Abb. 26: Möglichkeit zur Mitwirkung bei der Therapie (Frage 7g)
Abb. 27: Große Bedeutung der Mitarbeit in der Therapie (Frage 8a)
Abb. 28: Wurden notwendige Kompetenzen vermittelt (Frage 8b)
Abb. 29: Auswirkungen auf zukünftige Schmerzsituationen (Frage 8d)
Abb. 30: Schmerzlinderung durch Mitarbeit des Patienten (Frage 8c)
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Kriterien des Expertenstandard Schmerzmanagement
Tab. 2: Schmerzformen (vgl.: Kress 2004, Kap. 1.2.1, S. 2-3)
Tab. 3: 15 Adjektive zur Schmerzbeschreibung
Tab. 4: Nichtmedikamentöse Methoden (vgl. Zens 1993, S. 197ff)
Tab. 5: Zusammenfassung der Operationen in sieben Obergruppen
Tab. 6: Ergebnisse der Lesbarkeitstests
Tab. 7: Verteilung von Alter, Geschlecht und BMI
Vorbemerkungen
Im Folgenden wird die klinische Studie zur pflegerischen Patientenschulung im Rahmen der perioperativen Schmerztherapie dargestellt, sowie die Ergebnisse und Schlussfolgerungen entsprechend veranschaulicht.
Die Begriffe Visite bzw. Pflegevisite werden mehrmals verwendet. Hierzu findet man in der Literatur die unterschiedlichsten Definitionen. Die von Heering 1995 veröffentlichte Beschreibung deckt sich mit dem Verständnis des Autors: „Die präoperative Pflegevisite ist der Kontakt zwischen einer Pflegeperson und dem Patienten am Vortag einer geplanten Operation.“ (Heering 1995, S.302) Die in der Untersuchung durchgeführten Pflegevisite umfasste jedoch nicht den gesamten Pflegeprozess, sondern konzentriert sich im wesentlichen auf den Bereich der Schmerzbehandlung. Die genaue Art, Inhalt und Durchführung dieser Visiten werden im Text eingehend beschrieben und erläutert.
Zur besseren Lesbarkeit werden synonym auch die Bezeichnungen „pflegerisches Aufklärungsgespräch“ oder „Pflegegespräch“ verwendet.
Zur Vereinfachung wird weiterhin durchweg von den Patienten in der männlichen Form die Rede sein. Gemeint sind aber immer sowohl männliche als auch weibliche Patienten.
1 Forschungsidee
Eine chirurgische Behandlung wird oft automatisch mit Schmerzen in Verbindung gebracht.
Oft ist es gerade das Symptom Schmerz, welches den Betroffenen auf eine Erkrankung aufmerksam macht und ihn schließlich zum Arzt gehen lässt. Hoppe (1990) führt hierzu aus, dass nahezu jede stationäre Einweisung auch aufgrund eines individuellen Schmerzgeschehens erfolgt. Typische Beispiele für chirurgische Einweisungsdiagnosen sind Knochenbrüche, Gallensteinkoliken und Entzündungen des Darmes. All diese Erkrankungen sind mit spezifischen Schmerzen verbunden und machen häufig eine operative Behandlung notwendig.
Aber auch die operative Behandlung selber, ob ambulant oder stationär, ist regelmäßig mit Schmerzen verbunden. Bereits in der Vorbereitung zur Operation wird der Patient mit unangenehmen Voruntersuchungen wie Blutabnahmen oder endoskopischen Diagnoseverfahren konfrontiert. Im weiteren Verlauf stellen die Operationswunden eine schmerzhafte Verletzung des Körpers dar. Folge ist, dass der Patient nach Abklingen der Narkose, mehr oder minder ausgeprägte operationsbedingte Schmerzen hat. Diese wiederum können die postoperative Rehabilitation erschweren. So wird z.B. die Mobilisation oft durch den Wundschmerz beeinträchtigt.
In der chirurgischen Behandlung haben Schmerzen also eine zentrale Bedeutung. Zum einen gelten sie als einer der Hauptauslöser, um sich in eine chirurgische Behandlung zu begeben. Zum anderen können Schmerzen die Diagnostik, Therapie und den Heilungsprozess erschweren oder sogar verhindern.
Schmerzprävention und -therapie stellen daher, neben anderen Parametern, eine der Voraussetzungen für eine effiziente und erfolgreiche chirurgische Krankenbehandlung dar.
„Schmerzen beeinflussen das physische, psychische und soziale Befinden und somit die Lebensqualität der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Darüber hinaus entstehen dem Gesundheitswesen durch schmerzbedingte Komplikationen und einer daraus oft erforderlichen Verweildauerverlängerung im Krankenhaus sowie durch die Chronifizierung von Schmerzen beträchtliche Kosten, die durch ein frühzeitiges Schmerzmanagement in den meisten Fällen erheblich verringert werden könnten.“ (DNQP 2005, S. 13)
Die Komplexität und Individualität des Schmerzerlebens machen einen übergreifenden Ansatz notwendig, der nicht nur die medizinische Diagnose fokussiert, sondern auch die Bedürfnisse des Patienten integriert.
Insbesondere in der postoperativen Phase spielt die Mitarbeit des Patienten eine bedeutende Rolle. Zum einen bestimmen seine Schmerzäußerungen Art und Inhalt der Behandlung; zum anderen kann er durch sein eigenes Verhalten einen Beitrag zur Schmerzreduktion leisten. Damit der Patient in der Lage ist, dies zu erfüllen, benötigt er verständliche Informationen, Beratung und Schulung. Ziel soll ein mündiger Patient sein, der seine persönlichen Ressourcen zum Gelingen der Behandlung zur Verfügung stellen kann. Hierfür bieten sich präoperative Schulungen und Beratungen an, durch die der Patient spezifische Informationen erhält und Verhaltensmaßnahmen einüben kann. Durch den ständigen Kontakt des Patienten zum Pflegepersonal und die damit verbundenen Austauschbeziehung, sind hier die Pflegefachkräfte besonders gefordert.
In der vorliegenden Studie sollen deshalb die Auswirkungen einer präoperativen Patientenschulung auf die perioperative Schmerzsituation des Patienten und dessen Zufriedenheit untersucht werden. Dabei werden zwei Schulungsformen in Betracht gezogen. Zum einen die individuelle Schulung im Rahmen eines pflegerischen Beratungsgesprächs und zum anderen die allgemeine Informationsvermittlung in Form einer pflegerischen Aufklärungsbroschüre.
Ziel ist es, die Vor- und Nachteile der beiden Schulungsformen und deren Effekte auf den Behandlungsverlauf darzustellen, um abschließend eine Empfehlung für die praktische Umsetzung von schmerztherapeutischen Patientenschulungen auf chirurgischen Bettenstationen begründen zu können.
2 Patientenschulung und -beratung
2.1 Definition
Der Begriff „Schulung“ wird im Brockhaus Lexikon unter anderem als „Ausbildung in einer Fertigkeit“ (Brockhaus AG, 2002) definiert. Das heißt, durch die Schulung wird einer Person eine bestimmte Fähigkeit vermittelt, mit dem Ziel diese zukünftig selbständig auszuführen bzw. zu nutzen.
Passend dazu wird der Begriff Beratung folgendermaßen beschrieben: „Beratung , eine Hilfeleistung, bei der (im Gegensatz zu den meist verhältnismäßig einfachen gelegentlichen Ratschlägen im Alltag) der umfassende Versuch gemacht wird, einem oder mehreren Menschen (etwa einer ganzen Familie) bei der Bewältigung von gesundheitlichen, erzieherischen, seelischen oder schulischen Problemen zu helfen...“. (Brockhaus AG, 2002)
Fasst man diese beiden Definitionen zusammen, so kann man unter Schulung und Beratung eine Dienstleistung für eine Person verstehen, die es ihr ermöglichen soll, bestimmte Anforderungen selber bewältigen zu können. Beispiele für solche Anforderungen im Bereich der Betreuung von kranken Menschen sind z.B. das Einhalten eines Diätplanes, das selbständige Durchführen krankengymnastischer Übungen oder der Umgang mit emotional belastenden Diagnosen. Ziel ist demnach die Befähigung zur selbständigen Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit. „Die Patientenschulung und -beratung (Patientenedukation) dient dazu, Patienten zur Selbstpflege zu befähigen und ihnen Autonomie, Würde und Selbstkontrolle im Alltag zurück zu geben;...“ (Menche 2001, S. 282)
2.2 Ziel und Zweck der Patientenedukation
Den in Kapitel 2.1 angeführten Definitionen ist zu entnehmen, das die Patientenedukation das Ziel der Vermittlung von Fähigkeiten und Kompetenzen verfolgt. Im Rahmen der Gesundheits- und Krankenpflege kann dies mit dem Begriff der Selbstpflegefähigkeit beschrieben werden.
2.2.1 Erhöhung der Selbstpflegefähigkeit
Dieser Begriff entstammt dem Selbstpflege-Defizit-Modell nach Dorothea Orem. Diesem Modell folgend kann der Mensch zwei Formen der Fürsorge wahrnehmen: self care (Selbstpflege) und dependent care (Abhängigenpflege). Unter Selbstpflege fasst Orem sowohl das Bedürfnis nach Existenzerhaltung als auch darauf ausgerichtete Maßnahmen. Unter Abhängigenpflege versteht sie die erlernten, zielgerichteten Aktivitäten zur Regulierung von Faktoren die das Wohlbefinden von abhängigen Personen beeinträchtigen.
„Nach Orem beherrschen Menschen die Selbstpflege, die sie in der Auseinandersetzung mit ihrem sozialen Umfeld erlernt haben (Selbstpflegekompetenz). Sind sie auch in der Lage, diese Kompetenz umzusetzen, spricht man von Selbstpflegefähigkeit.“ (Menche 2001, S. 45) Befinden sich die Erfordernisse und die Fähigkeiten zur Selbstpflege im Gleichgewicht, so ist der Mensch im Sinne von Orem gesund. Professionelle Hilfe, also Abhängigenpflege, benötigt er erst, wenn dieses Gleichgewicht aufgehoben wird und ein Selbstpflegedefizit entsteht. Krankheiten führen also nicht automatisch zu einem Bedarf an professioneller Hilfe, sondern erst wenn der Betroffene selbst oder seine Bezugspersonen das Selbstpflegedefizit nicht kompensieren können. (Vgl. Orem 1995)
Ziel der Abhängigenpflege ist demnach, das Gleichgewicht zwischen Selbstpflegefähigkeiten und Selbstpflegeerfordernissen wieder herzustellen. Dies wird durch eine kompensatorische Pflege erreicht. Hier werden die Tätigkeiten, die der Betroffenen nicht selber tun kann, von einem anderen übernommen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Gleichgewicht als Ziel der Pflege (Quelle: Cavanagh 1995, S. 34)
Um jedoch das Gleichgewicht auch langfristig wieder herzustellen, muss die Selbstpflegefähigkeit des Betroffenen derart verändert werden, dass er zukünftig selber den entsprechenden Erfordernissen nach kommen kann. Dafür benötigt er Schulung und Beratung. Die Pflegefachkraft „... muß in der Lage sein, dem Patienten zu beschreiben und zu erklären, worin sein Selbstpflegebedarf besteht, welche Methoden und Handlungs- oder Behandlungsmöglichkeiten zur Befriedigung dieses Bedarfs bestehen, wie er seine Selbstpflege verwirklichen kann und welche Möglichkeiten es gibt, bestehende Einschränkungen seiner Selbstpflegekompetenz zu kompensieren.“ (Cavanagh 1995, S. 41) Klassische Beispiele sind die Blutzuckermessung und die selbständige Symptomkontrolle bei Unter- oder Überzuckerung. Die Patientenedukation stellt also eine wichtige Säule der professionellen Pflege dar.
2.2.2 Erhöhung der Partizipationsfähigkeit
Partizipation wird definiert als: „...die Teilhabe beziehungsweise der Grad der Teilhabe (die Mitwirkungsmöglichkeiten) von Einzelnen oder Gruppen an Entscheidungsprozessen und Handlungsabläufen...“ (Brockhaus AG 2002) Während mit der Selbstpflegefähigkeit eine Unabhängigkeit von fremder Hilfe anvisiert wird, so zielt die Partizipationsfähigkeit im Bereich der medizinisch-pflegerischen Betreuung auf die Befähigung zur aktiven Teilhabe an der Behandlung. Dies beinhaltet die Einbeziehung des Betroffenen sowohl bei der Erstellung des Therapieplanes als auch bei der Durchführung der Maßnahmen und der abschließenden Bewertung der Behandlung. Da es sich bei den Patienten in der Regel um Laien handelt, bedürfen sie entsprechender Schulung und Beratung durch Fachleute, um sich dementsprechend in die Behandlung einzubringen und mit zu gestalten. „Ziel ist es, das Wissen so zu vermitteln, dass es in die Lebenswelt des Adressaten einbezogen wird und die individuellen Kompetenzen der Problembewältigung gestärkt werden, so dass es zu einer aktiven und produktiven Form der Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Anforderungen kommt.“ (Reibnitz 2001, S. 41)
2.2.3 Kritische Auseinandersetzung
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass Patientenedukationen eine Vielzahl von Vorteilen bieten können. Rehabilitationswissenschaftler Hermann Faller fasst, die Ziele von Patientenschulungen folgendermaßen zusammen (Faller 2005):
- Akzeptanz der chronischen Erkrankung
- Verbesserung der Compliance
- eigenverantwortlicher Umgang mit der Erkrankung (Selbstmanagement)
- Befähigung, informierte Entscheidungen zu treffen (Empowerment)
- Mitwirkung bei medizinischen Entscheidungen (Shared Decision-making)
Es muss jedoch für jeden Einzelfall geklärt werden, ob der Patient, abhängig von seiner individuellen Situation, bereit ist für Beratungen und Schulungen. Nicht selten begeben sich Menschen in die Obhut von professionellen Händen , weil sie unter anderem „ ...die Entlastung von Verantwortungs- und Entscheidungsdruck suchen und ... sich nicht zu autonomer selbstgesteuerter Krankheitsbewältigung fähig sehen, ebenso wenig dazu, sich die zur Wahrnehmung der Rolle als „kritischer Kunde“ oder zur selbstbestimmten Entscheidungsfindung notwendigen Informationen zu beschaffen bzw. Expertise anzueignen - sei es, weil sie dazu aus krankheitsbedingten Gründen schlicht nicht in der Lage sind oder weil sie dazu notwendige soziale Voraussetzungen nicht erfüllen.“ (Reibnitz 2001, S. 59)
Dieser Aspekt der Patientenrealität(en) ändert zwar grundsätzlich nichts an den möglichen Vorteilen der Patientenedukation, sollte aber bei jeder Beratungs- und Schulungsmaßnahme mit bedacht werden.
2.3 Schulungs- und Beratungsmethoden
Voraussetzung für den Erwerb der oben angeführten Fähigkeiten ist, dass der Patient das notwendige Wissen und die entsprechenden Fertigkeiten erlernt. „In der Alltagssprache bezeichnet man als Lernen den Erwerb von Wissen sowie von motorischen und sprachlichen Fertigkeiten. ... Menschliches Lernen ist eine überwiegend einsichtige, aktive und sozialvermittelte Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten, Überzeugungen und Verhaltensweisen. ...“
(Brockhaus AG 2002)
Es können grob zwei Lernarten unterschieden werden. Zum einen das autodidaktische Lernen, bei dem unter Verzicht auf Anleitung, Lenkung und Kontrolle durch eine Lehrkraft oder -institution bestimmte Kenntnisse selbst angeeignet werden. In der Regel werden als Informationsquellen entsprechendes schriftliches Material wie Fachbücher, Magazine, Broschüren oder Internetseiten genutzt. Die andere Lernart entspricht dem klassischen Lernen wie wir es auch aus der Schule kennen. Hier existiert eine Fachkraft, die den Lernprozess einer Einzelperson oder einer Gruppe anstößt, lenkt und begleitet.
Die im Bereich der Patientenschulung und -beratung gängigen Verfahren beinhalten diese beiden Lernformen. In der ersten Variante wird dem Patienten schriftliches Informationsmaterial angeboten, welches er nach seinen eigenen Vorstellungen durcharbeiten kann. Im Krankenhaus wird diese Form oft kombiniert mit einer Einverständniserklärung z.B. vor invasiven Untersuchungen oder Eingriffen. Auch die zweite Variante ist in der Pflege und Medizin alltäglich. Hier handelt es sich um eine direkte Wissensvermittlung durch eine Fachperson. Typische Beispiele sind die Prämedikationsgespräche vor Operationen, Seminare für Patientengruppen oder auch die Anleitungen der Pflegefachkraft im Rahmen der aktivierenden Pflege.
Die Frage nach der besten Beratungsmethode lässt sich aus der Literatur nicht eindeutig herausarbeiten. „Gemessen an der großen Zahl von Artikeln über Patientenberatung enthalten verhältnismäßig wenige eine systematische Evaluation solcher Interventionen.“ (Falvo 1995, S. 229) Häufig genannt werden folgende vier Vermittlungsmethoden:
- Strukturierte Unterweisung (entspricht dem klassischen Schulunterricht)
- Bekräftigung (z.B. positive Verstärkung bei der aktivierenden Pflege)
- Selbständiges Lernen (autodidaktisch)
- Eine Kombination dieser Vorgehensweisen
Die Auswahl einer Methode sollte sicher abhängig gemacht werden von der spezifischen Beratungskonstellation. Dazu gehören persönliche Präferenzen des Beraters und des Patienten. Aber auch der Inhalt und das Ziel der Beratung, die räumliche Umgebung und der verfügbare Zeitrahmen spielen eine Rolle. Je nach Situation können oder müssen die verschiedenen Methoden auch kombiniert werden. Eine allgemeingültige Aussage zur Effektivität der einzelnen Methoden kann somit nur schwer getroffen werden.
2.4 Patientenschulung als Aufgabe der Pflegefachkräfte
Der Gedanke einer Beratung durch die Pflegefachkraft erscheint auf den ersten Blick neu. Das folgende Kapitel beschäftigt sich damit, welche Rolle die Gesundheits- und Krankenpflege im deutschen Gesundheitswesen bezüglich der Patientenberatung und -schulung einnimmt oder einnehmen sollte.
2.4.1 Pflegerische Praxis
Genau betrachtet gehört die Patientenberatung und -schulung zum Wesen der Krankenpflege. „Man kann einen Patienten nicht behandeln oder ihm Erleichterung verschaffen, ohne genau über seinen Kenntnisstand Bescheid zu wissen und ihn auf dieser Grundlage zu instruieren und anzuleiten.“ (London 2003, S. 31) Das heißt ohne Beratung keine Pflege oder anders formuliert: jede pflegerische Maßnahme beinhaltet auch Aspekte der Beratung und Schulung. Das Erklären von Sinn und Zweck einzelner pflegerischer Handlungen während der Grundpflege, die Anweisungen an den Patienten bei der Mobilisation oder die Erklärungen zur Medikamenteneinnahme verdeutlichen die Alltäglichkeit pflegerischer Beratung.
Durch die täglichen unmittelbaren Patienteninteraktionen unterhält das Pflegepersonal einen kontinuierlichen zwischenmenschlichen Kontakt zum Patienten. „Sie können dadurch das Spektrum angezeigter und bewältigter, ebenso wie noch nicht vollbrachter, oder auch für die Betroffenen nicht realisierbarer Umstellungs- und Anpassungsleistungen am ehesten abschätzen, da sie deren Lernvoraussetzungen und -fähigkeiten und die diesbezüglichen Bedingungen im sozialen Umfeld am ehesten kennen.“ (Müller-Mundt 2001, S. 93)
Sowohl in der präoperativen, als auch in der postoperativen Phase, ist die Pflege somit die primäre Kontaktadresse für den Patienten. „Pflegende können durch ihre Nähe zum Patienten und dem notwendigen Alltagsbezug viel eher der individuellen Situation entsprechend beraten“ (Nestler 2004, S.209)
Da dies auch für den Bereich der perioperativen Schmerztherapie gilt, bietet sich auch eine entsprechend geschulte Pflegefachkraft für die präoperativen schmerztherapeutischen Beratungsdienste an. „Bei der Therapie von Schmerzpatienten im Krankenhausalltag ist das Pflegepersonal die Schnittstelle des guten Gelingens. Durch den engen Kontakt zu den Patienten offenbaren diese ihre Sorgen und Probleme eher dem Pflegepersonal als einem Stationsarzt.“ (Koch-Epping / Neugebauer 2001, S. 111)
Durch die Beratung können bereits im Vorfeld Abläufe geklärt und Verhaltensweisen eingeübt werden. Der Patient kann Handlungssicherheit und Vertrauen in das ihn betreuende Team gewinnen.
2.4.2 Aspekte aus dem Krankenpflegegesetz
Bereits das Krankenpflegegesetz von 1985 sah im § 4 die Anregung und Anleitung zu gesundheitsfördernden Verhalten als Ausbildungsziel in der Krankenpflege vor. Die Neufassung des Gesetzes vom 16. Juli 2003 wird bezüglich des Beratungsauftrages der Fachpflege noch konkreter.
Die Einbeziehung des Begriffs „Gesundheitspflege“ in die Berufsbezeichnung weist auf eine Verlagerung des Aufgabenspektrums zu mehr Gesundheitsförderung und Prävention hin. Dadurch wird einem gesundheitspolitischen Trend Rechnung getragen, der mehr Eigenverantwortlichkeit und Selbstpflegeaktivitäten (vgl. Orem 1997) fordert. Zukünftig soll der Mensch selber zum Manager seines Gesundheitszustandes werden. Das heißt, er sorgt sich um den Erhalt seiner Gesundheit, fördert diese, beugt Störungen vor und beteiligt sich aktiv an der Behandlung eingetretener Erkrankungen.
Zum anderen fordert das neue Gesetz in § 3 Satz 2 für die Berufe in der Krankenpflege die Befähigung zur eigenverantwortlichen „...Beratung, Anleitung und Unterstützung von zu pflegenden Menschen und ihrer Bezugspersonen in der individuellen Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit,...“ (vgl. KrPflG, 2003). Damit wird der Krankenpflege eine aktive Rolle in der Patienten- und Angehörigenedukation zugesprochen.
2.4.3 Standpunkte nationaler und internationaler Verbände
Das europäische Regionalbüro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in ihrem Positionspapier zur Realisierung des Ziels „Gesundheit für Alle“ die gesellschaftliche Funktion der Pflege darin, Einzelne, Familien und soziale Gruppen dahingehend zu unterstützen, ihre Gesundheitspotentiale im Kontext ihres Lebens- und Arbeitsumfeldes zu erkennen und zu erreichen. Dabei wird als eine der vier Kernaufgaben der Pflege die Unterweisung (teaching) der Klienten und des Personals im Gesundheitssektor herausgestellt.
(vgl. Salvage 1993, S. 15ff)
Auch internationale Richtlinien pflegerischer Organisationen zählen die Patientenberatung zu dem Berufsbild der Pflegenden. So z.B. im „Nursing Care Act“ oder in den Standards der „Joint Commission on Accreditation of Healt Care Organisations“ (vgl. London 2003, S. 26).
In der US-amerikanischen Pflege gilt die Patientenberatung, bereits seit den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts, als etablierter Kernbestandteil des Tätigkeitsprofils. So verlautbarte die National League of Nursing Education bereits im Jahre 1937 den Satz:“ Nursing is teaching“.
(vgl. National League of Nursing Education 1937)
2.4.4 Auffassungen in der Pflegewissenschaft
Im Dezember 2003 verabschiedete das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) den Expertenstandard „Schmerzmanagement in der Pflege“. Dieser Standard basiert auf einer intensiven nationalen und internationalen Literaturrecherche, wurde von einer Expertenarbeitsgruppe erstellt und in einer Konsensuskonferenz im Austausch mit Praktikern aus der Fachöffentlichkeit überarbeitet. Im März 2005 wurden dann erste Ergebnisse aus der praktischen Umsetzung des Standards präsentiert. Durch dieses Verfahren soll die notwendige Evidenz der Inhalte und deren praktische Umsetzbarkeit sichergestellt werden.
Eines der fünf Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien des Standards widmet sich speziell der Patientenedukation im Rahmen der Schmerztherapie.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Kriterien des Expertenstandard Schmerzmanagement
Das heißt, dass der Patient befähigt werden soll, adäquate Selbsteinschätzungen geben zu können und aktiv an seiner Schmerzbehandlung teilzunehmen. Dies soll die Pflegefachkraft gewährleisten und benötigt somit selber das entsprechende Fachwissen und die Kompetenzen zur Wissensvermittlung.
Die Inhalte der Schulungen werden im Standard konkretisiert und beziehen sich unter anderem auf Vorbehalte gegen Schmerzmittel. Dabei sollen die Einstellungen zu Analgetika positiv beeinflusst werden.
Aber auch das Einschätzen und Darstellen der eigenen Schmerzen muss eingeübt werden. Dies bezieht sich auf den subjektiven Charakter, das zeitliche Auftreten, die Lokalisation, die Intensität und die individuellen Folgen der Schmerzen.
Der Expertenstandard Schmerzmanagement in der Pflege gehört zu den jüngsten pflegewissenschaftlichen Werken. Aufgrund seiner wissenschaftlichen Fundierung und der bundesweiten Gültigkeit ist er richtungweisend für die zukünftige Entwicklung der professionellen Pflege in Deutschland.
3 Schmerz
Wie bereits im Kapitel 1 dargestellt, nimmt der Schmerz eine zentrale Rolle in der perioperativen Betreuung eines Kranken ein. Um ihn zu erfassen und eine entsprechende Therapie durchzuführen ist es zunächst notwendig, sich der Vielschichtigkeit seiner Ursachen und Ausformungen bewusst zu werden.
3.1 Definition
Biologisch betrachtet sind Schmerzen ein Alarmsignal des Körpers und signalisieren eine Störung der normalen Körperfunktionen. Entsprechende Schutzreaktionen werden durch sie ausgelöst. Es reicht jedoch nicht aus, den Schmerz lediglich als einen einfachen elektrischen Sinnesreiz zu betrachten. Bei einer starken Störung bzw. Schädigung folgt daraus nicht automatisch auch ein entsprechend starkes Schmerzerlebnis. Schmerz muss als ein individuelles Geschehen gesehen werden, das je nach Situation, unterschiedliche Ausprägungen und Folgen haben kann. „Schmerz kommt nicht in Isolation vor, sondern in einer spezifischen Person, deren psychosozialer, ökonomischer und kultureller Hintergrund die Schmerzerfahrung und die verbale sowie nonverbale Schmerzäußerung mitbestimmen“ (Osterbrink 2004, S. 201)
Die Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (IASP) definiert den Begriff deshalb folgendermaßen: „Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potentieller Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen eine solchen Schädigung beschrieben wird. Schmerz ist immer subjektiv.“ (Merskey / Bogduk 1994, S. 210, deutsche Übersetzung der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes)
Die Schmerzempfindung hängt von verschiedenen Faktoren ab und muss deshalb immer im Kontext der individuellen Bedingungen betrachtet werden.
3.2 Schmerzarten und -formen
Es können grob sieben verschiedene Schmerzformen unterschieden werden. Sie unterscheiden sich durch ihre Ursache bzw. Herkunft und ihrer Schmerzqualität.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Schmerzformen (vgl.: Kress 2004, Kap. 1.2.1, S. 2-3)
Grundsätzlich kann akuter, lang anhaltender und chronifizierter Schmerz unterschieden werden.
- „Akuter Schmerz ist in der Regel kurz andauernd und üblicherweise somatisch-nozizeptiv ausgelöst (durch Verletzungen, Entzündungen, körperliche Fehlfunktionen etc.).“ (Kress 2004, Kap. 1.1.1, S. 6)
- Bei lang anhaltenden Schmerzen unterscheidet McCaffery drei Typen:
a) „Wiederkehrende akute Schmerzen mit einem Potential, während des gesamten Lebens oder für eine längere Zeit wieder aufzutreten...“
b) Andauernde zeitlich begrenzte oder chronisch-akute Schmerzen: diese Schmerzen können Monate andauern, vielleicht sogar Jahre, hören aber mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ganz auf...“ (z.B. Verbrennungen)
c) Chronisch nicht-maligne Schmerzen, manchmal als chronische, „gutartige“ Schmerzen bezeichnet... Diese Art Schmerzen tritt fast täglich auf und dauert 3 Monate oder länger an...“
(McCaffery u.a. 1997, S. 34-35)
- „Chronifizierter Schmerz ist grundsätzlich etwas anderes als ein lang anhaltender Schmerz. Nach einer Zeitspanne von mehr als 6 Monaten (nach anderer Definition: mehr als 3 Monaten) finden auf unterschiedlichen (somatischen und psychosozialen) Ebenen Chronifizierungsvorgänge statt, die eine sekundäre Kausalkette für die weitere Aufrechterhaltung des Schmerzes darstellen. ... Durch die schrittweise Verselbständigung des Schmerzgeschehens von seiner ursprünglich auslösenden Ursache verliert der chronische Schmerz seine biologische Warnfunktion; er ist nicht mehr Hinweis auf eine (zugrundeliegende) Verletzung oder Erkrankung, sondern ist selbst zu einer selbständigen Erkrankung geworden ...“ (Kress 2004, Kap. 1.1.1, S. 7)
3.3 Das Schmerzerlebnis
„Schmerz ist ein komplexes Phänomen, das zum Erfahrungsschatz nahezu jedes Menschen zählt. Jeder Schmerz hinterlässt eine Erlebnisspur, die spätere Schmerzerfahrungen beeinflusst. Wie bei anderen Erfahrungen auch, versucht der Mensch seinen Schmerz in einen Sinnzusammenhang mit seinem Denken und Fühlen zu stellen, eingebettet in den individuellen soziokulturellen Bedeutungszusammenhang und das jeweils vorherrschende Schmerzverständnis.“ (Kress 2004, Kap. 1.1.1, S. 1)
3.3.1 Schmerzbeeinflussende Faktoren
Die Art und Weise der Schmerzwahrnehmung und deren Verarbeitung ist von Mensch zu Mensch und Situation zu Situation unterschiedlich. Sie hängt von den unterschiedlichsten Faktoren ab, die bei der Erstellung eines pflegerischen und medizinischen Interventionsplanes bedacht werden müssen. Beeinflussende Faktoren können sein:
- Ausmaß der Gewebeschädigung
- Körperliche Konstitution
- Psychische Konstitution
- Vorerfahrungen
- Kulturelle Eigenheiten
- Erziehung / Sozialisation
- Individuelle Bewältigungsstrategien / Kontrollüberzeugungen
Insbesondere die Kontrollüberzeugungen, also die Gewissheit, den Schmerz beeinflussen zu können und ihn nicht als ein unabänderliches Leid zu sehen, haben eine große Auswirkung auf die Schmerzwahrnehmung. „Danach ist die Einschätzung der eigenen Kompetenz eine zentrale Variable in der Schmerzregulation, da von ihrer Ausprägung ... das Ausmaß der Schmerzen und der belastenden Emotionen sowie die Art und das Ausmaß der Verhaltensweisen abhängen“ (Geissner u.a. 1992, S. 144).
3.3.2 Schmerzwahrnehmung
Schmerzen resultieren in der Regel aus einer Kombination körperlicher (z.B. Schnittverletzung) und mentaler Reize (z.B. Gefühle, Gedanken) also aus der Reaktion des ganzen Körpers. Aus diesem Grunde sind Schmerzwahrnehmungen nicht vergleichbar. „Vergleichbare Stimuli führen bei verschiedenen Menschen zu einer unterschiedlichen Schmerzintensität und -dauer. Es gibt keine direkte und unveränderliche Beziehung zwischen Reizen und Schmerzwahrnehmung.“ (McCaffery u.a. 1997, S. 26) Bei gleichem Reiz können manchmal beträchtliche Variationen von Schmerzintensität und -dauer auftreten. Erklärt werden kann dies anhand der Gate-Control-Theorie (vgl. Melzack u.a. 1965). Dieser Theorie folgend wird jeder Schmerzreiz, bevor er in das Bewusstsein gelangt, mehrmals gefiltert und vom körpereigenen Feed-Back-System verändert. Man spricht hier auch von einem Tormechanismus, der bei jedem Menschen und abhängig von der Situation unterschiedlich geartet ist und somit die verschiedenen Schmerzwahrnehmungen erklären kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Gate-Control-Theorie (Quelle: Kress 2004, Kap. 1.1.1, S. 4)
3.4 Diagnostik
Wie in den vorherigen Kapitel beschrieben können sich Schmerzen in den unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen zeigen. Deshalb ist eine sorgfältige Schmerzdiagnostik notwendig. Diese kann bei der Suche nach der Schmerzursache helfen und ermöglicht das Erstellen einer individuell angepasste Therapie.
3.4.1 Anamnese
Die allgemeine physische, psychische und soziale Anamnese ist auch bei der Diagnostik von Schmerzzuständen von grundlegender Bedeutung. Hier können die verschiedenen Faktoren ermittelt werden, die einen Einfluss auf die Schmerzentstehung, -entwicklung, -ausprägung und -verarbeitung haben.
Wichtig dabei ist, nicht nur die individuelle Krankengeschichte zu erheben, sondern auch die psychische und soziale Situation des Patienten zu erfassen. So ergibt sich ein Gesamtbild, welches dem Therapeuten helfen kann, die individuelle Schmerzwahrnehmung des Betroffenen in einen lebensgeschichtlichen Kontext zu stellen. Der individuelle Schmerz kann so leichter nachvollzogen werden und ein individuelles Einlassen auf die konkrete Problematik des Patienten wird möglich.
3.4.2 Schmerzbeschreibung
Da nur der Betroffene eine verlässliche Aussage zu seinen Schmerzen machen kann, stellt die Schmerzbeschreibung ein wichtiges Glied in der diagnostischen Kette dar. Sie ermöglicht eine Einschätzung und Klassifizierung der Schmerzsituation des Patienten. Oft sind so Rückschlüsse auf die Ursache der Schmerzen möglich und die Auswahl der sowohl ursächlichen als auch der symptomatischen Therapie wird erleichtert. Da Schmerzen selten statisch sind, reicht eine einmalige Einschätzung nicht aus. Vielmehr muss die Erhebung regelmäßig wiederholt werden.
Um den Betroffenen die Beschreibung seiner Schmerzen zu erleichtern, gibt es verschiedene Hilfsmittel und Techniken. Dazu gehören Schmerzskalen zur Messung der Schmerzintensität, verschiedene Fragebögen mit unterschiedlichem Umfang, Tagebücher und Schmerzprotokolle. Im wesentlichen werden mit diesen Hilfsmitteln folgende Informationen abgefragt bzw. erfasst:
- Schmerzlokalisation: Schematische Darstellungen eines Menschen bieten die Möglichkeit, schmerzenden Areale einzuzeichnen. Im direkten Gespräch mit dem Patienten sollte dieser direkt auf das entsprechende Areal zeigen.
- Schmerzintensität: Anhand von Schmerskalen kann der Patient die Intensität der von ihm empfundenen Schmerzen angeben (s. Kap. 3.4.3).
- Schmerzqualität: Hier ist man auf die Beschreibungen des Patienten angewiesen. Hilfreich können die 15 Adjektive aus der Kurzform des McGill-Schmerz-Fragebogen sein (vgl. Melzack 1987, S. 191 bis 197)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3: 15 Adjektive zur Schmerzbeschreibung
- Beginn, Dauer, Verlaufsform, Rhythmus: Dies Informationen dienen u.a. dazu, die Therapie auch zeitlich auf die individuelle Schmerzsituation einzustellen.
- Was lindert die Schmerzen ? : Aus dieser Frage ergeben sich vorhandene Selbstpflegepotentiale, die genutzt werden können.
- Was verstärkt die Schmerzen ? : Durch eine systematische Auflistung werden diese negativen Aspekte bewusst gemacht und können bereits in der Pflegeplanung vermieden werden.
- Auswirkungen der Schmerzen: Sinn ist es, zu erfahren, in wieweit der Alltag des Patienten durch die Schmerzen eingeschränkt wird (z.B. Treppen steigen). Daraus können Selbstpflegekompetenzen und -erfordernisse abgeleitet werden.
3.4.3 Schmerzmessung
Die Subjektivität und Emotionalität des Phänomens Schmerz machen eine quantitative Erfassung der Schmerzintensität sehr schwierig. Die Selbsteinschätzung des Patienten ist, im klinischen Alltag, das einzig akzeptable Mittel. Es ist üblich, die Einschätzung des Patienten zur Schmerzintensität mittels einer Skala zu operationalisieren. Dazu schätzt der Patient auf einer numerischen Rating Skala (NRS) von z.B. 0 bis 100 die Intensität seiner Schmerzen ein. Dabei steht 0 für keine und 100 für stärkst vorstellbare Schmerzen.
Es gibt von verschiedenen Herstellern unterschiedlichst gestaltete Skalen. Denkbar sind auch Texthinweise wie: keine, schwache, starke und sehr starke Schmerzen bei der verbalen Rating Skala (VRS) oder grafische Hilfen in Form symbolischer Gesichter von lächelnd, fröhlich bis traurig, weinend bei der visuellen analog Skala (VAS). Diese Texte und grafische Elemente sollen dem Patienten die Selbsteinschätzung erleichtern.
Generell kann gesagt werden, dass alle drei Skalen (VRS, NRS, VAS) ausreichend valide und reliabel sind , um für die klinische Schmerzmessung eingesetzt zu werden. In Anhang 1 ist exemplarisch die Skala des KKH Grevenbroich dargestellt, die eine Kombination dieser drei Arten darstellt.
“Bei der Verwendung einer Schmerzskala ist es wichtig, den Befragten darauf hinzuweisen, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, sondern es sich bei den Angabe um individuelle und rein subjektive Einschätzungen handelt. Ziel ist es, für eine subjektiven Erfahrung, eine objektive Beschreibung zu erhalten, die es ermöglicht die Effektivität der erfolgten schmerzlindernden Maßnahmen zu evaluieren.“ (DNQP 2005, S. 40)
Durch die Messung der Schmerzintensität sowohl in Ruhe als auch in Bewegung, bzw. unter Belastung, können die gemessenen Werte leichter interpretiert werden und ermöglichen den Vergleich mit vorherigen Messungen.
Um den subjektiven Charakter der Schmerzempfindung gerecht zu werden, sollte ebenfalls die Schmerzakzeptanz erfragt werden. Das heißt es sollte ermittelt werden, ob der Betroffene mit den von ihm wahrgenommenen Schmerzen zurecht kommt oder ob die Schmerzen ihn derart beeinträchtigen, dass Maßnahmen zur Schmerzreduktion notwendig sind.
Anhang 2 zeigt eine Kurve aus dem Kreiskrankenhaus Grevenbroich, in der sowohl die Schmerzen in Ruhe und Bewegung als auch die Schmerzakzeptanz dokumentiert sind.
4. Schmerztherapie
Eine ausreichende Schmerztherapie sollte eine ethisch-moralische Verpflichtung für das Behandlungsteam darstellen. K. Kutzer, ein Richter am Bundesgerichtshof, führte in einem Aufsatz der Zeitschrift „Der Schmerz“ sogar aus, dass alle Patienten das Recht auf eine effektive und individuelle Schmerztherapie haben. (vgl. Kutzer 1991) Mittlerweile gibt es auch eine von Juristen festgelegte Pflicht, nach der jeder Patient ein Recht auf eine angemessene analgetische Behandlung hat. So stellt Ulsenheimer fest, dass die Verletzung der ärztlichen Pflicht zur postoperativen Schmerzbekämpfung einen Behandlungsfehler darstellt und strafrechtliche Sanktionen wegen Körperverletzung durch Unterlassung auslöst. (vgl. Ulsenheimer 1997)
4.1 Bedeutung in der perioperativen Phase
Wie bereits im Kapitel 1 angedeutet, spielt die Schmerztherapie während der perioperativen Phase eine zentrale Rolle.
Häufig ist die vom Patienten geschilderte Schmerzsituation eines der Leitsymptome, welche zur stationären Aufnahme und zur Operationsentscheidung führt. Viele dieser Schmerzen werden durch den operativen Eingriff beseitig oder zumindest gelindert. Jedoch entstehen postoperativ regelmäßig zusätzliche Schmerzen, die ursächlich auf die Gewebeschädigung während des Eingriffs zurückzuführen sind. „Perioperativer Schmerz beschreibt Schmerzen, die sowohl prä- als auch postoperativ auftreten und entweder durch einen operativen Eingriff entstehen oder als Folge einer Grunderkrankung schon vorhanden sind.“ (Kress 2004, Kap. 3.1.4, S. 1) Eine optimale prä- und postoperative Behandlung wird jedoch durch Schmerzen behindert.
Vor der Operation muss der Patient die Möglichkeit erhalten, sich mit seiner neuen Situation auseinander zu setzen, wohlüberlegte Entscheidungen treffen zu können (z.B. die Einwilligung zur Operation) und entsprechende vorbereitende Maßnahmen aktiv mit zugestalten. Unbestritten ist, dass dies Patienten, während sie unter Schmerzen leiden, nur schwer bzw. eingeschränkt möglich ist. Eine größtmögliche Schmerzreduktion sollte demnach eines der Ziele der präoperativen Behandlung sein.
Nach der Operation sollte der Patient möglichst schnell wieder in die Lage versetzt werden, den alltäglichen Aktivitäten des Lebens selbständig oder zumindest mit geringer Hilfe nachgehen zu können. Zu nennen sind hier z.B. Tätigkeiten wie sich bewegen ggf. mit Gehilfe, sich pflegen und kleiden, sich Ernähren oder sich Ausruhen und Schlafen. Schmerzen können diese Aktivitäten erschweren oder sogar verhindern. Als Folge kann die Gefahr von Komplikationen wachsen und die vollständige Rehabilitation des Patienten bedrohen. Am Beispiel der Mobilität lässt sich dies verdeutlichen. Es liegt nahe, bei einem durch postoperative Schmerzen in der Mobilität eingeschränkten Patienten, ein erhöhtes Risiko für Thrombosen, einen Dekubitus, eine Pneumonie und gegebenenfalls sogar für Kontrakturen anzunehmen. Des weiteren kann die Wiederaufnahme einer normalen Kreislauf- und Stoffwechselfunktion behindert werden. Krankengymnastische Übungen können eventuell nicht durchgeführt werden. Ebenso kann die Motivation und Moral des Patienten unter dem Eindruck der Hilfsbedürftigkeit leiden. „Insgesamt wird schon aus dieser zusammenfassenden Auflistung deutlich, dass postoperative Schmerztherapie nicht nur eine humanitäre Verpflichtung darstellt, sondern auch postoperative Morbidität und Mortalität verbessern und zu einer Verkürzung der postoperativen Liegedauer führen kann.“ (Kress 2004, Kap. 3.1.4, S. 2)
Es muss jedoch angemerkt werden, dass eine sachgerechte Schmerztherapie kein Garant für eine erfolgreiche postoperative Rehabilitation ist - andererseits stellen unbehandelte Schmerzen ein nicht zu akzeptierendes Risiko für den Patienten dar.
4.2 Medikamentöse Methoden
Die Behandlung mittels Analgetika stellt, neben der Ursachenbeseitigung, die bedeutendste Säule der modernen Schmerztherapie dar. Grundsätzlich orientiert sich die moderne pharmakologische Schmerztherapie an dem Stufenschema der WHO. Dieses wurde zwar ursprünglich zur Behandlung von Tumorschmerzen konzipiert, ist aber inzwischen, in umgekehrter Form, auch in der Akutschmerztherapie allgemein etabliert.
4.2.1 Therapie chronischer Schmerzen
Chronische Schmerzen erfordern meistens eine längerfristige Analgetikatherapie. Dabei sind bestimmte Regeln zu beachten. So sind orale oder transdermale Applikationsformen zu bevorzugen die nach festen Zeitabständen eingenommen werden. Hier empfiehlt sich ein Vorgehen nach dem Stufenplan der WHO. Dieser koordiniert unterschiedliche schmerzreduzierende Verfahren und sieht drei Stufen vor (siehe Abb. 3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: WHO-Stufenschema
Die Basis des Schemas bilden die Nichtopioide (z.B. Acetylsalicilsäure). Erst wenn durch Ausreizen dieser Medikamentengruppe keine ausreichende Schmerzreduktion erreicht wird, werden diese mit schwachen Opioiden (z.B. Tramadol) kombiniert. Kommt es auch bei dieser Kombination nicht zu einer akzeptablen Schmerzlinderung, werden dann Nichtopioide und starke Opioide (z.B. Morphin) kombiniert. Zusätzlich wird in allen drei Stufen die Gabe von Co-Analgetika empfohlen. Diese Medikamente sind ursprünglich nicht für die Schmerztherapie vorgesehen, können jedoch die Wirkung der Analgetika unterstützen bzw. verstärken. Des weiteren sollen Begleitmedikamente eingesetzt werden, um möglichen Nebenwirkungen der Analgetika vorzubeugen und zu behandeln. Insbesondere sind hier die opioidinduzierte Übelkeit und Verstopfung zu nennen.
4.2.2 Therapie akuter Schmerzen
„Bei akut aufgetretenen Schmerzen sind in aller Regel Analgetika nur kurzfristig notwendig. Es kommt vor allem darauf an, schnell eine ausreichende Schmerzlinderung zu erzielen, was in vielen Fällen nur mit der intravenösen Analgetikaapplikationen möglich ist.“ (Zenz 1993, S. 269) Schmerzlindernde Medikamente werden nicht regelmäßig sondern nach Bedarf verabreicht. Dabei kommt es auf einen schnellen Wirkungseintritt an und weniger auf eine lange Wirkungsdauer. Die Einteilung und Kombination der Analgetika orientiert sich ebenso am WHO-Schema. Jedoch beginnt die Therapie nicht mit der Stufe I. Postoperativ bietet sich initial die Verabreichung von intravenösen Opiaten an, um auftretende zum Teil heftige Wundschmerzen zu therapieren. Aber auch hier können Nichtopioide in Kombination oder als Monotherapie im postoperativen Verlauf sinnvoll sein.
4.3 Nicht medikamentöse Methoden
Die medikamentöse Therapie von perioperativen Schmerzen bildet die Grundsäule eines modernen Schmerztherapiekonzeptes. Es gibt aber noch einige nichtmedikamentöse Methoden zur Schmerzreduktion die, je nach Art des Schmerzsituation, unterstützend eingesetzt werden können. In Tabelle 4 sind die wichtigsten nichtmedikamentösen Methoden aufgelistet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 4: Nichtmedikamentöse Methoden (vgl. Zens 1993, S. 197ff)
Wichtig ist, dass alle diese Verfahren, insbesondere in der perioperativen Schmerztherapie, lediglich zusätzlich zur medikamentösen Therapie einzusetzen sind. Welches Verfahren im Einzelfall sinnvoll ist, hängt von der Indikation und der spezifischen Situation des Patienten ab.
4.4 Kreislauf der Schmerztherapie
Vergleichbar mit dem Pflegeprozess sollte auch die Schmerztherapie als ein dynamischer Prozess angelegt sein, der sich ständig an die aktuelle Situation und deren Erfordernisse anpasst.
4.4.1 Diagnose
Am Anfang steht das Sammeln von Daten und Fakten. Diese können aus unterschiedlichen Quellen stammen. Dazu gehören Feststellungen aus pflegerischen und ärztlichen Aufnahmegesprächen (Anamnesen), Krankenakten früherer Aufenthalte, Angaben von Angehörigen und eigenen Beobachtungen. Weitere Erkenntnisse können aus eingeleiteten diagnostischen Maßnahmen, wie Blut-, Ultraschall-, Röntgenuntersuchungen usw. gewonnen werden. Schmerzspezifische Gegebenheiten werden mittels Schmerzanamnese, Schmerztagebücher und Schmerzmessungen erfasst.
Aus dieser Informationssammlung kann dann eine individuelle Schmerzdiagnose abgeleitet werden. Sie umfasst sowohl die Ursache als auch die Art und Ausprägung des Schmerzes und dessen Folgen für den Patienten.
4.4.2 Therapie
Anhand der Diagnose in Kombination mit der Bedürfnislage des Patienten und den gemeinsam gesetzten Zielen kann dann ein individueller Therapieplan entwickelt und durchgeführt werden. Wichtig hierbei ist, dass sowohl der Patient als auch die an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen bei der Konzeptentwicklung hinzugezogen werden. Insbesondere der Betroffene selber sollte die Maßnahmen verstehen und damit einverstanden sein.
4.4.3 Symptomkontrolle
Während der Therapie sollte ständig die Wirksamkeit der Maßnahmen kontrolliert werden. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen erlaubt die Krankenbeobachtung durch das Fachpersonal indirekte Rückschlüsse auf die Entwicklung der Schmerzen und dem Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen. Zu beobachten sind beispielsweise Veränderungen in der Mobilität, Auftreten von Obstipation oder Übelkeit, Stimmungsveränderungen usw. Direkte Rückschlüsse können jedoch aus den Angaben des Patienten selbst gewonnen werden. Hilfsmittel wie Befragungen, Schmerztagebücher, regelmäßige Schmerzmessungen und Schmerzfragebögen sollen dem Patienten bei den Beschreibungen helfen.
4.4.4 Anpassung von Diagnose und Therapie
Aufgrund der Daten aus den kontinuierlichen Erfolgskontrollen kann so die Diagnose und das Therapiekonzept überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst werden. So entsteht ein Kreislauf, der dafür sorgt, dass die Therapie ständig an die individuellen Bedürfnisse und Erfordernisse angepasst werden kann (siehe Abb. 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Kreislauf des Schmerzprozesses
5 Mögliche Effekte präoperativer Informationen
Vor einem chirurgischen Eingriff werden die Betroffenen mit einer Vielzahl an Informationen konfrontiert. Allein damit der Patient seine Einwilligung zum Eingriff geben kann, muss er rechtzeitig über das Verfahren und mögliche Komplikationen aufgeklärt werden. Erst mit diesem Wissen kann er eine entsprechende Einwilligung zur Operation geben, die dann den zunächst als Körperverletzung zu wertenden Eingriff legitimiert.
Es stellt sich die Frage, ob eine detaillierte Informationsvermittlung nicht auch kontraproduktive Effekte für die Behandlung auslöst. Als Beispiel kann der Medikamenten-Beipackzettel herangeführt werden. Diese Beipackzettel sind sehr umfangreich gestaltet und führen aus juristischen Gründen auch die extrem selten vorkommenden Nebenwirkungen und Komplikationen auf. Da ist es nachvollziehbar, dass bei den Patienten Bedenken vor der Einnahme des Medikaments aufkommen.
Andererseits kann es von Vorteil sein, wenn ein Patient gut informiert ist. Beispielsweise wenn es darum geht, die individuellen Wirkungen und Nebenwirkungen eines Medikaments zu beurteilen um die Therapie optimal auf die Bedürfnisse des einzelnen Patienten abzustimmen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Diplom Pflegewirt (FH) Frank Schneider (Autor:in), 2005, Pflegerische Patientenschulung im Rahmen der perioperativen Schmerztherapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78873
-
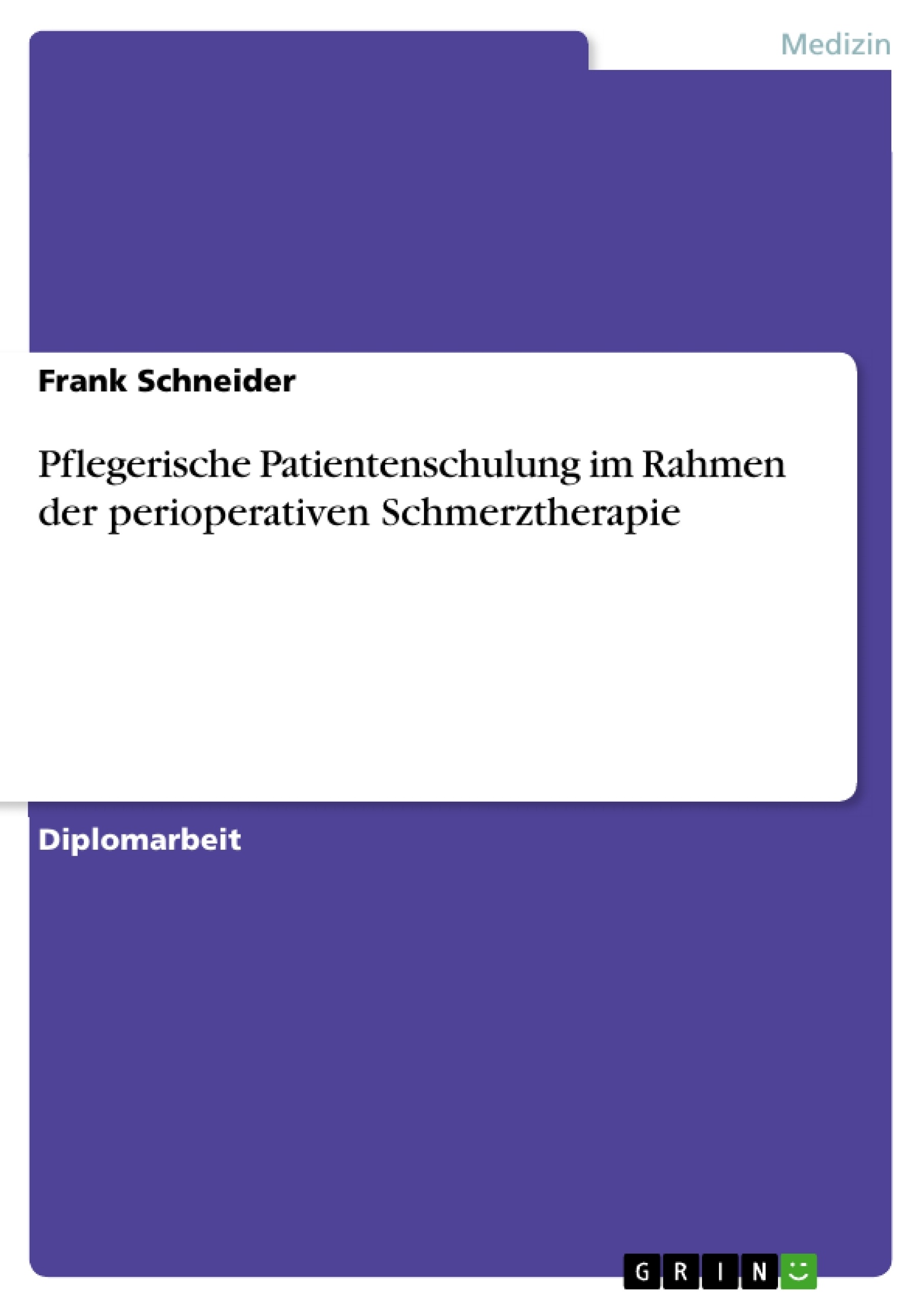
-
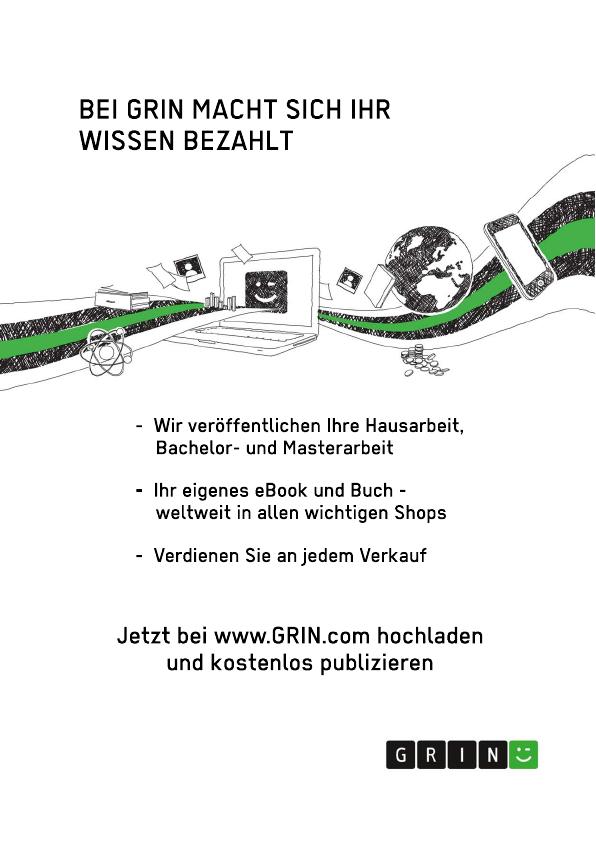
-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.