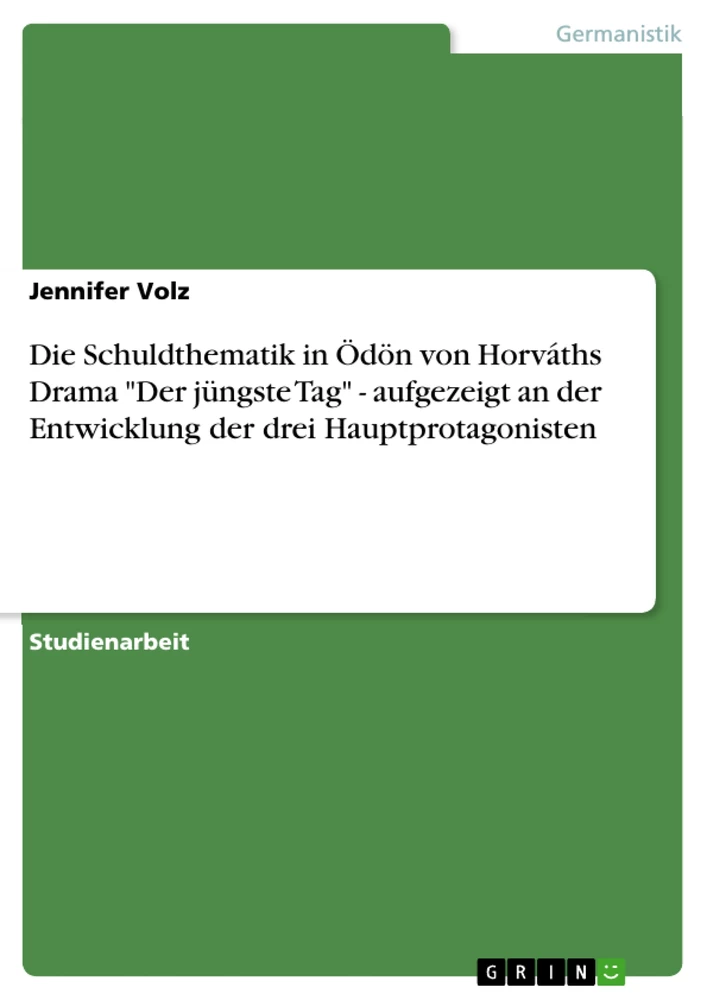Man liest viele Dramen im Laufe seiner Schulzeit und seinem Studium. Sophokles, Goethe und Brecht gehören dabei zu den meistgelesenen Dramatikern. Vor dem Hauptseminar „Ödön von Horváth: Dramen“ hatte ich nie etwas von diesem Autor gehört noch gelesen. Umso mehr begeistert lernte ich im Laufe des Semesters eine Auswahl seiner Werke kennen. Dabei sprach mich das Drama „Der jüngste Tag“ besonders an. Die Auseinandersetzung mit der Schuldigkeit einzelner Figuren war aufschlussreich für die allgemeine Schwierigkeit der Menschen, sich eigenem Verschulden bewusst zu werden. Horváth zeichnet klar und ansprechend den langwierigen Prozess der Sündenerkenntnis nach, der erst mit innerer Sühne beendet werden kann. Dabei gelangen die Hauptprotagonisten auf ganz unterschiedlichen Wegen zu der Erkenntnis ihrer Schuld.
Im Folgenden soll nun das Leben und Werk von Horváth nachgezeichnet und das
Drama „Der jüngste Tag“ strukturell untersucht werden. Das Schuldmotiv wird im
Zusammenhang der Thematik des Weltgerichts und der Entwicklung der drei
Hauptprotagonisten Thomas Hudetz, Anna Lechner und Josefine Hudetz zentral in
dieser Arbeit analysiert.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Ödön von Horváth
Leben und Werk
Das Drama „Der jüngste Tag“
Strukturanalyse
Die Schuldthematik
Ein Drama des Weltgerichts
Die Entwicklung der drei Hauptprotagonisten
Thomas Hudetz
Anna Lechner
Josefine Hudetz
Fazit
Literatur
Einleitung
Man liest viele Dramen im Laufe seiner Schulzeit und seinem Studium. Sophokles, Goethe und Brecht gehören dabei zu den meistgelesenen Dramatikern. Vor dem Hauptseminar „Ödön von Horváth: Dramen“ hatte ich nie etwas von diesem Autor gehört noch gelesen. Umso mehr begeistert lernte ich im Laufe des Semesters eine Auswahl seiner Werke kennen. Dabei sprach mich das Drama „Der jüngste Tag“[1] besonders an. Die Auseinandersetzung mit der Schuldigkeit einzelner Figuren war aufschlussreich für die allgemeine Schwierigkeit der Menschen, sich eigenem Verschulden bewusst zu werden. Horváth zeichnet klar und ansprechend den langwierigen Prozess der Sündenerkenntnis nach, der erst mit innerer Sühne beendet werden kann. Dabei gelangen die Hauptprotagonisten auf ganz unterschiedlichen Wegen zu der Erkenntnis ihrer Schuld.
Im Folgenden soll nun das Leben und Werk von Horváth nachgezeichnet und das Drama „Der jüngste Tag“ strukturell untersucht werden. Das Schuldmotiv wird im Zusammenhang der Thematik des Weltgerichts und der Entwicklung der drei Hauptprotagonisten Thomas Hudetz, Anna Lechner und Josefine Hudetz zentral in dieser Arbeit analysiert.
Ödön von Horváth
Leben und Werk
Ödön von Horváth wird am 9. Dezember 1901 als Sohn eines dem ungarischen Kleinadel angehörenden Diplomaten in Fiume, genauer in dem Vorort Susak geboren. Seine Kindheit und Jugend ist von zahlreichen Umzügen über Landesgrenzen hinaus geprägt. Die Familie zieht nach einem Jahr nach Belgrad und nach weiteren sechs Jahren nach Budapest, wo Ödön in der ungarischen Sprache unterrichtet wird. Nach der Versetzung seines Vaters nach München besucht Ödön ab 1909 ein erzbischöfliches Internat, in dem er streng religiös erzogen wird. Ab 1913 besucht er das Wilhelmgymnasium in München und wechselt bereits ein Jahr später in das dortige Realgymnasium. 1916 bis 1918 besucht er die Oberrealschule in Preußburg und verfasst in dieser Zeit erste Gedichte. Nach einem weiteren Jahr in Budapest, siedelt die Familie Horváth erst nach Wien und darauf nach Bayern über (1919). Ödön besteht im selben Jahr in Wien sein Abitur und immatrikuliert sich im Oktober an der Ludwig-Maximillians-Universität in München, wo er bis 1922 hauptsächlich Germanistik und Theaterwissenschaft studiert. In dieser Zeit verfasst Horváth das 1922 veröffentlichte „Das Buch der Tänze“. 1923 arbeitet Horváth intensiv an verschiedenen Werken, beispielsweise am Schauspiel „Mord in der Mohrengasse“. Er schreibt auch die „Sportmärchen“, die ab 1924 in verschiedenen Zeitschriften abgedruckt werden. 1924 zieht er mit seinen Eltern nach Murnau. Im Jahr 1926 verfasst Ödön die Komödie „Zur schönen Aussicht“ das Volksstück „Revolte auf Côte 3018“, das er nach der kritisierten Uraufführung 1927 überarbeitet und in den Titel „Die Bergbahn“ umbenennt. „Sladek oder Die schwarze Reichsarmee“ und deren umbenannte Überarbeitung „Sladek, der schwarze Reichswehrmann“ entstehen 1928, bei denen sich Horváth von Material über die Femenmorde der Schwarzen Reichswehr inspirieren lässt. Nach der erfolgreichen Uraufführung von „Die Bergbahn“ im Januar 1929 in Berlin, bekommt Horváth einen Vertrag beim Ullstein-Verlag. 1930 entsteht der Roman „Der ewige Spießer“, sowie die Volksstücke „Italienische Nacht“ und „Geschichten aus dem Wiener Wald“. Das darauf folgende Jahr bringt Horváth den endgültigen Durchbruch als Autor. Neben der erfolgreichen Aufführungen von „Italienische Nacht“ (Berlin, Wien) und „Geschichten aus dem Wiener Wald“ (Berlin) wird er von Carl Zuckmayer für den Kleist-Preis vorgeschlagen und am 24. Oktober 1931 ausgezeichnet. Das Volksstück „Kasimir und Karoline“ kann er ebenfalls in diesem Jahr abschließen. Dieses Werk wird 1932 unter gemischter Kritik in Berlin und Leipzig aufgeführt, was Horváth dazu veranlasst, eine „Gebrauchsanweisung“ für die Inszenierung seiner Stücke zu verfassen. Im selben Jahr schreibt er den Totentanz „Glaube, Liebe, Hoffnung“ in Zusammenarbeit mit seinem Bekannten Lukas Kristel. Mit der Machtübernahme der NSDAP unter Führung von Adolf Hitler im Jahre 1933 muss die geplante Aufführung von „Glaube, Liebe, Hoffnung“ abgesagt werden. Horváth wird von den Nationalsozialisten gezwungen Deutschland zu verlassen und reist erst nach Salzburg und schließlich nach Wien. Er verfasst in diesem schweren Jahr „Die Unbekannte aus der Seine“ und „Hin und her“ und heiratet am 27. Dezember die Sängerin Maria Elsner in Wien, von der er sich bereits ein Jahr später scheiden lässt. Als geplante Aufführungen seiner Werke in Wien nicht zustande kommen, reist Horváth 1934 nach Berlin, um an Filmdialogen zu arbeiten. Die Uraufführung von „Hin und her“ im Dezember in Zürich ist erfolgreich. 1935 verfasst der finanziell angeschlagene Horváth für den Max-Pfeffer-Verlag das Lustspiel „Mit dem Kopf durch die Wand“, das er nach mehrmaliger Umarbeitung und der misslungenen Uraufführung in Wien verwirft. Nach der Übersiedlung nach Henndorf nahe Salzburg entstehen im Jahr 1936 „Figaro lässt sich scheiden“, „Don Juan kommt aus dem Krieg“, „Ein Dorf ohne Männer“ und „Der jüngste Tag“, wobei für das Drama erst den Titel „Freigesprochen“ geplant ist. „Glaube, Liebe, Hoffnung“ wird im November in Wien uraufgeführt. Der 1937 vollendete Roman „Jugend ohne Gott“ wird ein durchschlagender Erfolg. Das Werk wird sogar in zahlreichen Sprachen übersetzt. Horváth beginnt in diesem Jahr seinen zweiten Roman „Ein Kind unserer Zeit“, den er auch im selben Jahr vollendet . Kurz nach der Uraufführung von „Der jüngste Tag“ am 11. Dezember 1937 in Mährisch-Ostrau distanziert sich Horváth von seinen Bühnenstücken, die er in den Jahren 1932 – 1936 geschrieben hatte. Er fasst den Entschluss, ohne Rücksicht auf geschäftliche Interessen eine „Komödie des Menschen“ zu schreiben, in die er „Pompeji“ und „Ein Dorf ohne Männer“ integrieren will. 1938 ist durch starke Depressionen und Unzufriedenheit Horváths gekennzeichnet und hindert ihn weitere Werke zu vollenden, beispielsweise seinen geplanten Roman „Adieu Europa!“. Nach einer längeren Reise in seinen Geburtsort, Budapest und anderen Städten begibt sich Horváth im Mai nach Paris, um über eine Verfilmung von „Jugend ohne Gott“ zu verhandeln. Am 1. Juni 1938, dem Abend vor seiner Rückreise nach Zürich, wird Ödön von Horváth von einem herabstürzenden Ast auf der Straße gegenüber dem Theâtre Marigny erschlagen. Seine Beisetzung findet sechs Tage später auf dem Friedhof St. Ouen in Paris statt.
In einem Nachwort folgert Ulrich Becher: „…für mich besteht wenig Zweifel, daß er, hätte er überlebt, neben Brecht der größte zeitgenössische Bühnendicht deutscher Sprache geworden wäre…“ [2]
Das Drama „Der jüngste Tag“
Strukturanalyse
Das im Jahr 1936 entstandene Drama „Der jüngste Tag“ von Ödön von Horváth gehört zu den Spätwerken des Autors. Beschrieben wird darin die Auseinandersetzung der Figuren mit ihrer Schuld oder Unschuld an einem Zugunglück. Das Drama ist in chronologischer Reihenfolge in sieben Bilder gegliedert, die aufgrund ihrer Eigenständigkeit ein Kriterium der offenen Form dieser Gattung erfüllen. Zwar sind sie inhaltlich auf sich bezogen, aber sie unterscheiden sich in Zeit, Ort und auftretenden Personen stark voneinander. Dieser ständige Orts- und Zeitwechsel erfüllt damit auch ein Kriterium für das offene Drama.
Das erste Bild (S. 11-23) beginnt allerdings mit einer für das geschlossene Drama typischen Exposition, bei der verschiedene Figuren direkt von anderen Figuren charakterisiert werden. Die an der kleinen Bahnstation wartende Frau Leimgruber beschreibt einem auswärtigen Kosmetikvertreter einige Dorfbewohner, wie beispielsweise den Bahnhofsvorstand Thomas Hudetz: „…ein wirklich tüchtiger Mann, ein gebildeter, höflicher, emsiger Charakter, ein selten strammer Mensch“ (S. 12). Auch die Wirtstochter Anna Lechner wird von ihr als „personifizierte Unschuld“ (S.14) vorgestellt, die als unbeschwerte Verlobte des Fleischhauers Ferdinand darauf den Bahnhof erreicht. Tatsächlich ist Anna zu dem Zeitpunkt eine ganz „normale“ lebenslustige, junge Frau, die sich Kosmetik gekauft hat, um wie die Filmschauspielerinnen auszusehen. Das an der Station auftretende Geschwisterpaar Josefine Hudetz, die Gattin des Stationsvorstands und Alfons, der Drogeristen werden von Frau Leimgruber negativ beurteilt: „Der und seine Schwester, denen geht man aus dem Weg. Immer schneidens so stolze, gekränkte Gesichter…“ (S.18). Insbesondere gegen Frau Hudetz werden massive Vorwürfe erhoben: „Immer sekkiert sie den Mann mit ihrer blinden Eifersucht…“ (S.16) oder „Verführt hat sie diesen strammen, gebildeten Menschen…“ (S.18). Diese Aussagen beschreiben die unter den Dorfbewohnern einseitig herrschende Meinung, dass aufgrund des Alterunterschieds von 13 Jahren und der Eifersucht der älteren Josefine die Eheleute Hudetz gravierende Probleme haben. Die Schuld an der Situation wird ausschließlich Frau Hudetz angelastet und ihr Bruder Alfons als eine Art „Komplize“ ebenfalls ausgeschlossen. Mit diesen Charakterisierungen bekommt der Zuschauer einen Einblick in die Hintergründe, die für den weiteren Handlungsverlauf eine wichtige Rolle spielen und zur story als Vorgeschichte zählen. Der Konflikt zwischen Thomas Hudetz und seiner Frau bildet die Voraussetzung für den point of attack, der im Folgenden beschrieben wird.
Die Exposition endet mit dem Gespräch zwischen Thomas Hudetz und Anna, nachdem der verspätete Zug die Wartenden mitgenommen hat. Die Wirtstochter spricht Hudetz frech auf seine eifersüchtige Frau an, worauf er gereizt reagiert. Um seine sich in der Wohnung der Station befindende Gattin zu ärgern, gibt Anna ihm einen verhängnisvollen Kuss, der Hudetz davon ablenkt für einen Zug das wichtige Signal zu stellen (S. 22 f.). Diese Handlung bildet das erregende Moment des Dramas, da das unmittelbare Geschehen die weiteren Handlungssequenzen mitbestimmt. Denn die hier verursachte Ablenkung von Hudetz scheint das Zugunglück verursacht zu haben. Im Nebentext gibt es allerdings Hinweise, die diese Vermutung widerlegen. Bei zwei vorherigen Zügen hatte vor deren Durchfahrt ein Läutwerk darauf aufmerksam gemacht, während dieses Signal bei der Auseinandersetzung zwischen Hudetz und Anna ausbleibt: „Jetzt fährt der Eilzug vorbei…Er reißt einen Signalhebel herum, das Läutwerk läutet…“ (S. 23) Hier läutet das Lautwerk eindeutig nach der Durchfahrt des Zuges, d.h. ein technischer Fehler verursacht den Zusammenstoß der beiden Züge, nicht menschliches Versagen, wie es im weiteren Verlauf insbesondere von Anna angenommen wird. Hier wird bereits durch diesen Irrtum der Figuren der tragödienhafte Charakter dieses Dramas deutlich. Durch das abrupte Ende des ersten Bildes und der verdeckten Handlung bis zum nächsten Morgen am Unglücksort, findet eine Spannungssteigerung statt.
Das zweite Bild (S. 24-36) spielt am Ort des Zugunglücks, wo bereits im frühen Morgengrauen nach der Ursache für den Zusammenstoss der beiden Züge von Staatsanwalt, Gendarm und dem Kommissar gesucht wird. Thomas Hudetz, der Hauptverdächtige wird allerdings von einer Falschaussage von Anna entlastet, die sprachlich durch Parataxen charakterisiert ist: „…Ich habe es gehört, wie das Läutwerk geläutet hat, dann hat der Herr Vorstand das Signal gerichtet, und dann erst ist der Eilzug vorbeigefahren…“ (S.32). Hier ist eine weitere Zuspitzung der Handlung zu verzeichnen, denn die Lüge für den Vorstand hat für Anna persönliche Konsequenzen. Zwar wird Hudetz in verdeckter Handlung trotz der wahrheitsentsprechenden, belastenden Aussage seiner gekränkten Frau dank seiner Entlastungszeugin Anna freigesprochen, jedoch droht diese unter der Lüge zusammenzubrechen. Die Wandlung von Anna und das Durchleben des Prozesses der beteiligten Figuren bleiben im Dunkeln.
Bereits im dritten Bild (S. 37-47) bei der Willkommensfeier von Hudetz im Wirtshaus nach vier Monaten Untersuchungshaft wirkt sie bedrückt und kaum lebendig, was der Nebentext verdeutlicht: „…wird blass und fasst sich ans Herz“ (S.41) oder „lächelt verloren“. Anna hat sich von der lebenslustigen, jungen Frau zu einer in sich zurückgezogenen, zerbrechlichen Figur gewandelt. Thomas Hudetz dagegen kann und will sich keine Schuld eingestehen. Durch die nächtliche Verabredung mit Hudetz beim Viadukt und der Offenbarung ihrer Ängste im vierten Bild (S.48-53) wird der Höhepunkt des Dramas mit der Ermordung Annas durch Hudetz vorbereitet. Anna bittet Hudetz inständig, sie zu töten, um endlich von ihrer Bürde befreit zu sein. Nach ersten Widerwillen von Hudetz kann man erahnen, dass er letztendlich dieser Bitte doch nachkommt, wenn am Ende dieses Bildes sich Anna und er in den Armen liegen (S.53).
[...]
[1] von Horváth, Ödön (2001): Der jüngste Tag und andere Stücke. Kommentierte Werksausgabe in Einzelbänden, herausgegeben von Traugott Krischke. Frankfurt a. M.: Suhrkamp (= Suhrkamp Taschenbuch 3342). Seite 9-77.
[2] Hildebrand, Dieter (1975): Ödön von Horváth. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag. Seite 130.
-
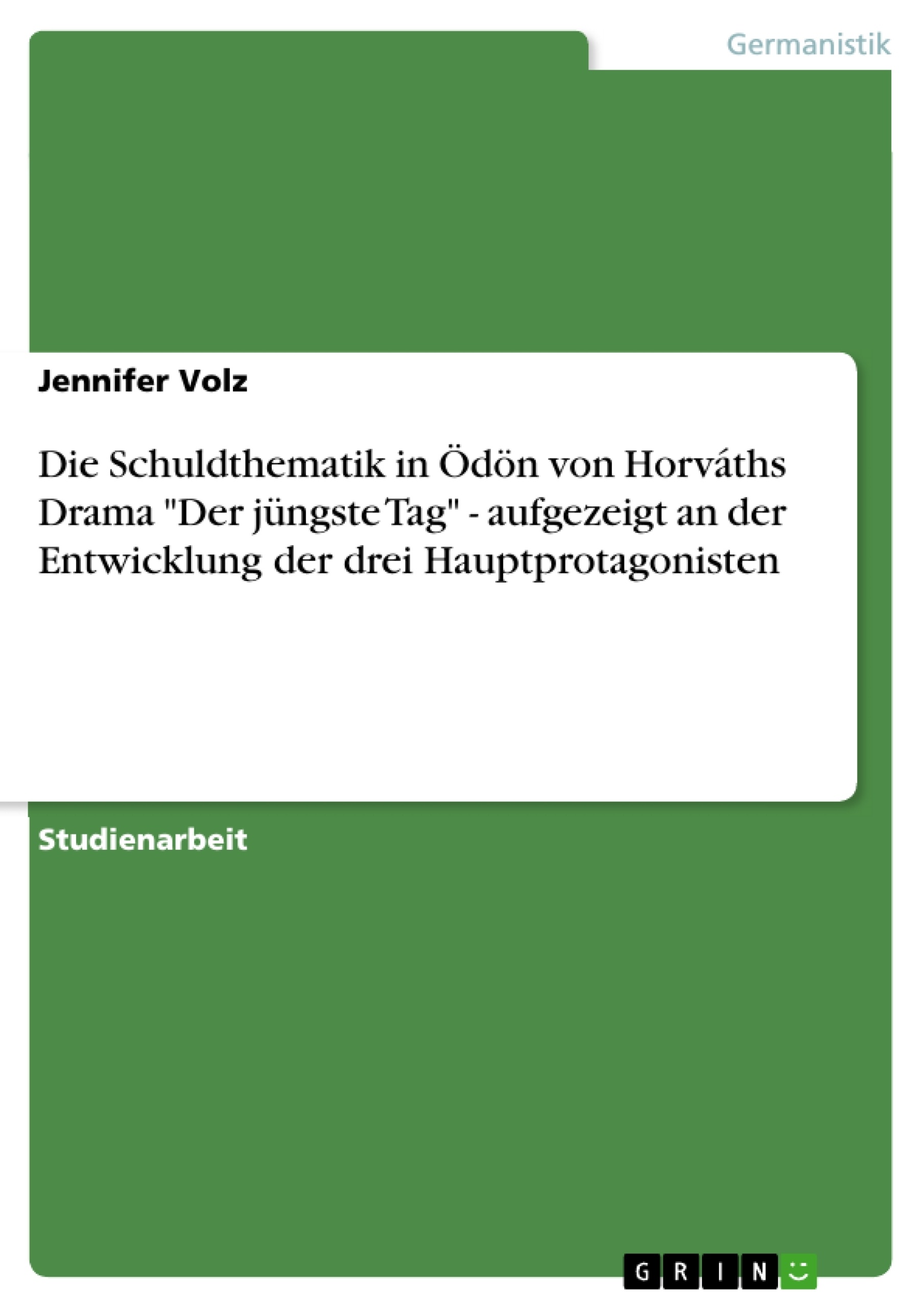
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.