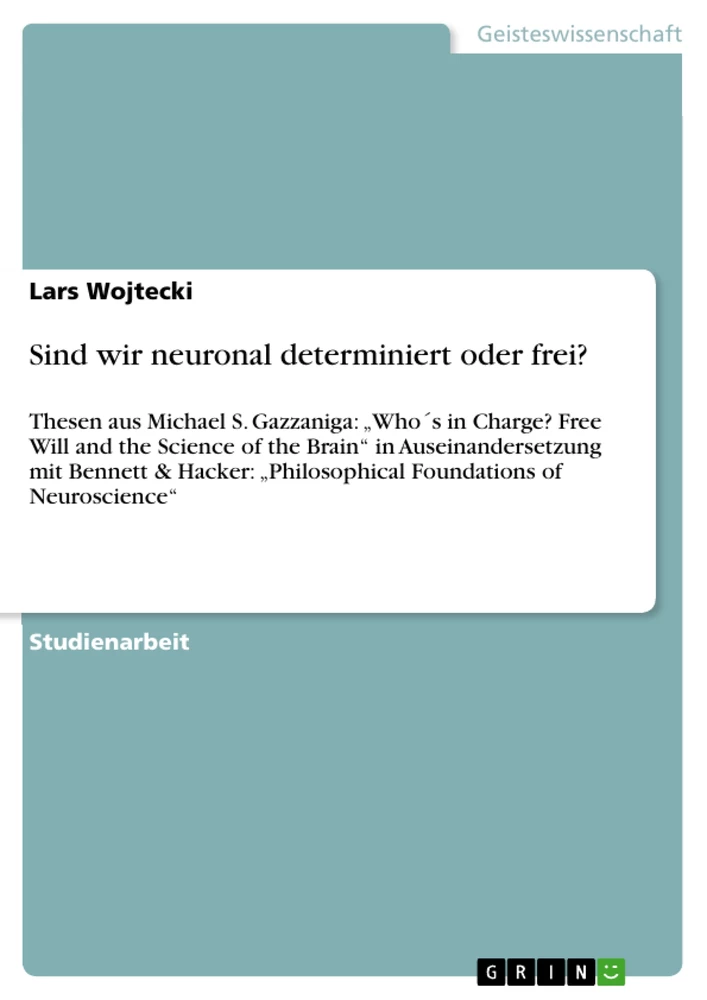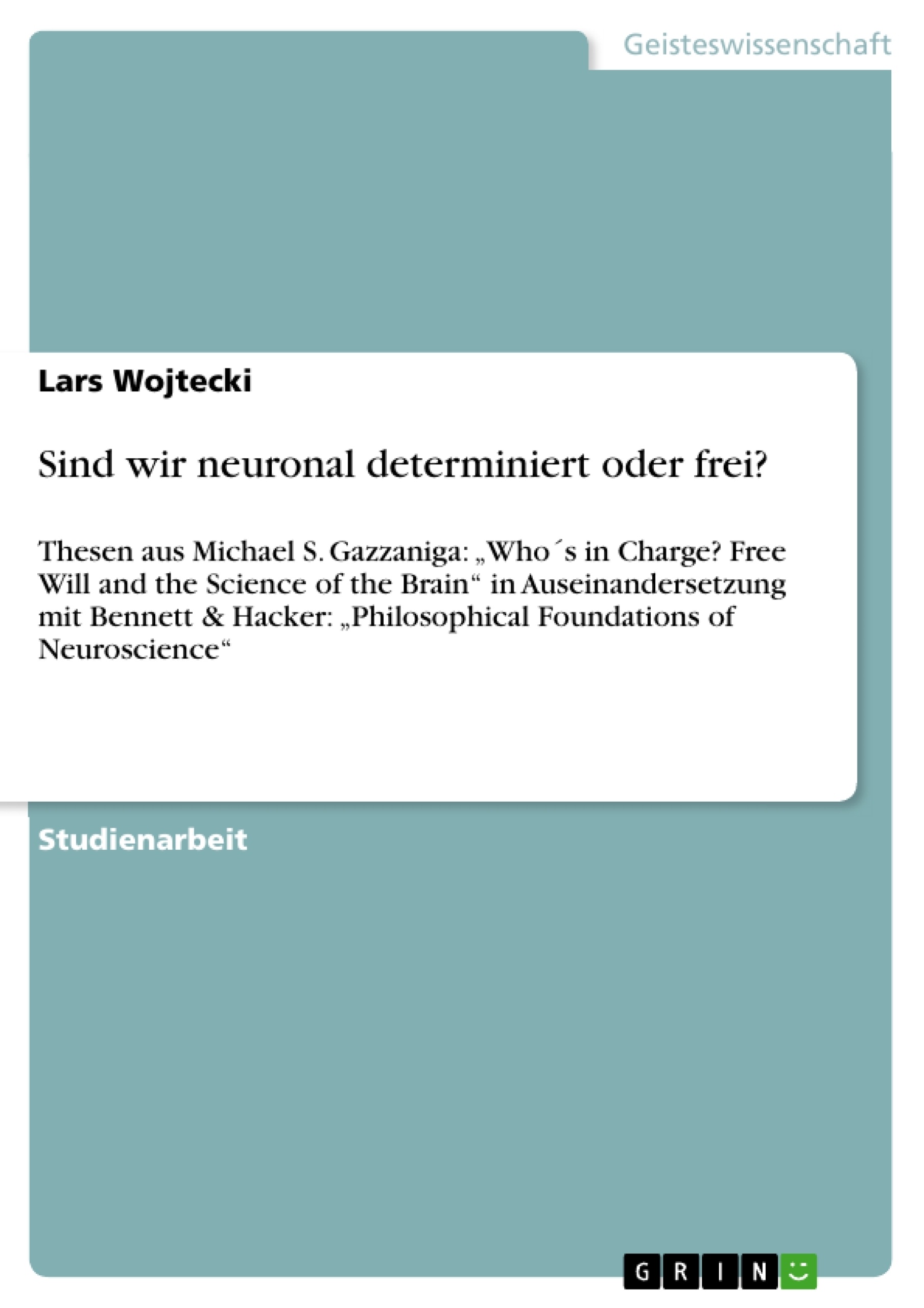Die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahrzehnte scheinen ein neues Licht auf die alte Frage der menschlichen Willensfreiheit zu werfen.
Das Gehirn als Teil der empirisch zugänglichen wissenschaftlichen Welt mit seinen Kausalgesetzen und letztlich seiner Determiniertheit scheint in einer neuen Weltsicht an die Stelle des Menschen als intentional und frei handelndes Ich getreten zu sein. Die vordergründige Konsequenz, somit uns als Menschen nicht als frei sondern eben nach naturwissenschaftlichen Gesetzen determiniert zu sehen entspricht trotzdem nicht unserem alltäglichen Grundverständnis, unserer Grundintuition, unserem alltäglich Sprachgebrauch, in dem wir uns als frei handelnd empfinden. Im Folgenden sollen die empirischen Untersuchungen eines der bekanntesten kognitiven Neurowissenschaftlers unserer Zeit (Michael S. Gazzaniga) kurz referiert und die daraus abgeleiteten Hypothesen untersucht werden. Zu Hilfe genommen wird das dabei Werk von Bennett & Hacker „Philosophical Foundations of Neuroscience“.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Der freie Wille des Menschen versus neuronaler Determiniertheit
- 2 Michael S. Gazzanigas neurowissenschaftliche Untersuchungen und Thesen zum freien Willen
- 2.1 Gazzanigas neurowissenschaftliche Untersuchungen: „Split Brain“ und ihre Schlussfolgerungen
- 2.2 Gazzanigas aktuelle Thesen zum freien Willen in „Who´s in charge?”
- 3 M.R. Bennett & P.M.S Hacker: „Philosophical Foundations of Neuroscience“
- 3.1 Kritik durch Bennett & Hacker an Gazzingas Schlussfolgerungen
- 3.2 Analyse der aktuellen Thesen Gazzanigas im Sinne von Bennett & Hacker
- 4 Diskussion und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage nach der Vereinbarkeit von neuronaler Determiniertheit und freiem Willen anhand der neurowissenschaftlichen Untersuchungen von Michael S. Gazzaniga und der philosophischen Kritik von Bennett & Hacker. Ziel ist es, die gegensätzlichen Positionen zu präsentieren und zu analysieren, ohne eine definitive Antwort auf die zentrale Frage zu geben.
- Der freie Wille im Kontext neurowissenschaftlicher Erkenntnisse
- Analyse von Gazzanigas „Split Brain“-Forschung und ihren Schlussfolgerungen
- Bewertung von Gazzanigas kompatibilistischen Thesen zum freien Willen
- Kritik von Bennett & Hacker an Gazzanigas Ansätzen
- Diskussion der verschiedenen Positionen zum Determinismus und zur Willensfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Der freie Wille des Menschen versus neuronaler Determiniertheit: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Vereinbarkeit von freiem Willen und neuronaler Determiniertheit. Sie beleuchtet den scheinbaren Widerspruch zwischen unserem alltäglichen Verständnis von freiem Handeln und dem deterministischen Weltbild der Neurowissenschaften. Die Arbeit skizziert verschiedene philosophische Positionen (harter Determinismus, Libertarismus, Kompatibilismus) und kündigt die Gegenüberstellung der Ansätze von Gazzaniga und Bennett & Hacker an. Der Fokus liegt auf der Analyse von Gazzanigas empirischen Untersuchungen und seiner aktuellen kompatibilistischen Position im Licht der Kritik von Bennett & Hacker.
2 Michael S. Gazzanigas neurowissenschaftliche Untersuchungen und Thesen zum freien Willen: Dieses Kapitel fasst Gazzanigas neurowissenschaftliche Arbeit zusammen, insbesondere seine „Split Brain“-Studien an Patienten mit durchtrennter Corpus callosum. Es beschreibt die Erkenntnisse über die funktionale Spezialisierung der Gehirnhälften und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen für das Verständnis von Bewusstsein und Handlungssteuerung. Der Abschnitt führt dann Gazzanigas aktuelle Thesen aus „Who's in charge?“ ein, die einen kompatibilistischen Ansatz zur Willensfreiheit vertreten. Die Zusammenfassung legt den Schwerpunkt auf die empirischen Befunde und deren Interpretation im Kontext der Debatte um freien Willen.
3 M.R. Bennett & P.M.S Hacker: „Philosophical Foundations of Neuroscience“: Dieses Kapitel präsentiert die Kritik von Bennett & Hacker an Gazzanigas Schlussfolgerungen und seiner kompatibilistischen Position. Es analysiert die philosophischen Grundlagen von Gazzanigas Arbeit und argumentiert, dass seine Interpretation der neurowissenschaftlichen Befunde methodisch fehlerhaft und philosophisch ungenügend ist. Der Fokus liegt auf der detaillierten Darstellung der Kritikpunkte von Bennett & Hacker und deren Bedeutung für die Debatte um freien Willen und Determinismus. Der Abschnitt zeigt die unterschiedlichen Ansätze der beiden Autoren auf und analysiert die philosophischen Implikationen.
Schlüsselwörter
Freier Wille, Neuronale Determiniertheit, Willensfreiheit, Determinismus, Kompatibilismus, Inkompatibilismus, Neurowissenschaften, Gazzaniga, Bennett & Hacker, Split-Brain, Bewusstsein, Handlungssteuerung, Philosophie des Geistes.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Der freie Wille des Menschen versus neuronale Determiniertheit
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Vereinbarkeit von neuronaler Determiniertheit und freiem Willen. Sie analysiert die gegensätzlichen Positionen von Michael S. Gazzaniga (neurowissenschaftliche Perspektive) und Bennett & Hacker (philosophische Kritik) ohne eine definitive Antwort zu liefern.
Welche Autoren und deren Werke werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die neurowissenschaftlichen Untersuchungen von Michael S. Gazzaniga, insbesondere seine „Split Brain“-Studien und seine Thesen in „Who´s in charge?“. Demgegenüber steht die philosophische Kritik von M.R. Bennett & P.M.S. Hacker aus ihrem Werk „Philosophical Foundations of Neuroscience“.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die zentrale Frage ist: Wie vereinbaren sich neuronale Determiniertheit und freier Wille? Weitere Fragen betreffen die Interpretation von Gazzanigas „Split Brain“-Forschung, die Bewertung seiner kompatibilistischen Thesen zum freien Willen und die Analyse der Kritik von Bennett & Hacker an Gazzanigas Ansätzen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit präsentiert und analysiert die gegensätzlichen Positionen von Gazzaniga und Bennett & Hacker. Es findet eine detaillierte Auseinandersetzung mit den empirischen Befunden Gazzanigas und der philosophischen Argumentation von Bennett & Hacker statt. Der Fokus liegt auf der kritischen Analyse und Gegenüberstellung beider Perspektiven.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Gazzanigas neurowissenschaftlichen Untersuchungen und Thesen, ein Kapitel zur Kritik von Bennett & Hacker, und eine abschließende Diskussion und Zusammenfassung. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse und Argumente zusammen.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte sind: Freier Wille, Neuronale Determiniertheit, Willensfreiheit, Determinismus, Kompatibilismus, Inkompatibilismus, Neurowissenschaften, „Split-Brain“, Bewusstsein und Handlungssteuerung.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zielt nicht auf eine definitive Antwort auf die Frage nach der Vereinbarkeit von freiem Willen und neuronaler Determiniertheit ab, sondern präsentiert und analysiert die gegensätzlichen Positionen von Gazzaniga und Bennett & Hacker, um ein umfassendes Verständnis der Debatte zu ermöglichen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich für die philosophischen und neurowissenschaftlichen Aspekte der Willensfreiheitsdebatte interessieren. Sie ist besonders relevant für Studierende der Philosophie, Neurowissenschaften und verwandter Disziplinen.
- Quote paper
- Dr Lars Wojtecki (Author), 2013, Sind wir neuronal determiniert oder frei?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267654