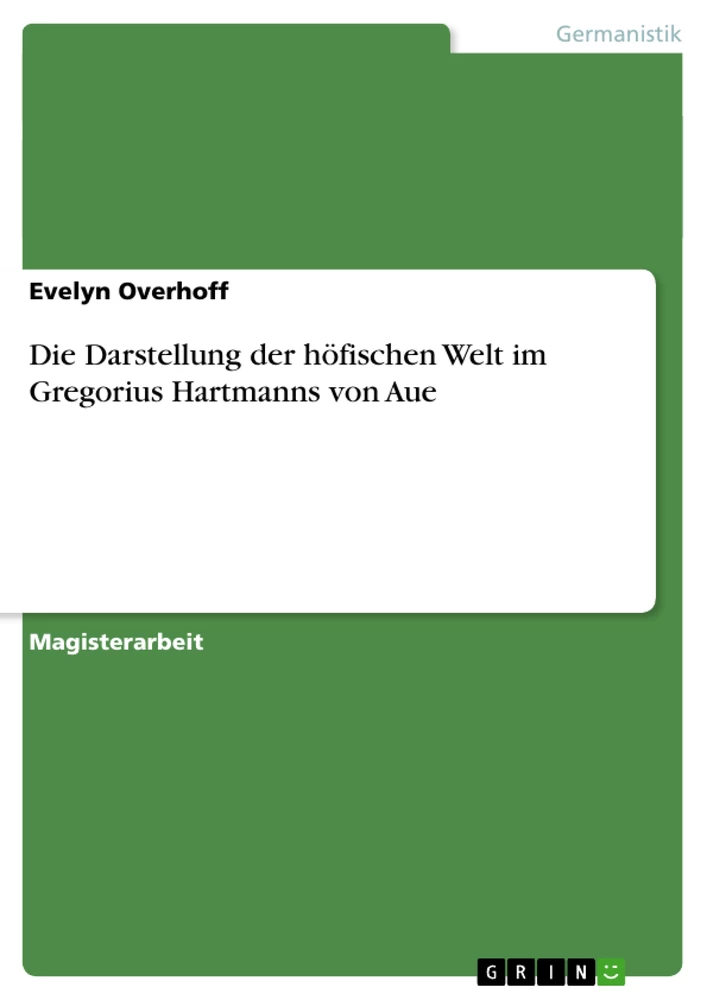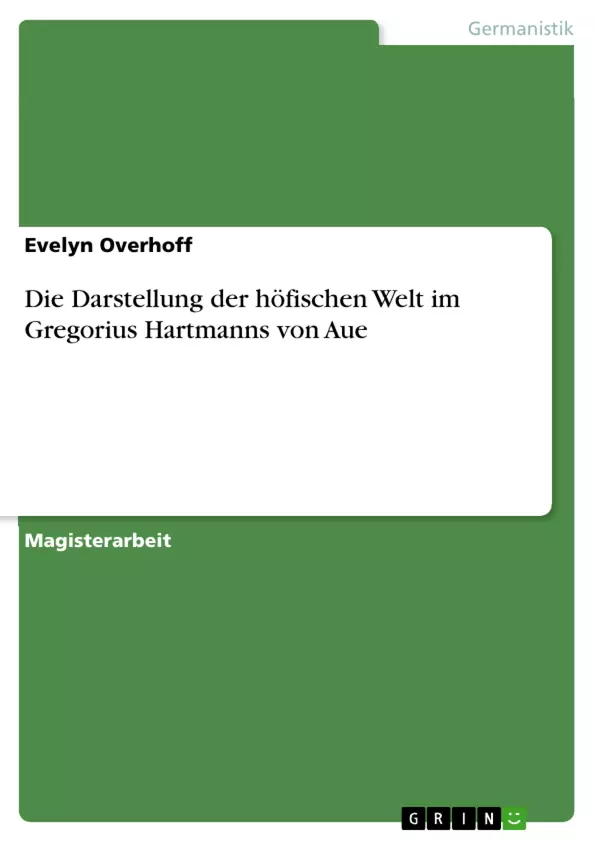Der Gregorius Hartmanns von Aue ist vor allem seit den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts wieder verstärkt in das Blickfeld und Interesse der Forschung gerückt.
Hierbei ergaben sich zwei große Schwerpunkte, die die Diskussion zum
Gregorius wesentlich geprägt haben.
Untersuchungsgegenstand war zunächst vor allem die Frage nach der Schuld des
Protagonisten. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand das Problem, welchen Sinn
die so unverhältnismäßig hart ersche inende Buße, die sich Gregorius selbst nach
dem Inzest mit seiner Mutter aufe rlegt, in der Erzählung hat.
Ein weiteres Forschungsgebiet war die Frage der Gattungszugehörigkeit. Hartmanns
Quelle ist eine altfranzösische Legende eines unbekannten Dichters, die er
vor allem in bezug auf höfische Elemente, wie z.B. das Thema der Ritterschaft,
erheblich verändert und ausgearbeitet hat. Diese offensichtliche Verlagerung des
Schwerpunktes ließ nun in der Forschung die Frage nach der Gattung aufkommen,
denn Hartmann hat mit seinem Gregorius ein Werk geschaffen, das sich keiner
der gängigen Gattungen eindeutig zuordnen läßt. Als Gattungsbezeichnung wurde
schließlich der Begriff der „höfischen Legende“ oder des „Legendenromans“ eingeführt;
beide Begriffe stellen einen Kompromiß dar, erscheinen aber dennoch für
das Werk – wenn man es denn unbedingt einer Gattung zuordnen muß–einigermaßen
adäquat.
Jetzt scheint die Forschung zum Gregorius an einem „toten Punkt“ zu sein, denn
man hat erkannt, daß sich sowohl die Schuld- als auch die Gattungsfrage nicht
eindeutig klären lassen. Jedoch eröffnen sich in der germanistischen Mediävistik
neue Untersuchungsfelder, die sich mit der Übernahme von Themen aus der ant hropologischen
Geschichtswissenschaft ergeben.
Der Gregorius spielt sich in mehreren voneinander sehr unterschiedlichen Welten
ab, die man in einem ersten Zugang entsprechend den Polen „höfisch“ und „außerhöfisch“
bewerten kann.
Zunächst ist dies die höfische Welt, in welcher der Inzest stattfindet, der zur Geburt
des Titelhelden führt, die nächste Passage spielt auf einer Klosterinsel, auf
der das ausgesetzte Findelkind aufwächst, es folgt wiederum eine Passage, die in
der höfischen Welt situiert ist und in der sich Gregorius als Ritter bewährt, nach
der Entdeckung des Inzests mit seiner Mutter zieht sich Gregorius zur Buße auf einen Stein außerhalb der höfischen Welt zurück, um schließlich von Gott zum
Papst erwählt zu werden und am päpstlichen Hof in der höchsten für einen Menschen
erreichbaren Würde zu leben.[...]
Inhaltsverzeichnis
-
Der Gregorius - ein „toter Klassiker“?
-
Die höfische Welt im Gregorius
-
Familiäre Strukturen
-
Zur Vorgehensweise der Untersuchung
-
-
Der adlige Haushalt und die Verwandtschaft
-
Der Inzest in der mittelalterlichen Gesellschaft
-
Das Kloster als Familie
-
Die mittelalterliche Familie in der literarischen Darstellung und der literarhistorischen Forschung
-
Der Ödipus-Stoff
-
Christliche Inzestlegenden
-
Die Albanuslegende
-
Die Judas-Legende
-
-
Inhaltliche Elemente des höfischen Romans
-
Strukturelle Elemente des höfischen Romans
-
Dialoge und Monologe
-
Motivkorrespondenzen
-
Das Problem des Doppelwegs
-
-
Legenden-Motive
-
Die Stellung von Prolog und Epilog bei der Gattungszuordnung
-
Die Raumstruktur
-
Die verschiedenen Höfe
-
Aquitanien I.
-
Der Tugendkatalog des Vaters
-
Aquitanien I nach der Geburt des Kindes
-
Bewertung des Hofes durch den Erzähler
-
-
Aquitanien II.
-
Der Hof in Rom I
-
Der Hof in Rom unter Gregorius
-
-
Höfische Elemente
-
Schönheit
-
Die Ausbildung zum Ritter
-
Die Ritterschaft
-
-
Verwandtschaft in La vie du pape saint Grégoire
-
Aquitanien, das Kloster, der Felsen und das Papsttum
-
Herrschaft, Genealogie und Identität in der Adelsgesellschaft des Gregorius
-
Das Kloster als Familie des heranwachsenden Gregorius
-
Die Inzesthandlungen im Gregorius
-
Der Geschwisterinzest
-
Der Mutter-Sohn-Inzest
-
Der Inzest als Krise des Gesetzes der Unterschiede
-
Gregorius und Ödipus
-
Der doppelte Inzest (und die Verheimlichung) als Voraussetzung für die Erwählung
-
Die Situierung der Inzesthandlungen in der höfischen Welt
-
-
Die Aufhebung der Verwandtschaftsstrukturen als Voraussetzung für die Erwählung?
-
Die Rolle der weiblichen Hauptfigur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung der höfischen Welt in Hartmanns von Aues Gregorius. Sie analysiert die verschiedenen Aspekte der höfischen Gesellschaft im Werk, wie familiäre Strukturen, Inzest und die Rolle der Ritterschaft.
- Die Darstellung der höfischen Welt im Gregorius
- Die Funktion des Inzests in der höfischen Gesellschaft
- Der Einfluss des Klosters auf die Familiendynamik im Werk
- Die Rolle der Ritterschaft in der höfischen Welt
- Der Vergleich des Gregorius mit anderen literarischen Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Relevanz des Gregorius in der heutigen Forschung und die Frage der Gattungszuordnung. Das zweite Kapitel beleuchtet den adligen Haushalt und die Verwandtschaft im Werk und setzt den Inzest in den Kontext der mittelalterlichen Gesellschaft. Das dritte Kapitel analysiert die Rolle des Klosters als Familie und befasst sich mit der literarischen Darstellung der mittelalterlichen Familie.
Das vierte Kapitel beleuchtet die inhaltlichen und strukturellen Elemente des höfischen Romans im Gregorius. Das fünfte Kapitel analysiert die Raumstruktur des Werkes und die verschiedenen Höfe, die im Gregorius vorkommen. Das sechste Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Verwandtschaft und des Inzests im Gregorius.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen des Mittelalters, insbesondere der Darstellung der höfischen Welt und des Inzests in der Literatur. Dabei spielen Aspekte der Familienstruktur, der Ritterschaft und des Klosterlebens eine wichtige Rolle. Die Arbeit bezieht sich dabei auf den Gregorius Hartmanns von Aue und setzt ihn in einen Kontext mit anderen literarischen Werken und wissenschaftlichen Disziplinen.
- Citation du texte
- Evelyn Overhoff (Auteur), 2002, Die Darstellung der höfischen Welt im Gregorius Hartmanns von Aue, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13379